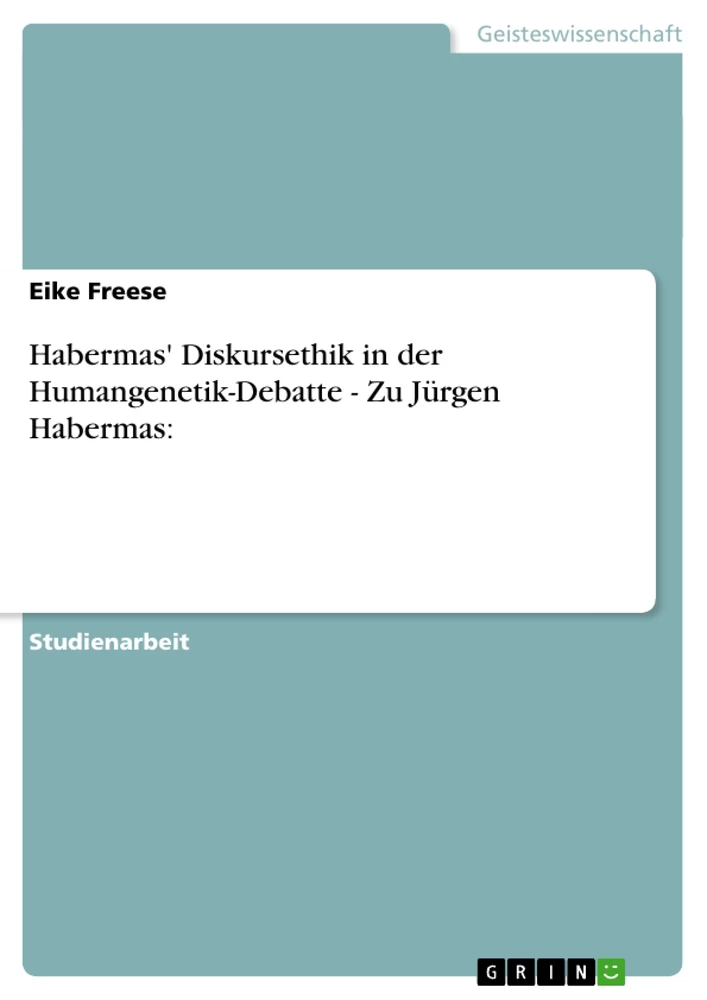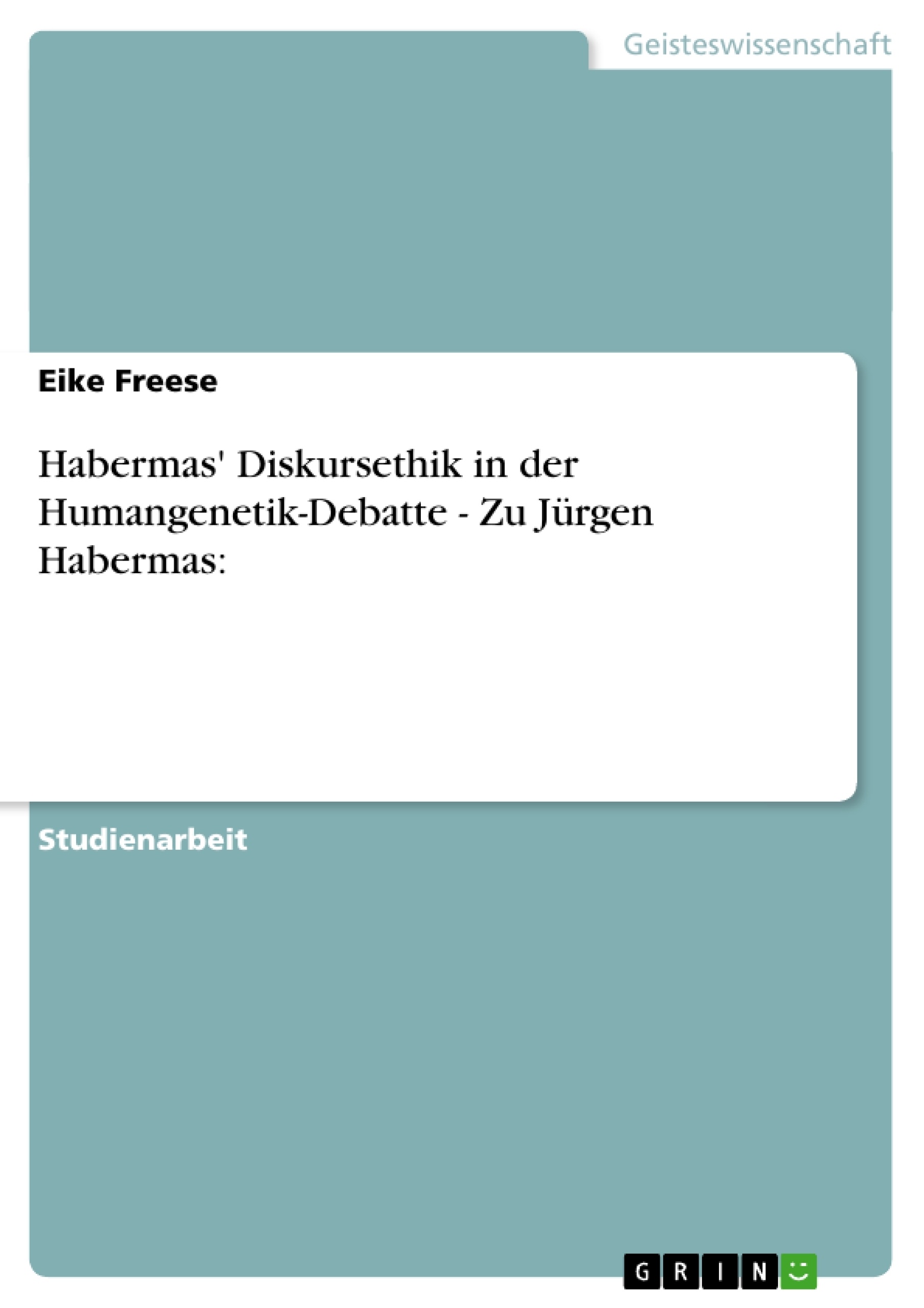In der Bioethik-Debatte kann der Philosophie, neben anderen Disziplinen, die wichtige Aufgabe zukommen, unausgesprochene Vorurteile, schwer lokalisierbare Ängste und verheißungsvolle Zukunftsphantasien auf ihre Herkunft, Bedeutung und Berechtigung zu überprüfen. Wenn sie diese Erkenntnisse erfolgreich vermittelt, leistet sie einen wertvollen Beitrag zur demokratischen Kultur, indem sie die zwangsläufig von Eliten diverser Art gefällten Entscheidungen über den weiteren Fortgang der Gentechnik für alle durchschaubar macht – bei einem Thema, das eines Tages alle angehen wird.
In seinem Aufsatz „Die Zukunft der menschlichen Natur“ versucht Jürgen Habermas genau dies zu leisten: Die Debatte um die Bioethik auf ein rationales Fundament zu stellen und Begründungsmuster diesseits von Religion und Metaphysik zu entwickeln, mit denen sich eine Haltung finden lässt gegenüber der Gentechnik mit all ihren Verheißungen und Bedrohungen. Habermas will zeigen, inwiefern die Gentechnik an sich unser heutiges Selbstverständnis und Moralempfinden in Frage stellt und wo ihre Bedrohung jenseits des medizinischen Risikos liegt: Dass Autonomie und Freiheit des Menschen auf dem Spiel stehen.
Nach einer skizzenhaften Einleitung in den Gegenstand der ethisch problematischen Technologien der Humangenetik (II.) sollen zunächst grundlegende Voraussetzungen, Eigenschaften und das Verfahren der von Habermas vertretenen Diskursethik dargestellt werden (III.). Im Folgenden (IV.) wird nachvollzogen, inwiefern Habermas durch die Anwendung der neueren eugenischen Techniken den egalitären Universalismus als solchen bedroht sieht – und wie seine Bewertungen und Empfehlungen für eine zukünftige eugenische Praxis zu verstehen sind. Seine Argumentation wird abschließend einer kritischen Prüfung unterzogen (V.), wobei Habermas’ eigener Anspruch im Vordergrund stehen soll: Der, eine universal vermittelbare, säkulare, verpflichtende, rational einsichtige, nachmetaphysische und nicht-tabuisierende Beurteilung des Problems zu finden. Jürgen Habermas muss, als Vertreter des kommunikativen Handelns, in dieser Debatte einen Weg einschlagen, der auf Verständigung ausgerichtet ist: Sein Ziel kann es nicht sein, moralische Richtigkeit einfach zu deklamieren – er will mit Gründen zeigen, wo genau ein Konsens möglich wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ethische Problemstellungen der Gentechnologie und die habermassche Perspektive
- Neuere problematische Möglichkeiten der Gentechnologie
- Differenzierungsschwierigkeiten: Negative und positive Eugenik. Wann beginnt Eugenik?
- Ausgewählte ethische und politische Problemfelder der Eugenik
- Habermas' Fragestellung und sein Argumentationsziel
- Habermas' Theorie der Moral: Grundzüge der Diskursethik
- Pragmatische, ethische und moralische Diskurse
- Formalistische statt substanzialistische Moraltheorie: Moral als Verfahrensbegriff
- Konsenstheorie der Wahrheit und linguistisch geprägte Moral
- Kognitivistische Moraltheorie
- Kommunikatives Handeln: Die Ordnung des moralischen Diskurses
- Die Zukunft der menschlichen Natur
- Moralisierung der menschlichen Natur
- Die Diskursethik als formale und inhaltliche Argumentationsgrundlage
- Das Fremdbestimmungsargument: Fragwürdige Mitautorschaft über ein fremdes Leben
- Das Asymmetrie-Argument: Verstetigung der Abhängigkeit zwischen Generationen
- Die gattungsethische Frage
- Eugenik als kommunikatives Handeln
- Argumentation an „vorgezogener Front“
- Habermas an Habermas gemessen: Grenzen seiner Argumentation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die ethischen Problemstellungen der Gentechnologie aus der Perspektive der Habermas'schen Diskursethik zu beleuchten. Sie analysiert, inwiefern Jürgen Habermas die Gentechnologie als Bedrohung für das Selbstverständnis und Moralempfinden des Menschen sieht und welche ethischen und politischen Folgen er daraus ableitet.
- Die ethischen Herausforderungen der Gentechnologie und die Frage nach moralisch verantwortungsvollem Umgang mit ihr.
- Die Kritik an der Eugenik und die Gefahren, die sie für die menschliche Autonomie und Freiheit birgt.
- Die Diskursethik als Grundlage für eine ethische Beurteilung der Gentechnologie und die Suche nach einem Konsens in einer pluralistischen Gesellschaft.
- Die Frage nach der Zukunft der menschlichen Natur und die Notwendigkeit einer „Gattungsethik“.
- Die Grenzen der Habermas'schen Argumentation und die Debatte um die Rolle der Philosophie in der Bioethik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gentechnologie und die Relevanz der philosophischen Reflexion in der Bioethik-Debatte ein. Sie stellt die Arbeit von Jürgen Habermas „Die Zukunft der menschlichen Natur“ vor und beschreibt seinen Ansatz, die ethischen Fragen der Gentechnologie mit Hilfe der Diskursethik zu beantworten.
Das zweite Kapitel beleuchtet die ethischen Problemstellungen der Gentechnologie und die Position Habermas'. Es werden aktuelle technologische Möglichkeiten der Gentechnik vorgestellt und die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen negativer und positiver Eugenik diskutiert.
Das dritte Kapitel erläutert die Grundzüge der Diskursethik von Jürgen Habermas. Es werden die wesentlichen Merkmale dieser ethischen Theorie dargestellt, darunter die Unterscheidung zwischen pragmatischen, ethischen und moralischen Diskursen, die Betonung des Verfahrenscharakters von Moral und die Rolle des kommunikativen Handelns.
Im vierten Kapitel wird Habermas' Analyse der Gentechnologie im Lichte seiner Diskursethik vorgestellt. Es werden seine Argumente gegen die Eugenik dargestellt, die sich auf die Aspekte der Autonomie und Freiheit des Menschen sowie die Gefahr einer Veränderung der „menschlichen Natur" konzentrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Bioethik und der Gentechnologie, insbesondere der Eugenik, sowie mit der Anwendung der Diskursethik von Jürgen Habermas auf diese Themen. Wichtige Schlüsselbegriffe sind daher: Diskursethik, Gentechnologie, Eugenik, Autonomie, Freiheit, Moral, Selbstverständnis, Menschliche Natur, Gattungsethik, Kommunikatives Handeln, Konsens, Pluralismus.
- Citar trabajo
- Eike Freese (Autor), 2003, Habermas' Diskursethik in der Humangenetik-Debatte - Zu Jürgen Habermas:, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74289