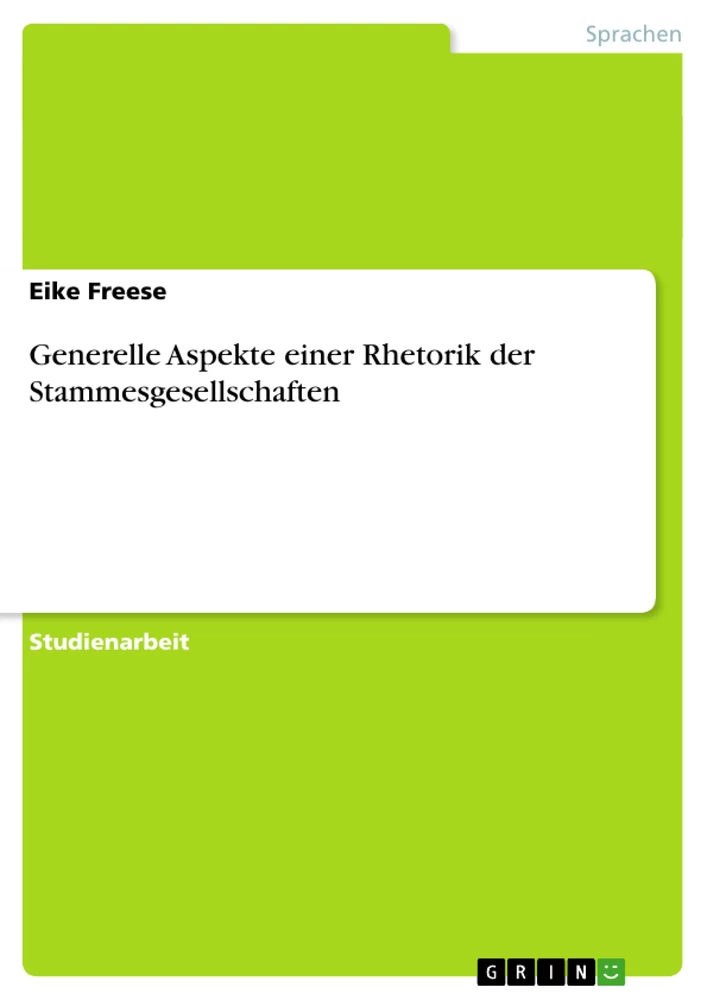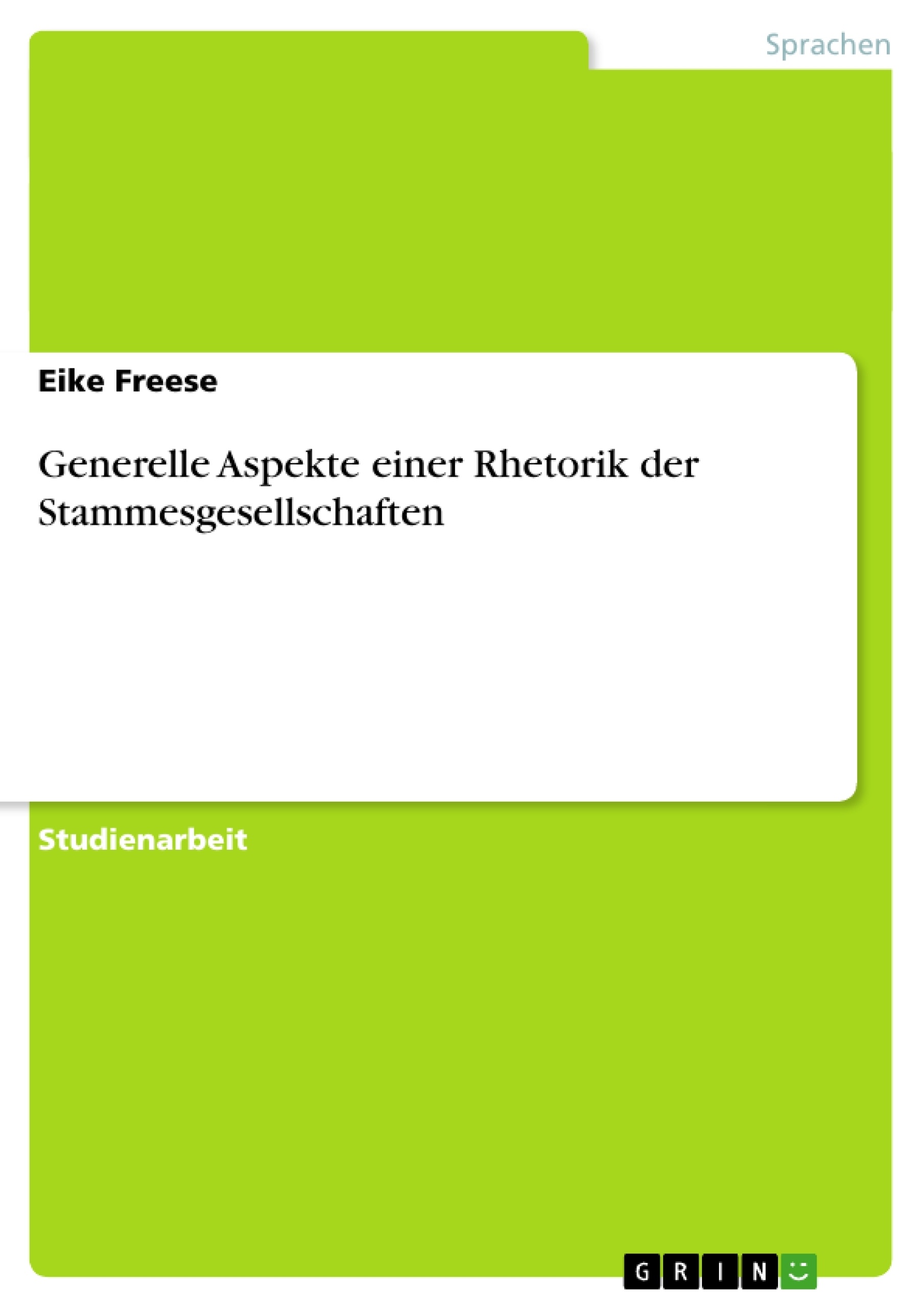Eine Analyse der Rhetorik der Stammesgesellschaften liefert im Idealfall nicht nur Aufschlüsse über die gegenwärtige Redepraxis, die uns in fremden Kulturen begegnet, sondern verschafft Einblicke in die Formen der Kommunikation, die in einer prähistorischen Vergangenheit vorherrschten: Einer Zeit, als die Schrift noch nicht das Selbst- und Weltbild des Menschen unwiderruflich veränderte, als ein Begriff von Wissenschaft noch nicht existierte, als die sozialen Ungleichheiten sich noch auf einfache Aufgabenteilung nach Geschlecht und Alter beschränkten und es das Individuum nach modernem Verständnis noch nicht gab.
Der von der Kulturanthropologie gebrauchte evolutionäre Ansatz kann uns helfen, den Forschungsgegenstand sinnvoll einzugrenzen. Dieses Modell, das vornehmlich dazu benutzt wird, „kulturübergreifende Gleichheiten zwischen Gesellschaften hervorzuheben“, geht davon aus, dass die adaptiven Verfahren, derer sich eine Gesellschaft zu ihrer Reproduktion bedient, in Verbindung mit ihrer Umwelt maßgeblich zur Ausbildung ganz charakteristischer sozialer, politischer, und kultureller Strukturen führen. Im Allgemeinen werden vier Hauptgruppen adaptiver Strategien beobachtet:
1. Wildbeutertum (Jagen und Sammeln, Fischerei)
2. Niederer Bodenbau (Sesshaftigkeit, Gartenbau mit einfachsten Werkzeugen)
3. Höherer Bodenbau (Ackerbau mit Pflug, Rad, Bewässerung)
4. Industrialismus (Nutzung von Maschinen)
Diese Reihe adaptiver Strategien folgt der generellen Evolution der Menschheit in den Industrieländern. Aus dieser Perspektive ist es erlaubt, zeitgenössische Stammesgesellschaften als quasi „prähistorisch“ zu betrachten: Behutsame Interpretation ihrer Lebensweise kann zusammen mit archäologischem Wissen zu einem konkreteren Bild des vorzeitlichen Menschen führen.
Da generelle Aspekte der Rhetorik dieser Kulturen das Thema der Arbeit sind, werden nur ausgewählte Aspekte (und bei weitem nicht alle) behandelt, die auch tatsächlich generalisierbar sind. Am Ende sollen Aspekte einer „idealtypischen“ traditionalen Gesellschaft benannt sein, von der sich real existierende traditionale Gesellschaften möglicherweise in Einzelpunkten unterscheiden. Die Beispiele aus der Feldforschung aber sollen das vorgeschlagene Modell unterstützen. Wichtig ist auch, alle diese allgemeinen Charakteristika einer traditionalen Gesellschaft als Tendenzen zu verstehen, die sich um so mehr verflüchtigen, je weiter jene im „evolutionären Kontinuum“ fortgeschritten ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Soziokulturelle Aspekte und Formierung des „rhetorischen Raums“
- a) Lebensverhältnisse und Wirtschaftsform
- b) Sozialordnung
- c) Nichtformalisiertes Recht…....
- d) Die Bedeutung der Magie
- e) Kultur des Mythos......
- f) Primäre Oralität.........
- III. Beispiele aus der Feldforschung ….……......
- a) Politische Entscheidungsfindung bei den Hamar – das osh .......
- b) Formalsprache: Die Merina auf Madagaskar.
- c) Alltagskommunikation bei den Hamar..\n
- IV. Generelle Aspekte einer Rhetorik der Stammes-gesellschaften.....
- a) Ars
- b) Artifex
- c) Opus............
- V. Schluss.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rhetorik in Stammesgesellschaften, um nicht nur die gegenwärtige Redepraxis in fremden Kulturen zu beleuchten, sondern auch Einblicke in die Kommunikationsformen der prähistorischen Vergangenheit zu gewinnen, als die Schrift noch nicht das Selbst- und Weltbild des Menschen prägte. Die Untersuchung konzentriert sich auf Wildbeuter und Gartenbauer, um generelle Aspekte der Rhetorik in traditionellen Gesellschaften zu beleuchten.
- Die Bedeutung der Oralität in Stammesgesellschaften
- Soziokulturelle Aspekte und Formierung des „rhetorischen Raums“
- Beispiele aus der Feldforschung zur Rhetorik in Stammesgesellschaften
- Generelle Aspekte einer Rhetorik der Stammesgesellschaften
- Die Rolle der Magie und des Mythos in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Rahmen der Untersuchung dar, indem sie die Besonderheiten der Kommunikation in Stammesgesellschaften im Kontext der prähistorischen Vergangenheit beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit soziokulturellen Aspekten, die den „rhetorischen Raum“ in Stammesgesellschaften prägen. Es analysiert die Lebensverhältnisse, die Sozialordnung, das Rechtssystem, die Bedeutung der Magie, die Kultur des Mythos und die primäre Oralität. Das dritte Kapitel präsentiert Beispiele aus der Feldforschung, die die theoretischen Ausführungen des zweiten Kapitels veranschaulichen. Das vierte Kapitel geht auf die generellen Aspekte einer Rhetorik der Stammesgesellschaften ein und analysiert die einzelnen Komponenten von Ars, Artifex und Opus.
Schlüsselwörter
Rhetorik, Stammesgesellschaften, Traditionelle Gesellschaften, Prähistorie, Oralität, Kultur des Mythos, Magie, Soziokulturelle Aspekte, Feldforschung, Ars, Artifex, Opus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Analyse der Rhetorik in Stammesgesellschaften?
Ziel ist es, Einblicke in Kommunikationsformen einer schriftlosen, prähistorischen Vergangenheit zu gewinnen und die heutige Redepraxis fremder Kulturen zu verstehen.
Welche Rolle spielt die Oralität in diesen Gesellschaften?
Da keine Schrift existiert, ist die primäre Oralität die einzige Form der Wissensbewahrung und sozialen Interaktion, was die Bedeutung der Rede enorm steigert.
Wie hängen Magie und Mythos mit der Rhetorik zusammen?
In Stammesgesellschaften ist die Sprache oft magisch aufgeladen; Mythen bieten den Rahmen für die Argumentation und die soziale Ordnung.
Welche adaptiven Strategien werden in der Kulturanthropologie unterschieden?
Es werden vier Gruppen unterschieden: Wildbeutertum, niederer Bodenbau, höherer Bodenbau und Industrialismus.
Was bedeuten die Begriffe Ars, Artifex und Opus in diesem Kontext?
Sie beschreiben die generellen Aspekte der Rhetorik: die Kunst des Redens (Ars), den Redner (Artifex) und das geschaffene Werk bzw. die Rede (Opus).
- Citar trabajo
- Eike Freese (Autor), 2002, Generelle Aspekte einer Rhetorik der Stammesgesellschaften, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74290