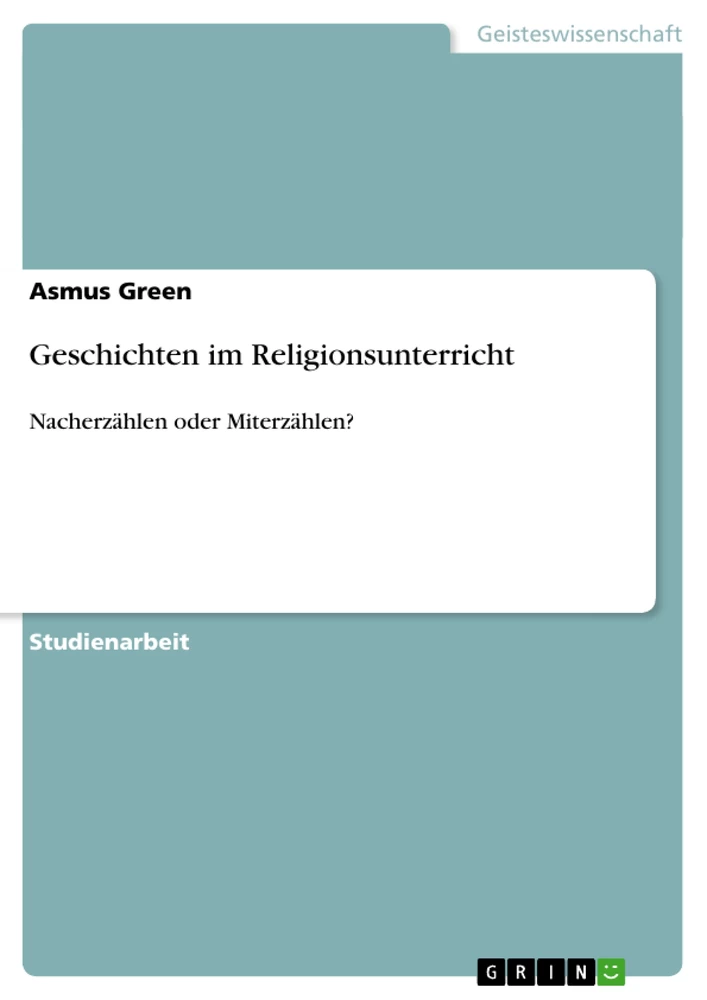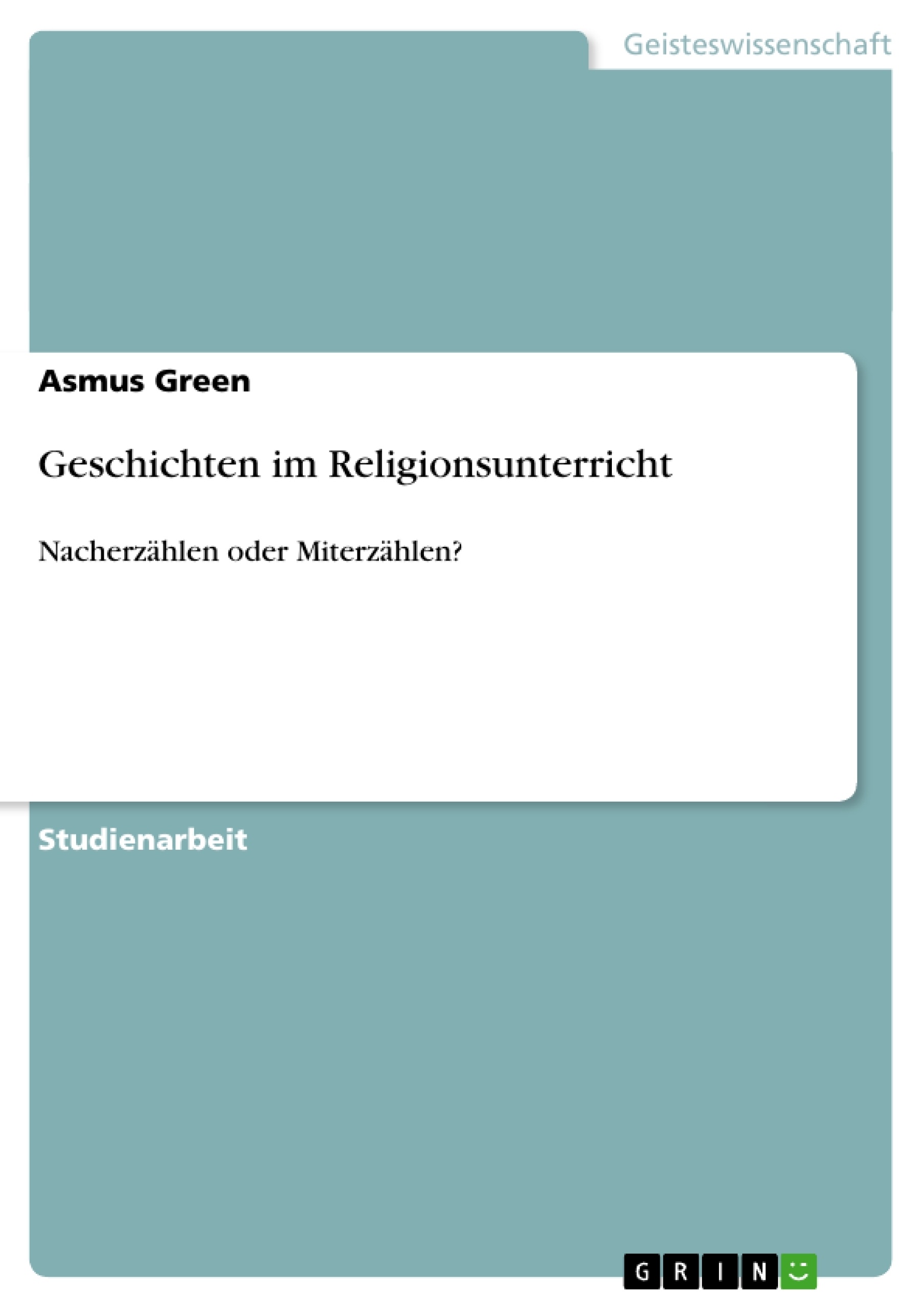Der Religionsunterricht in der Sekundarstufe I soll Orientierungshilfe bei essentiellen Fragen sein:Probleme wie der Ursprung der Dinge, der Sinn des Lebens und der Tod als das Ende des Lebens werden vom evangelischen Religionsunterricht, zusammen mit dem katholischen Religionsunterricht und dem Philosophieunterricht als Unterrichtsthemen wahrgenommen und behandelt. Dabei wird der evangelische Religionsunterricht den im Grundgesetz verankerten Ansprüchen auf freie Persönlichkeitsentfaltung1 (Art. 2,1 GG) und Religionsfreiheit2 (Art. 4,1 GG) insofern gerecht, als dass er sich mit den Grundlagen, Bedingungen und Möglichkeiten menschlicher Existenz in Ansehung von christlich-evangelischen Traditionen beschäftigt, sie aber bewußt nur als möglichen und nicht einzigen Zugang zu den behandelten Problemen versteht. Der evangelische Religionsunterricht sieht sich also als Angebot, sich grundlegenden Fragen des Lebens auf christlich-evangelischen Bahnen zu nähern – als Angebot, das für alle SchülerInnen frei und ohne Verpflichtung, inhaltlich aber klar definiert ist.
Diese dem Lehrplan für die Sekundarstufe 1 entnommene Charakterisierung macht deutlich, dass biblische Texte als Träger christlicher Traditionen als Unterrichtsgegenstand unumgänglich sind.
Der evangelische Zugang zu grundlegenden Lebensfragen und damit die christlich-evangelische Tradition tritt in Form von biblischen Texten vor die SchülerInnen – und vom Verständnis dieser Texte hängt wiederum der Zugang zum Verständnis des Christentums ab.
Bei der Behandlung biblischer Literatur im Religionsunterricht ist die Hinwendung zur Methode der Nacherzählung aus Scheu, in die biblischen Texte einzugreifen und sie zu verändern ein naheliegender Reflex, bedenkt man das Alter der Texte, ihre Entstehungsgeschichte und ihren Status als heilige Schrift.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Methode des Nacherzählens, ihrem Sitz im Schulunterricht und ihrer Eignung für das oben formulierte Ziel des Religionsunterrichts. Grundlage soll ein 1980 von B.Hurrelmann veröffentlichter Aufsatz mit dem Titel „Erzähltextverarbeitung im schulischen Handlungskontext“ sein, dessen Inhalt im Folgenden umrissen wird. Nach kurzer Kritik soll anschließend unter Zuhilfenahme anderer religionspädagogischer&didaktischer Literatur die Methode des Nacherzählens bewertet werden um schließlich einen Ausblick auf methodische Neuorientierung bei der Behandlung biblischer Texte im Religionsunterricht zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. B. Hurrelmann: Erzählen im schulischen Handlungskontext
- 1. Textverarbeitungsoperationen nach Hurrelmann
- 1.1.1 Rekapitulation
- 1.1.2 Evaluation
- 1.1.3 Metanarration
- 1.2 Ergebnis
- 2. Kritik
- III. Neubewertung des Nacherzählens
- IV. Ich-Erzählung oder Er-Erzählung – Erzählperspektiven in theologischer Hinsicht
- V. Konkretisation in Form von verschiedenen Methoden im Unterricht
- 1. Das vorgestaltende Erzählen
- 2. Das umgestaltende Erzählen
- 3. Die erzählte Welt als Spiel-Raum
- 4. Erzählen als komplexe Sprech- und Schreibsituation
- 5. Visuelle Abbildung der erzählten Welt
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Methode des Nacherzählens im Religionsunterricht und ihrer Eignung für die Behandlung biblischer Texte in der Sekundarstufe I. Sie basiert auf dem Aufsatz "Erzähltextverarbeitung im schulischen Handlungskontext" von Bettina Hurrelmann und analysiert die Eignung des Nacherzählens im Lichte der dort beschriebenen Textverarbeitungsoperationen. Zudem werden alternative methodische Ansätze beleuchtet, um eine Neuorientierung in der Behandlung biblischer Texte im Unterricht anzuregen.
- Die Rolle des Nacherzählens im Religionsunterricht
- Textverarbeitungsoperationen nach Hurrelmann
- Kritik am Nacherzählen im schulischen Kontext
- Alternative Methoden zur Behandlung biblischer Texte
- Methodische Neuorientierung im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II analysiert die Textverarbeitungsoperationen nach Hurrelmann, die in drei Kategorien eingeteilt werden: Rekapitulation, Evaluation und Metanarration. Kapitel III beschäftigt sich mit der Kritik am Nacherzählen als Methode im Religionsunterricht und stellt die Herausforderungen und Grenzen dieser Methode in den Vordergrund. Kapitel IV beleuchtet die Bedeutung unterschiedlicher Erzählperspektiven im Kontext biblischer Texte und deren Einfluss auf das Textverständnis. Kapitel V widmet sich der Konkretisierung von verschiedenen Methoden im Unterricht, die alternative Möglichkeiten zur Behandlung biblischer Texte eröffnen.
Schlüsselwörter
Nacherzählen, Textverarbeitung, Religionsunterricht, biblische Texte, Sekundarstufe I, Hurrelmann, methodische Neuorientierung, Erzählperspektiven, Unterrichtsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen biblische Texte im Religionsunterricht?
Biblische Texte sind zentrale Träger christlicher Traditionen. Sie dienen im Unterricht als Grundlage, um existenzielle Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem Ursprung der Dinge und dem Tod zu behandeln.
Was ist die Methode des Nacherzählens im schulischen Kontext?
Das Nacherzählen ist eine Methode der Textverarbeitung, bei der Schüler biblische Geschichten wiedergeben. Die Arbeit untersucht, ob diese Methode aus Scheu vor Textveränderungen gewählt wird und wie effektiv sie ist.
Wer ist B. Hurrelmann und was ist ihr Beitrag zum Thema?
Bettina Hurrelmann veröffentlichte 1980 einen Aufsatz zur Erzähltextverarbeitung, in dem sie Operationen wie Rekapitulation, Evaluation und Metanarration definiert, die als Basis für die Analyse dieser Arbeit dienen.
Welche alternativen Methoden zum Nacherzählen werden vorgeschlagen?
Vorgestellt werden unter anderem das vorgestaltende und umgestaltende Erzählen, die Nutzung der erzählten Welt als Spielraum sowie die visuelle Abbildung der Geschichten.
Wie unterscheidet sich die Ich-Erzählung von der Er-Erzählung?
Die Arbeit analysiert diese Erzählperspektiven unter theologischen Gesichtspunkten und untersucht, wie sie das Verständnis der Schüler für die biblische Botschaft beeinflussen.
- Citar trabajo
- Asmus Green (Autor), 2007, Geschichten im Religionsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74387