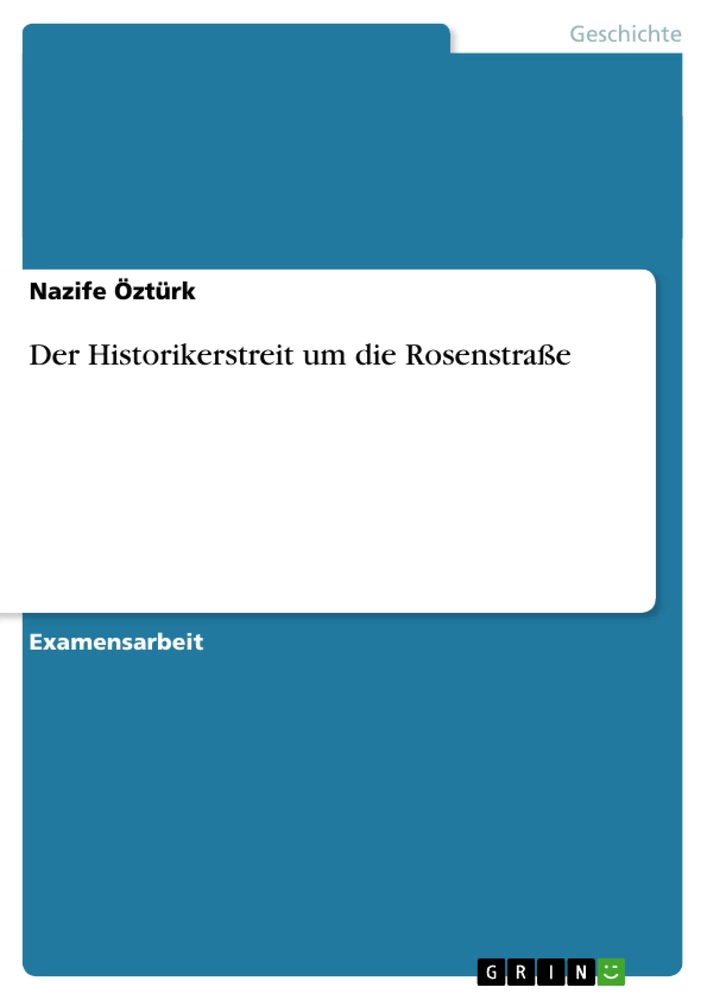Als am Abend des 30. Januar 1933 Anhänger der Nationalsozialisten den lang ersehnten "Tag der Machtübernahme" mit Fackelzügen durch das Brandenburger Tor feierten, waren sich weite Teile der deutschen Bevölkerung des Ausmaßes der kommenden Veränderungen nicht bewusst. Der „Vertrauensvorschuss“1 – so nennt der Historiker Hans Mommsen die Haltung -, welchen die große Masse der Staatsbürger dem Kabinett Hitler einräumte, sollte den Weg freimachen für die Entwicklung einer grausamen Mordmaschinerie. Die strikt antijüdische Politik, die das Regime im selben Jahr noch einschlug und die sich mit der Zeit weiter entfaltete und radikalisierte, traf in erster Linie die Juden selbst, aber auch ihre „arischen“ Verwandten. So kam es, dass in den letzten Tagen des Februars und den ersten Tagen des März 1943 mitten in Berlin „arische“ Verwandte verfolgter Juden sich zu einer einmaligen Protestaktion zusammenfanden. Die „arischen“ - in der Mehrheit Frauen - protestierten tagelang vor dem Jüdischen Gemeindebüro in der Rosenstraße, in dem ihre jüdischen Verwandten festgehalten wurden, und befürchteten eine Deportation. Eben dieser Protest der Frauen und die anschließende unerwartete Freilassung sollte 50 Jahre später die Grundlage für den „Historikerstreit um die Rosenstraße“ bilden.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, ob der Protest der Frauen in der Rosenstraße tatsächlich die Freilassung bewirkt hat oder ob das nationalsozialistische Regime zu diesem Zeitpunkt gar keine Deportation von „jüdisch Versippten“ in Betracht gezogen hatte und sie deshalb wieder freiließ.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Hintergründe der „Fabrik-Aktion“
- 2.1 Zur Situation der Juden unter dem NS-Regime 1935/43
- 2.1.1 Die Jahre 1933/34
- 2.1.2 Die Nürnberger Gesetze 1935
- 2.1.3 Die Novemberpogrome 1938
- 2.1.4 Der Judenstern 1941
- 2.1.5 Der Weg von der Kollektivausweisung zur Deportation
- 2.1.6 Zur Lage zwischen 1942/43
- 2.2 Die „Mischehe“ – Eine Terminologie der Nationalsozialisten?
- 2.2.1 „Privilegierte“ und „nicht-privilegierte“ Mischehen
- 2.2.2 „Mischlinge 1. und 2. Grades“, „Geltungsjuden“ und „Volljuden“
- 2.2.3 Maßnahmen zur Behandlung von „Mischehen“
- 2.2.4 Die Situation der „arischen“ Frauen in „Mischehen“
- 2.2.5 Ehen zwischen Trennung, Zwangsscheidung und Standhaftigkeit
- 3. Der Historikerstreit um die Rosenstraße
- 3.1 Der Ablauf der „Fabrikaktion“ und des Protests
- 3.1.1 „Judenfrei“ - Die „Fabrik-Aktion“ vom 27. Februar 1943
- 3.1.2 Die Situation in den Sammellagern
- 3.1.2.1 Sortierung im Sammellager
- 3.1.2.2 Der erste Schritt in die Freiheit?
- 3.1.3 Flucht und Widerstand während der „Fabrik-Aktion“
- 3.1.4 Juden aus „Mischehen“ und die Internierung in der Rosenstraße
- 3.1.4.1 Die Anzahl der Verhafteten- Ein mögliches Indiz?
- 3.1.4.2 Unstimmigkeiten über die Lagerung
- 3.1.5 Hintergrundinformation zum Protest der „arischen“ Verwandten
- 3.1.5.1 Der Protest
- 3.1.5.2 Die widersprüchlichen Zeitzeugenaussagen
- 3.1.6 Die Freilassung
- 3.2 „Erfolg des Protests“ oder „nationalsozialistisches Kalkül“?
- 3.2.1 Öffentliche Erinnerungen und ihr Einfluss auf die Zeitzeugen
- 3.2.1.1 „Der Aufstand der Frauen“ – Ein Bericht von Georg Zivier
- 3.2.1.2 Tagebuchaufzeichnungen der Ruth Andreas-Friedrich
- 3.2.1.3 Die Fortsetzung des „Mythos“ – Der Film „Rosenstraße“
- 3.2.1.3.1 Authentizitätsansprüche
- 3.2.1.3.2 Die historische Botschaft- Widerstand war möglich!
- 3.2.2 Historische Relevanz von Zeitzeugenaussagen
- 3.2.3 Die „Oral History“
- 3.2.3.1 „Oral History“ vs. wissenschaftliche Forschung
- 3.2.3.2 Zur Subjektivität von Zeitzeugenaussagen
- 3.2.3.3 Zur Unzuverlässigkeit von Zeitzeugenaussagen
- 3.2.4 Subjektivität von Zeitzeugenaussagen am Beispiel der Rosenstraße
- 3.2.5 Zeitzeugenaussagen im Zusammenhang mit historischen Quellen
- 3.3 Rekonstruktion der Ereignisse mittels historischer Faktenlage
- 3.3.1 Dokumente offenbaren: Deportation war nicht beabsichtigt
- 3.3.2 Die Auschwitz-Rückkehrer-Ein Indiz für den Erfolg des Protestes?
- 3.3.3 Die Aussagekraft der Tagebucheinträge von Joseph Goebbels
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den „Historikerstreit um die Rosenstraße“, der sich um die Frage dreht, ob der Protest „arisches“ Frauen in der Rosenstraße 1943 zur Freilassung von Juden aus „Mischehen“ führte oder ob die Deportation dieser Personen zu diesem Zeitpunkt vom NS-Regime gar nicht geplant war. Die Arbeit untersucht den historischen Hintergrund der „Fabrik-Aktion“ und die Situation der Juden unter dem NS-Regime, insbesondere die Problematik der „Mischehen“.
- Die Judenpolitik des NS-Regimes in den Jahren 1933 bis 1943.
- Die Situation der „Mischehen“ unter dem NS-Regime.
- Der Protest der „arischen“ Verwandten in der Rosenstraße.
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Historikerstreits.
- Die Rekonstruktion der Ereignisse anhand von historischen Fakten und Quellen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Hintergrund der „Fabrik-Aktion“ und die Frage, ob der Protest in der Rosenstraße tatsächlich zur Freilassung der Juden aus „Mischehen“ führte. Das zweite Kapitel untersucht die Situation der Juden unter dem NS-Regime in den Jahren 1933 bis 1943, mit besonderem Augenmerk auf die „Mischehen“. Hierbei werden die verschiedenen antisemitischen Maßnahmen des Regimes und ihre Auswirkungen auf die jüdische Bevölkerung dargestellt. Das dritte Kapitel widmet sich dem „Historikerstreit um die Rosenstraße“. Es analysiert den Ablauf der „Fabrik-Aktion“, den Protest der „arischen“ Verwandten und die unterschiedlichen Positionen der Historiker zum Ereignis.
Schlüsselwörter
Der Historikerstreit, Rosenstraße, Fabrik-Aktion, NS-Regime, Judenpolitik, Mischehen, Protest, Zeitzeugenaussagen, „Oral History“, Deportation, historische Faktenlage, Quellenrecherche.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Protest in der Rosenstraße 1943?
In der Rosenstraße protestierten tagelang „arische“ Ehefrauen gegen die Verhaftung und drohende Deportation ihrer jüdischen Ehemänner während der sogenannten „Fabrik-Aktion“.
Worüber streiten Historiker im Fall der Rosenstraße?
Der Streit dreht sich darum, ob die Freilassung der Inhaftierten ein direkter Erfolg des Protests war oder ob das NS-Regime die Deportation von Juden aus „Mischehen“ ohnehin nicht geplant hatte.
Was ist der Unterschied zwischen privilegierten und nicht-privilegierten Mischehen?
Dies waren Kategorien der Nationalsozialisten, um den Grad der rechtlichen Diskriminierung und den Schutzstatus von jüdischen Partnern in Ehen mit Nichtjuden festzulegen.
Welche Rolle spielt die „Oral History“ in diesem Historikerstreit?
Zeitzeugenaussagen stützen oft die These des erfolgreichen Widerstands, während wissenschaftliche Analysen von Dokumenten (z.B. Goebbels-Tagebücher) auf taktische Entscheidungen des Regimes hindeuten.
Was war die „Fabrik-Aktion“?
Die „Fabrik-Aktion“ Ende Februar 1943 war eine großangelegte Razzia der SS und Gestapo, um die letzten in Berliner Rüstungsbetrieben arbeitenden Juden zu verhaften und zu deportieren.
- Citar trabajo
- Nazife Öztürk (Autor), 2007, Der Historikerstreit um die Rosenstraße, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74422