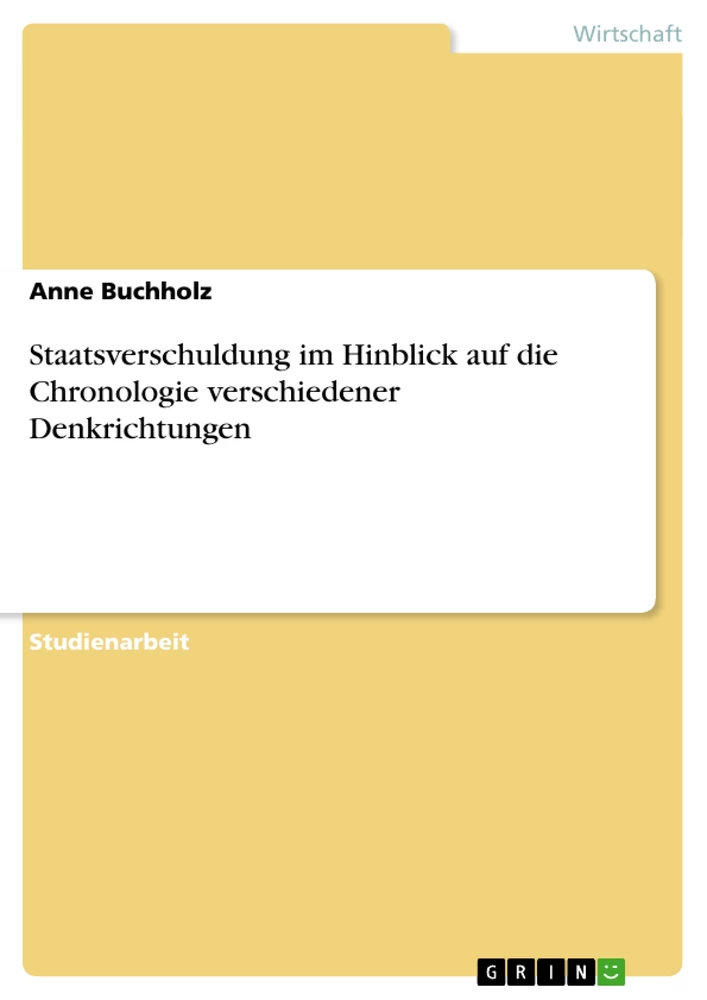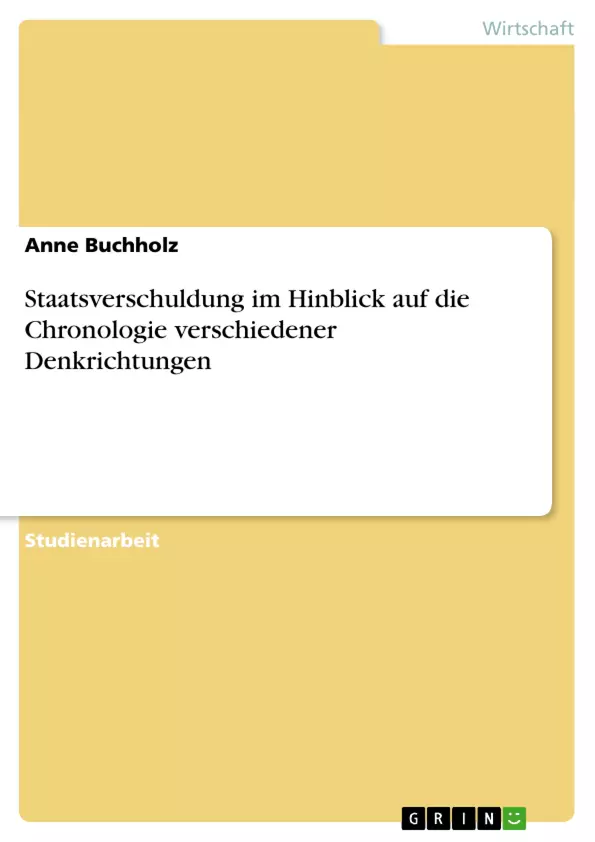In den letzen Jahrzehnten nahm die Kreditaufnahme des Staates weltweit schneller zu als die gesamtwirtschaftliche Produktion. Mit steigenden Schulden und Zinsen kämpfen nicht nur überschuldete Entwicklungsländer, sondern zunehmend auch viele hochindustrialisierte Länder. Eines der betroffenen Länder ist Deutschland. Dabei ist, anders als in früheren geschichtlichen Epochen, die nach dem Zweiten Weltkrieg verursachte Staatsverschuldung weder Krisen noch großer staatlicher Investitionen zuzuschreiben.
Mittlerweile nimmt die Skepsis der Bundesbürger gegenüber dem Instrument der Kreditfinanzierung staatlicher Ausgaben stetig zu. „Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.“ Kürzer und knapper kann das Interesse des Steuerzahlers an einer Begrenzung der Staatsverschuldung nicht ausgedrückt werden. Daraus folgt, dass die künftigen Generationen die Verantwortung der heute verursachten Staatsdefizite tragen. Zu dieser Gefahr kommen jedoch noch weitere Gefahren auf den Steuerzahler zu. Durch die Staatsverschuldung bedingte Geldentwertung wird eine inflationäre Aushöhlung und Überbesteuerung der Zinserträge verursacht. Außerdem werden das Wachstum und die Beschäftigung durch den zunehmend wachsenden Teil der Staatseinnahmen für den Schuldendienst gedrosselt.
Langsam treten die Folgen der Staatsverschuldung ein und verursachen eine gewisse Unruhe unter den deutschen Bundesbürgern. Zum einen wegen der Kriterien des Maastrichter Vertrages und zum anderen wegen der staatlichen Bemühungen in der Vergangenheit, die nicht die gewünschten Effekte erzielten. Selbst wenn im Jahr 2006 eine niedrigere Neuverschuldung anfiel als prognostiziert war, ist Deutschland weit entfernt von einem ausgeglichenen öffentlichen Gesamthaushalt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel und Aufbau
- Grundlagen zur Betrachtung der Staatsverschuldung
- Zahlen und Fakten
- Historische Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland
- Maastrichter Vertrag & Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Denkrichtungen zur Staatsverschuldung
- Keynesianismus
- Monetarismus
- Ordnungspolitische Folgen wachsender Staatsverschuldung
- Schlussbetrachtung
- Grenzen der Staatsverschuldung
- Fazit und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Staatsverschuldung in Deutschland unter Berücksichtigung verschiedener wirtschaftspolitischer Denkrichtungen. Ziel ist die chronologische Betrachtung des Keynesianismus und des Monetarismus im Kontext der deutschen Staatsverschuldung sowie die Darstellung der ordnungspolitischen Folgen. Der begrenzte Umfang erlaubt nur eine Auswahl an Aspekten der vergangenen Jahrzehnte.
- Historische Entwicklung der deutschen Staatsverschuldung
- Keynesianische und monetaristische Ansätze zur Behandlung von Staatsverschuldung
- Ordnungspolitische Auswirkungen steigender Staatsverschuldung
- Der Maastrichter Vertrag und der Stabilitäts- und Wachstumspakt im Kontext der Staatsverschuldung
- Grenzen der Staatsverschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der steigenden Staatsverschuldung in Deutschland und weltweit ein. Sie beschreibt die wachsende Skepsis der Bevölkerung gegenüber staatlicher Kreditaufnahme und deren Folgen wie Inflation und negative Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas im Kontext des Maastrichter Vertrages und der anhaltenden Defizite trotz Bemühungen um einen ausgeglichenen Haushalt. Sie gibt einen kurzen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Grundlagen zur Betrachtung der Staatsverschuldung: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es Zahlen und Fakten zur Staatsverschuldung präsentiert und deren historische Entwicklung in Deutschland beleuchtet. Es erläutert den gesetzlichen Rahmen der Staatsverschuldung, den Maastrichter Vertrag und den Stabilitäts- und Wachstumspakt, und verdeutlicht deren Bedeutung für die aktuelle Situation.
Denkrichtungen zur Staatsverschuldung: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftspolitischen Denkrichtungen des Keynesianismus und des Monetarismus im Zusammenhang mit der Staatsverschuldung. Es untersucht, wie beide Schulen die Staatsverschuldung betrachten und welche Lösungsansätze sie vorschlagen. Zusätzlich werden die ordnungspolitischen Folgen einer wachsenden Staatsverschuldung detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Deutschland, Keynesianismus, Monetarismus, Ordnungspolitik, Maastrichter Vertrag, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Wirtschaftspolitik, historische Entwicklung, Geldentwertung, Wachstum, Beschäftigung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Staatsverschuldung in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Staatsverschuldung in Deutschland, insbesondere deren historische Entwicklung, die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Denkrichtungen (Keynesianismus und Monetarismus) im Umgang damit und die ordnungspolitischen Folgen steigender Schulden. Der Maastrichter Vertrag und der Stabilitäts- und Wachstumspakt spielen dabei eine wichtige Rolle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der deutschen Staatsverschuldung, keynesianische und monetaristische Ansätze zur Bewältigung von Staatsverschuldung, die ordnungspolitischen Auswirkungen steigender Staatsverschuldung, den Maastrichter Vertrag und den Stabilitäts- und Wachstumspakt im Kontext der Staatsverschuldung sowie die Grenzen der Staatsverschuldung.
Welche Denkrichtungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die keynesianische und die monetaristische Denkrichtung im Hinblick auf ihre Ansätze zur Behandlung von Staatsverschuldung. Es wird untersucht, wie beide Schulen die Staatsverschuldung bewerten und welche Lösungsansätze sie vorschlagen.
Welche Rolle spielen der Maastrichter Vertrag und der Stabilitäts- und Wachstumspakt?
Der Maastrichter Vertrag und der Stabilitäts- und Wachstumspakt bilden einen wichtigen rechtlichen und politischen Rahmen für die Betrachtung der deutschen Staatsverschuldung. Die Arbeit beleuchtet deren Bedeutung für die aktuelle Situation und die Bemühungen um einen ausgeglichenen Haushalt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht die Grenzen der Staatsverschuldung und bietet eine kritische Würdigung der verschiedenen Ansätze. Ein explizites Fazit wird in der Schlussbetrachtung gezogen, wobei der begrenzte Umfang der Arbeit zu berücksichtigen ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen der Staatsverschuldung (Zahlen, Daten, historische Entwicklung, Maastrichter Vertrag, Stabilitäts- und Wachstumspakt), ein Kapitel zu den Denkrichtungen (Keynesianismus und Monetarismus) und deren Folgen, sowie eine Schlussbetrachtung mit Fazit und kritische Würdigung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Staatsverschuldung, Deutschland, Keynesianismus, Monetarismus, Ordnungspolitik, Maastrichter Vertrag, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Wirtschaftspolitik, historische Entwicklung, Geldentwertung, Wachstum, Beschäftigung.
- Arbeit zitieren
- Anne Buchholz (Autor:in), 2007, Staatsverschuldung im Hinblick auf die Chronologie verschiedener Denkrichtungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74578