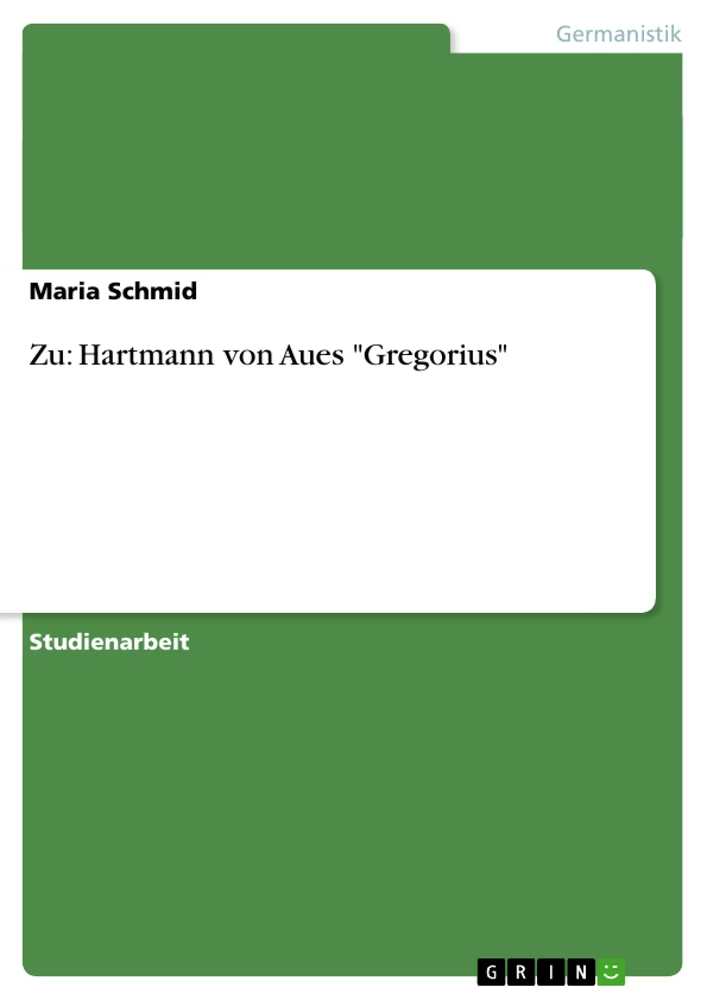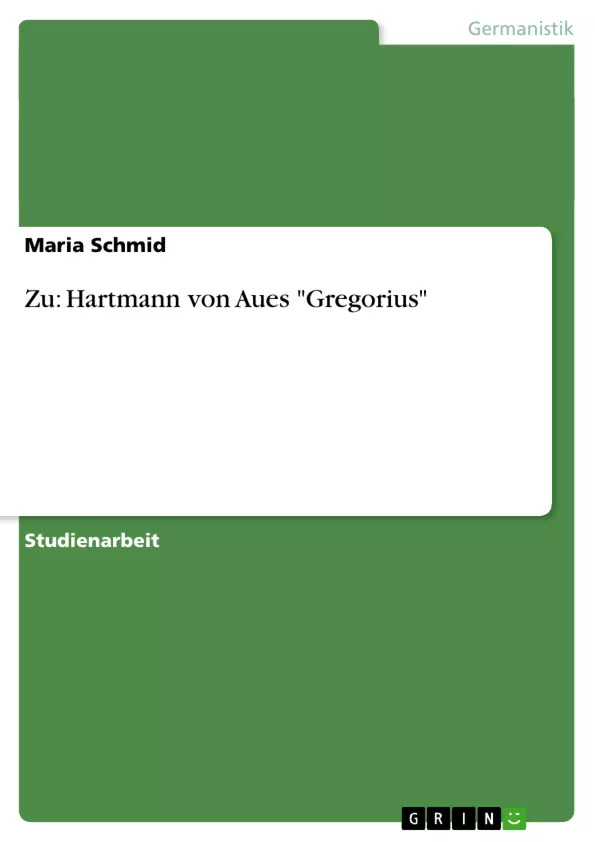Religion treibt die Entzweiung des Menschen mit sich voran. Feuerbach fordert den progressiven Rückschritt, die Überwindung der Religion und damit die Überwindung der Entzweiung des Menschen. Marx lehnt sich an Feuerbach an, geht aber über ihn hinaus. Er glaubt, dass die anthropologische Reduktion, das heißt die Rücknahme der Projektion auf Gott, zu einer Enttäuschung führen würde, da sich das Diesseits des Menschen nicht verändert hat. Dieses Diesseits fordert in seinem Zustand die Schaffung eines Jenseits, die Schaffung Gottes. Marx glaubt an die Lösung des Problems durch die Revolution, die Aufhebung der Klassengesellschaft. Er fordert also die Schaffung eines neuen Diesseits, in dem keine Projektion mehr notwendig ist. Sartre, der behauptete, die Existenz des Menschen gehe der Essenz, dem was der Mensch werden soll, voraus, bildet wohl den auffallendsten Gegenpol zur kirchlichen Lehre, die den „Gregorius“ prägt.
Dies alles erwähne ich, um der Gottesfrage, beziehungsweise der Gnade Gottes, die im Werk Hartmanns eine zentrale Rolle spielt, nicht mit blindem Religionseifer zu begegnen. Des weiteren, um auf die Frage nach der Freiheit des Menschen, die, meiner Meinung nach, bereits im Gregorius- Prolog zu beschränkt dargestellt wird, das Augenmerk zu legen.
In diesem Einstieg lag mir daran, die Aktualität des Gregorius- Motivs darzulegen und auf die mir am wichtigsten erscheinen Fragen, die der Stoff aufwirft, einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Aktualität des „Gregorius“ - Stoffes
- 2. Die Entstehungsgeschichte des „Gregorius“
- 2.1. Die Geschichte vom guten Sünder
- 2.2. Die Kontaktaufnahme mit dem Publikum...
- 2.3 Der freie Wille des Menschen
- 2.4. Das Verständnis der Sünde zur Zeit Hartmanns
- 2.5. Die Sünde, der Zweifel und die göttliche Gnade..
- 2.6 Das Zwei - Wege - Motiv
- 2.7. Das Samariter - Gleichnis..
- 2.8 Vertrauen und Zweifel
- 2.9 Die Lehre für das Publikum
- 3. Der Prolog - ein Aufruf zum Kreuzzug?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Aktualität des „Gregorius“-Stoffes und analysiert den Prolog des Werks von Hartmann von Aue. Dabei werden die Entstehung des Stoffes und seine Rezeption in anderen literarischen Werken beleuchtet.
- Die Bedeutung der Schuld und die Frage nach ihrer Sühne
- Die Rolle der göttlichen Gnade und der Einfluss des Menschen auf diese
- Der Einfluss der Gesellschaft und der persönlichen Lebensumstände auf das menschliche Handeln
- Die Freiheit des Menschen im Kontext des Glaubens
- Die Relevanz der Gottesfrage im Zusammenhang mit Schuld und Vergebung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Aktualität des „Gregorius“-Stoffes und stellt die Frage nach der Zeitlosigkeit dieses Themas. Es beleuchtet die Bedeutung der Schuld und die Frage nach deren Sühne, wobei der Fokus auf den Einfluss der Gesellschaft und des Einzelnen liegt. Die Kapitel 2.1 bis 2.9 befassen sich mit der Entstehungsgeschichte des „Gregorius“-Stoffes und der Rezeption des Themas in anderen literarischen Werken. Dabei werden Themen wie der freie Wille des Menschen, das Verständnis der Sünde und die Bedeutung der göttlichen Gnade behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Schuld, Gnade, freier Wille, Gottesfrage, Gesellschaft, Lebensumstände, Rezeption und die Bedeutung des „Gregorius“-Stoffes in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hartmann von Aues „Gregorius“?
Das Werk behandelt die Geschichte eines „guten Sünders“, der trotz schwerer Schuld (Inzest) durch extreme Buße und göttliche Gnade schließlich zum Papst aufsteigt.
Welche Rolle spielt die göttliche Gnade im Werk?
Die Gnade Gottes ist zentral; sie zeigt, dass selbst die schwerste Sünde vergeben werden kann, wenn der Mensch aufrichtig bereut und sein Vertrauen auf Gott setzt.
Wie wird das Thema „freier Wille“ im Gregorius thematisiert?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der Mensch frei in seinen Entscheidungen ist oder ob sein Schicksal und seine Sündhaftigkeit vorbestimmt sind.
Was ist das Samariter-Gleichnis im Kontext des Werkes?
Das biblische Gleichnis dient als theologischer Bezugspunkt für die Themen Heilung, Sündenvergebung und die Zuwendung Gottes zum gefallenen Menschen.
Warum ist der „Gregorius“-Stoff heute noch aktuell?
Fragen nach Schuld, Sühne, gesellschaftlicher Ausgrenzung und der Möglichkeit eines Neuanfangs nach einem moralischen Scheitern sind zeitlose menschliche Themen.
- Citation du texte
- Maria Schmid (Auteur), 2004, Zu: Hartmann von Aues "Gregorius", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74641