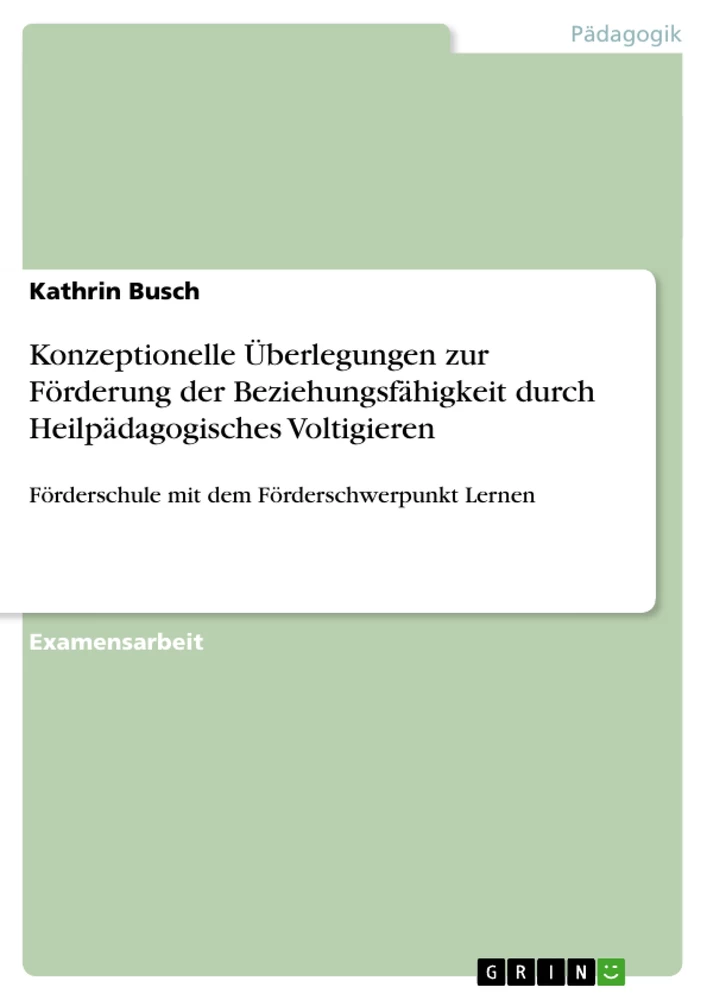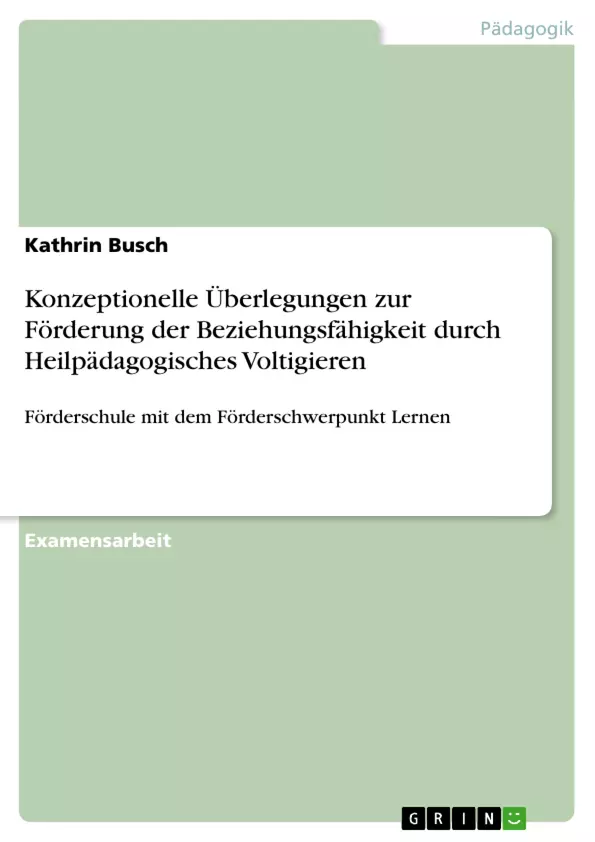Bei der Betrachtung der komplexen Entwicklungschancen, die sich aus der Arbeit mit dem Pferd mit lernbehinderten Kindern ergeben, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass gerade die Auslagerung der Fördersituation mit dem Pferd aus dem normalen Schulalltag erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Gerade bei lernbehinderten Kindern ist der Schulalltag oft von Misserfolgen geprägt.
Julia, das Mädchen, um das es in der vorliegenden Arbeit gehen soll, lernte ich als ein Mädchen kennen, das sich sehr in sich selbst zurückzog, kaum Emotionen zeigte und weder Kontakt noch Beziehungen zu Lehrerinnen und Mitschülern aufnahm.
Auch Julia nahm am heilpädagogischen Voltigieren teil und bei ihr machte ich während der Arbeit an und mit dem Pferd die Beobachtung, dass sie zum ersten Mal spontan lächelte, sodass ich den Eindruck bekam, dass ihr die Arbeit mit dem Pferd Spaß bereitete.
Daraus ergab sich für mich die Frage, wie Julias Fähigkeit zur Anbahnung und Aufnahme von Beziehungen durch das Heilpädagogische Voltigieren gefördert werden kann.
Mit der vorliegenden Arbeit wird versucht, eben diese Frage zu beantworten.
Im I. Teil wird die Schülerin Julia vorgestellt, wobei diese Beobachtungen und Informationen die Grundlage für die im III. Teil der Arbeit angestellten konzeptionellen Überlegungen darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- I. Teil: Falldarstellung
- 2. Familiensituation und bisherige Schullaufbahn
- 2.1 Familiensituation und bisherige Schullaufbahn
- 2.2 Entwicklung an der Don-Bosco-Schule im Klassenverband
- 2.3 Beobachtungen bei Julia in der heilpädagogischen Voltigiergruppe
- II. Teil: Theoretische Grundlagen der Konzeptentwicklung
- 3. Grundlagen des Heilpädagogischen Voltigierens
- 3.1 Was ist Heilpädagogisches Voltigieren?
- 3.1.1 Begriffsklärung
- 3.1.2 Das Pädagogische Dreieck: Situationsmerkmale des Heilpädagogischen Voltigierens
- 3.1.3 Besondere Wesensmerkmale des Pferdes als pädagogischer Helfer
- 3.1.4 Die Grundgangarten des Pferdes und ihre psychische Wirkung auf den Reiter
- 3.2 Organisatorischer Rahmen des HPV an der Schule
- 3.2.1 Äußerer Rahmen
- 3.2.2 Innere Durchführung
- 4. Entwicklungspsychologische Annahmen zur Entwicklung von Beziehungen
- 4.1 Die Theorie Erik H. Eriksons
- 4.2 Die Theorie Margaret S. Mahlers
- 5. Möglichkeiten der Förderung von Beziehungen im Heilpädagogischen Voltigieren
- 5.1 Fazit
- III. Teil: Konzeptionelle Überlegungen zu den Fördermöglichkeiten
- 6. Grundsätzliche Überlegungen
- 6.1 Rahmenbedingungen
- 6.2 Grundsätzliche methodische Überlegungen
- 6.3 Zur Auswahl des geeigneten Pferdes
- 7. Der Aufbau der heilpädagogischen Voltigiermaßnahme für Julia
- 7.1 Arbeit mit dem Pferd „vom Boden aus”
- Das Putzen
- Aufwärmspiele mit dem Pferd
- Variationsmöglichkeiten und daraus resultierende Förderanreize für Julia
- Raster zum Aufwärmspiel
- 7.2 Arbeit auf dem Pferd
- Zum Aufbau der Übungsrunde
- Übungen im Schritt
- Übungen im Trab
- Übungen im Galopp
- 7.3 Partnerübungen auf dem Pferd
- Zum Aufbau der Partnerrunde
- Kommunikation zwischen den Partnern ist nicht unbedingt erforderlich.
- Kommunikation zwischen den Partnern ist unbedingt erforderlich
- 7.4 Die Nachpflege des Pferdes
- 7.5 Fazit
- IV. Teil: Evaluation
- 8. Evaluationsmöglichkeit
- 8.1 Zum Einsatz des Beobachtungsbogens
- 8.1.1 Wer füllt den Bogen aus?
- 8.2 Der Beobachtungsbogen
- 9. Möglichkeiten und Grenzen des Konzeptansatzes
- 10. Übertragbarkeit des Konzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Förderung der Beziehungsfähigkeit von Kindern mit Lernschwierigkeiten durch Heilpädagogisches Voltigieren. Ziel ist es, ein Konzept zu entwickeln, das die Stärkung sozialer Kompetenzen und die Entwicklung positiver Beziehungen im Rahmen von Voltigierstunden fördert. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Pferdes als pädagogischer Helfer, die Bedeutung des Heilpädagogischen Voltigierens für die Persönlichkeitsentwicklung und die Herausforderungen bei der Integration lernbehinderter Kinder in die Gesellschaft.
- Entwicklung und Förderung von Beziehungsfähigkeit bei Kindern mit Lernschwierigkeiten
- Heilpädagogisches Voltigieren als pädagogisches Instrument zur Förderung sozialer Kompetenzen
- Die Rolle des Pferdes als pädagogischer Helfer und die besonderen Eigenschaften des Heilpädagogischen Voltigierens
- Entwicklungspsychologische Grundlagen der Beziehungsgestaltung
- Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung einer heilpädagogischen Voltigiermaßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Förderung der Beziehungsfähigkeit von Kindern mit Lernschwierigkeiten durch Heilpädagogisches Voltigieren. Der erste Teil der Arbeit beschreibt die familiäre Situation und die bisherige Schullaufbahn von Julia, dem Mädchen, das im Fokus der Arbeit steht. Es werden Beobachtungen aus dem Schulalltag und der Voltigiergruppe vorgestellt, die die Herausforderungen in Bezug auf Julias soziale Interaktion deutlich machen.
Der zweite Teil der Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Heilpädagogischen Voltigierens und geht auf die Rolle des Pferdes als pädagogischer Helfer ein. Weiterhin werden Entwicklungspsychologische Theorien zur Entstehung von Beziehungen und deren Bedeutung für die Entwicklung des Kindes erläutert. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der konzeptionellen Entwicklung einer heilpädagogischen Voltigiermaßnahme, die sich an den individuellen Bedürfnissen von Julia orientiert. Die Arbeit stellt verschiedene Übungen und Aktivitäten vor, die sich auf die Förderung der Beziehungsfähigkeit und die Stärkung sozialer Kompetenzen konzentrieren.
Schlüsselwörter
Heilpädagogisches Voltigieren, Beziehungsfähigkeit, Lernbehindertenpädagogik, Sozialkompetenz, pädagogischer Helfer, Pferd, Entwicklungspsychologie, Konzeptentwicklung, Evaluationsmöglichkeit, Inklusion, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Heilpädagogisches Voltigieren (HPV)?
HPV ist eine pädagogische Maßnahme, bei der das Pferd als Medium eingesetzt wird, um die persönliche und soziale Entwicklung von Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zu fördern.
Wie kann das Voltigieren die Beziehungsfähigkeit fördern?
Durch den direkten Kontakt zum Pferd, das wertfrei reagiert, und die Zusammenarbeit in der Gruppe lernen Kinder, Vertrauen aufzubauen, Emotionen zu zeigen und soziale Interaktionen einzugehen.
Warum eignet sich das Pferd besonders als „pädagogischer Helfer“?
Das Pferd spricht alle Sinne an, fordert zur Pflege und Verantwortung auf und bietet durch seine Bewegungen (Schritt, Trab, Galopp) spezifische psychische und physische Reize.
Welche psychologischen Theorien liegen der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit stützt sich auf entwicklungspsychologische Annahmen von Erik H. Erikson und Margaret S. Mahler zur Entwicklung von Beziehungen und Identität.
Wie sieht eine typische HPV-Einheit zur Beziehungsförderung aus?
Sie umfasst die Arbeit am Boden (Putzen, Aufwärmspiele), Übungen auf dem Pferderücken sowie Partnerübungen, die Kommunikation und Kooperation erfordern.
Wie wird der Erfolg der heilpädagogischen Maßnahme überprüft?
Zur Evaluation wird ein spezieller Beobachtungsbogen eingesetzt, der Veränderungen im Verhalten und in der Beziehungsfähigkeit des Kindes dokumentiert.
- Citation du texte
- Kathrin Busch (Auteur), 2004, Konzeptionelle Überlegungen zur Förderung der Beziehungsfähigkeit durch Heilpädagogisches Voltigieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74742