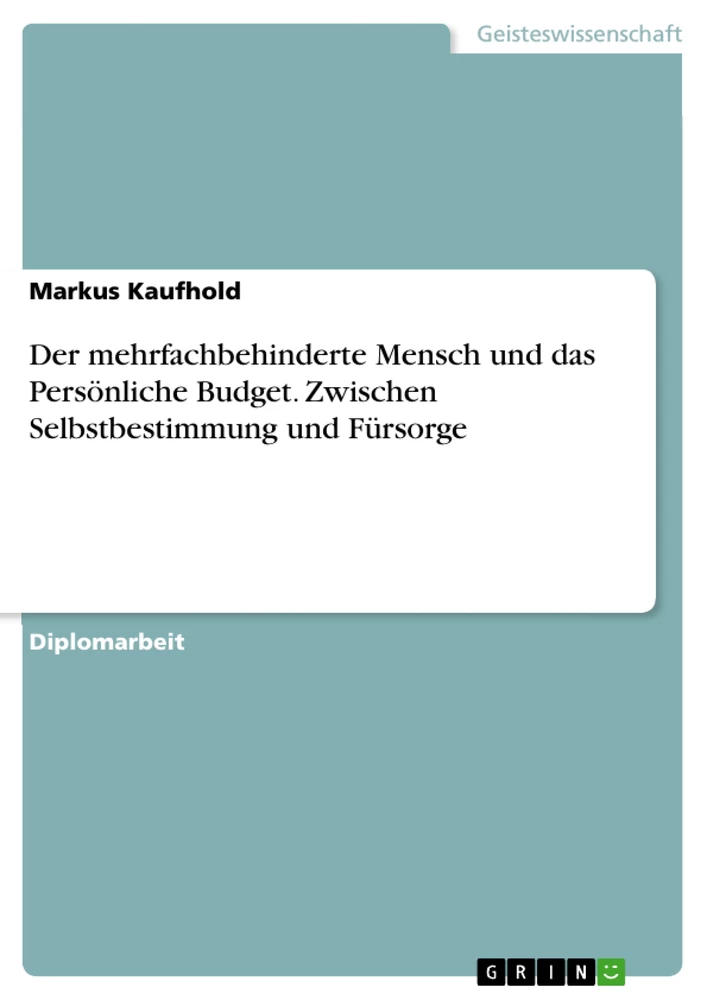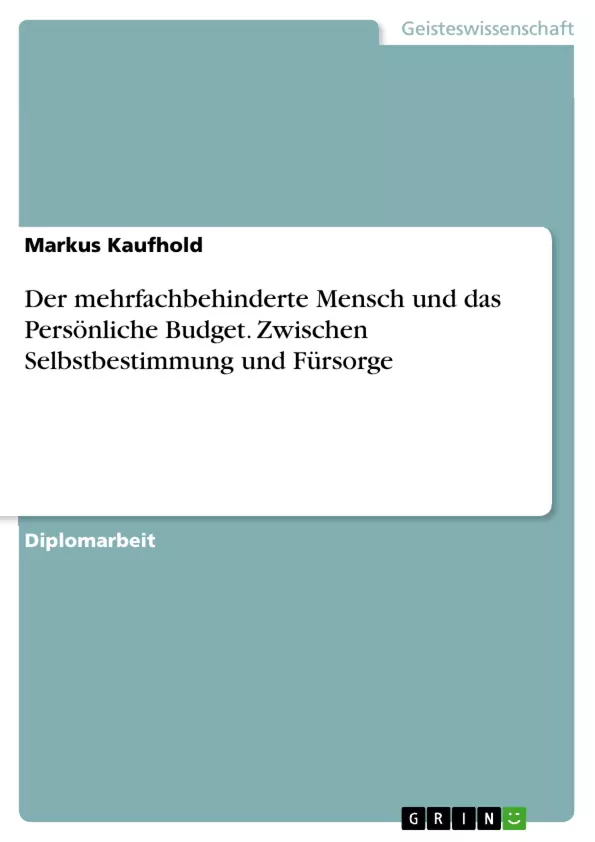Das Ziel dieser Diplomarbeit besteht darin, zu untersuchen, inwieweit das Persönliche Budget für Menschen mit Mehrfachbehinderung nutzbar ist.
Dieser Frage soll mit Hilfe zweier verschiedener Schwerpunkte nachgegangen werden. Im ersten Schwerpunkt sollen bereits bestehende Modellprojekte zum Persönlichen Budget auf ihre Umsetzung und ihrer Nutzbarkeit für Menschen mit mehrfacher Behinderung untersucht werden, sowie die Umsetzung in drei Nachbarländern.
In einem zweiten Schwerpunkt sollen Fachleute nach ihrer Meinung zum Persönlichen Budget und dem Aspekt der Nutzungsmöglichkeiten für diese Menschen mittels qualitativer Experteninterviews befragt werden. Die dabei entstehenden Ergebnisse werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING ausgewertet.
Nach einer ausführlichen Einordnung der Begrifflichkeiten (Kapitel 2) beschäftigt sich Kapitel 3 zunächst mit den Grundlagen des Persönlichen Budgets, einerseits um dem Leser einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen und andererseits, um zu untersuchen, wie das Persönliche Budget gesetzlich bestimmt und die Nutzungsmöglichkeiten durch Menschen mit Behinderung geregelt werden.
Im 4. Kapitel werden ausgewählte Modellprojekte auf ihre Umsetzung und auf den Aspekt der Nutzungsmöglichkeit für mehrfach behinderte Menschen untersucht. Da seit Jahren in benachbarten Ländern bereits ähnliche Formen des Persönlichen Budgets eingeführt und erfolgreich umgesetzt wurden, werden auch diese nach den gleichen Gesichtspunkten hinterfragt. Dies erscheint sinnvoll, da in Deutschland bislang nur begrenzt Erfahrungen in der Umsetzung mit dem Persönlichen Budget gesammelt werden konnten. Durch eine Betrachtung dieser Länder ergibt sich zugleich die Möglichkeit (Kapitel 5) den Stand der Umsetzung deutscher Modelle miteinander zu vergleichen.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit einer empirischen Untersuchung, indem Fachleute zum Persönlichen Budget anhand ausgewählter Forschungsfragen zum Thema interviewt werden. Die Auswertung und Interpretation erfolgt nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING.
Das Resümee fasst die Ergebnisse der vorliegenden Diplomarbeit zusammen.
Mit Handlungsvorschlägen für die soziale Arbeit und einem Ausblick wird das Thema abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Einordnen der Begrifflichkeiten
- 2.1 Das Persönliche Budget
- 2.2 Behinderung
- 2.3 Behinderungsarten
- 2.3.1 Der Begriff der Körperbehinderung
- 2.3.2 Der Begriff der geistigen Behinderung
- 2.3.3 Der Begriff der seelischen Behinderung
- 2.4 Mehrfachbehinderung/ Schwerstbehinderung/ Schwerstmehrfachbehinderung/ Versuch einer Begriffsklärung
- 2.5 Selbstbestimmung
- 2.6 Rehabilitation
- 3. Grundlagen - Eckpunkte/Darstellung des Persönlichen Budgets
- 3.1 Ziel des Persönlichen Budgets
- 3.2 Konzeptionelle Grundlagen
- 3.3 Sozialrechtliche Grundlagen
- 3.3.1 Geldleistung und Persönliches Budget nach SGB IX
- 3.3.2 Persönliches Budget als Komplexleistung
- 3.3.3 Budgetfähige Leistungen
- 3.3.4 Budgetbemessung
- 3.3.5 Koordination
- 3.3.6 Budgetverordnung (Budget)
- 3.3.7 Erprobung
- 4. Umsetzung des Persönlichen Budgets
- 4.1 Europäische Modelle - Das Persönliche Budget in Europa
- 4.1.1 Niederlande
- 4.1.2 England
- 4.1.3 Schweden
- 4.2 Zusammenfassung der europäischen Modelle
- 4.3 Nationale Modelle - Das Persönliche Budget in Deutschland
- 4.3.1 Modell Baden-Württemberg
- 4.3.2 Modell Niedersachsen
- 4.3.3 Modell Rheinland-Pfalz - Perle (Personenbezogene Unterstützung und Lebensqualität)
- 4.4 Zusammenfassung der deutschen Modelle
- 5. Vergleich europäischer und deutscher Modelle
- 6. Empirischer Teil
- 6.1 Methode und Gang der Untersuchung
- 6.2 Planung und Durchführung der Datenerhebung
- 6.3 Zusammenfassung der einzelnen Interviews
- 6.4 Ablaufmodell der Inhaltsanalyse nach MAYRING
- 6.4.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 6.4.2 Richtung der Analyse
- 6.4.3 Theoriegeleitete Fragestellung
- 6.4.4 Festlegung der Analyseeinheiten und -schritte
- 6.5 Ergebnisse aus dem Datenmaterial
- 6.5.1 Kategoriebildung
- 6.5.2 Zusammenfassung der Interviews anhand der Hauptkategorien
- 6.5.2.1 Hauptkategorie 1 - Das Persönliche Budget und die Nutzungsmöglichkeit durch den mehrfach behinderten Menschen
- 6.5.2.2 Hauptkategorie 2 - Beratungsbedarf bezüglich des Persönlichen Budgets
- 6.5.2.3 Hauptkategorie 3: Unterstützungsbedarf bezüglich des Persönlichen Budgets
- 6.5.2.4 Hauptkategorie 4 - Auswirkungen des Persönlichen Budgets
- 6.6 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- 6.6.1 Inhaltliche Strukturierung
- 6.6.2 Theorie- Praxis- Vergleich
- 6.6.3 Abschließende Interpretation hinsichtlich der Forschungsfragen
- 7. Resümee
- 8. Handlungsvorschläge für die soziale Arbeit
- 9. Ausblick
- Der Einfluss des Persönlichen Budgets auf die Selbstbestimmung von Menschen mit Mehrfachbehinderung
- Die Rolle der Fürsorge und der Unterstützungssysteme im Kontext des Persönlichen Budgets
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung des Persönlichen Budgets im Bereich der Mehrfachbehinderung
- Die Bedeutung von Beratung und Unterstützung bei der Nutzung des Persönlichen Budgets
- Die Auswirkungen des Persönlichen Budgets auf die Lebensqualität von Menschen mit Mehrfachbehinderung
- Kapitel 1: Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Persönlichen Budgets für Menschen mit Mehrfachbehinderung ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der sozialen Arbeit.
- Kapitel 2: Einordnen der Begrifflichkeiten: In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe wie "Persönliches Budget", "Behinderung", "Mehrfachbehinderung", "Selbstbestimmung" und "Rehabilitation" definiert und erläutert. Dabei wird insbesondere auf die spezifischen Herausforderungen im Kontext der Mehrfachbehinderung eingegangen.
- Kapitel 3: Grundlagen - Eckpunkte/Darstellung des Persönlichen Budgets: Dieses Kapitel beleuchtet die konzeptionellen und sozialrechtlichen Grundlagen des Persönlichen Budgets. Dabei werden Ziele, Konzepte, rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Aspekte des Persönlichen Budgets erläutert.
- Kapitel 4: Umsetzung des Persönlichen Budgets: Dieses Kapitel analysiert die Umsetzung des Persönlichen Budgets in europäischen und deutschen Modellen. Es werden unterschiedliche Ansätze und Erfahrungen in verschiedenen Ländern vorgestellt und verglichen.
- Kapitel 5: Vergleich europäischer und deutscher Modelle: In diesem Kapitel werden die in Kapitel 4 vorgestellten europäischen und deutschen Modelle des Persönlichen Budgets miteinander verglichen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle herausgestellt.
- Kapitel 6: Empirischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführt wurde. Es werden die Methode und der Gang der Untersuchung, die Planung und Durchführung der Datenerhebung sowie die Ergebnisse der Inhaltsanalyse dargestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge im Kontext des Persönlichen Budgets für Menschen mit Mehrfachbehinderung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Herausforderungen des Persönlichen Budgets für diese Personengruppe zu beleuchten und anhand empirischer Daten zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, Mehrfachbehinderung, Selbstbestimmung, Fürsorge, Rehabilitation, Lebensqualität, Beratung, Unterstützung, sozialrechtliche Grundlagen, empirische Forschung, Inhaltsanalyse
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit zum Persönlichen Budget?
Die Arbeit untersucht, inwieweit das Persönliche Budget für Menschen mit Mehrfachbehinderung nutzbar ist und wo die Grenzen zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge liegen.
Welche Ländermodelle werden verglichen?
Es werden Modelle aus den Niederlanden, England und Schweden mit deutschen Modellen (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz) verglichen.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Es wurden qualitative Experteninterviews mit Fachleuten geführt und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.
Was sind die größten Herausforderungen bei Mehrfachbehinderung?
Die Herausforderungen liegen im hohen Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie in der Frage, wie Selbstbestimmung trotz schwerer Einschränkungen ermöglicht werden kann.
Welche sozialrechtliche Grundlage hat das Persönliche Budget?
Das Persönliche Budget ist im SGB IX geregelt und kann als Geldleistung oder Komplexleistung in Anspruch genommen werden.
- Citation du texte
- Markus Kaufhold (Auteur), 2007, Der mehrfachbehinderte Mensch und das Persönliche Budget. Zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74766