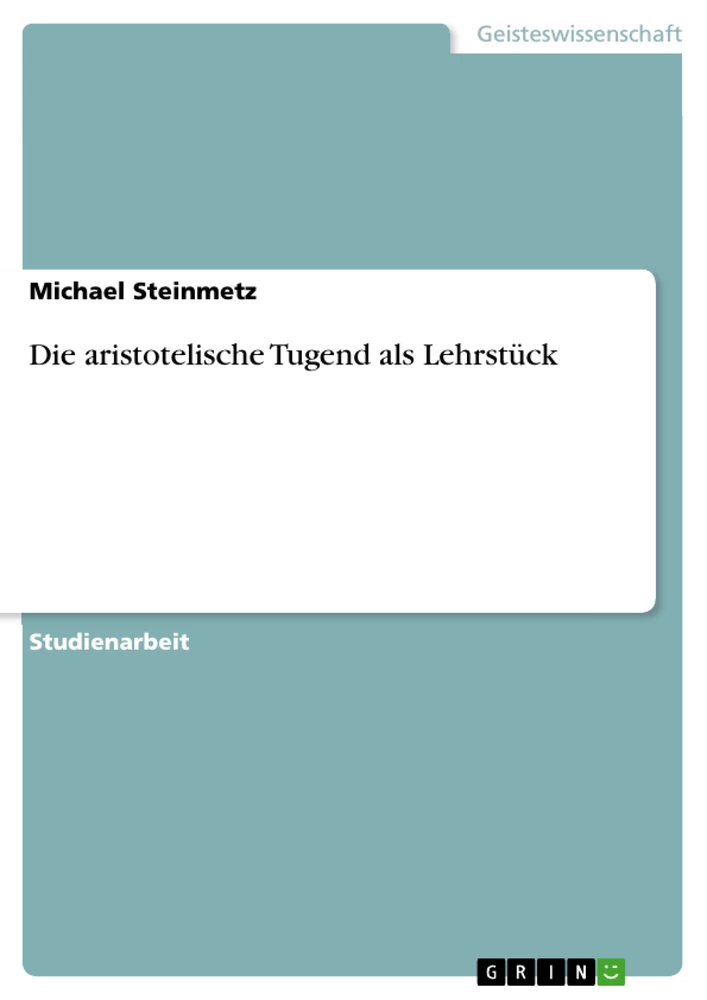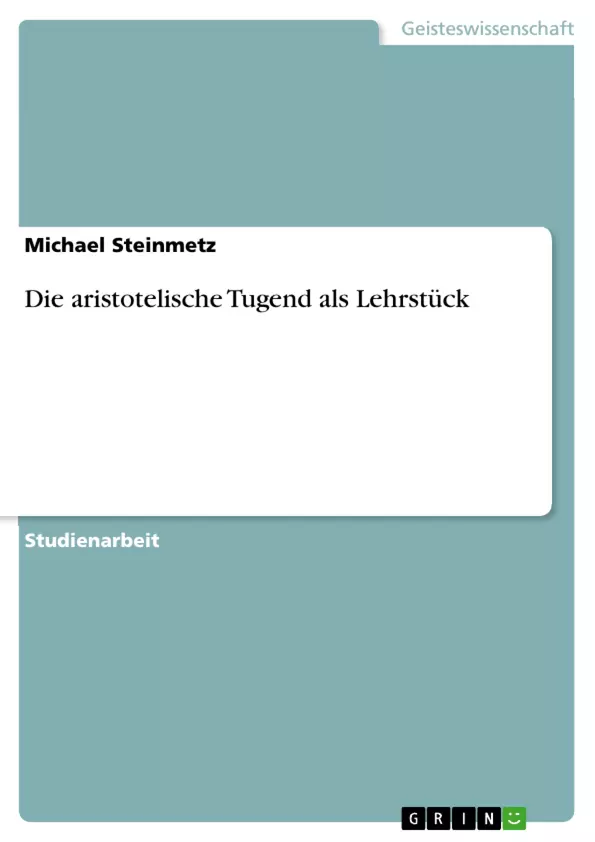‚Die Jugend hat keine Tugend’ tönt ein gängiger – vornehmlich von betagteren Generationen geäußerter – Phraseologismus auf durchaus abwertende Art und Weise. Dass dieses Sprichwort der Jugend sauer aufstößt, darf nicht verwundern; stigmatisiert es sie doch als pietät- und sittenlos, ja gewissermaßen sogar als sozial inkompetent. Ein subversives Aufbegehren gegen derartige Evaluationen ist die notwendige Folge. Doch wie macht die Jugend ihren Anspruch, eine derartige Wendung der Falsifikation zu überführen, geltend? Ganz einfach, möchte man meinen – indem sie die Gegner von der eigenen Tugend überzeugt. Doch ist die Jugend dazu tatsächlich imstande? Ist die Jugend sich ihrer Tugend überhaupt bewusst? Ja, was bedeutet ‚Tugend’ überhaupt? Eine Begriffsreflexion scheint unabdingbar, wird doch der Terminus ‚Tugend’ – obwohl er in unserem Sprachgeschehen eine durchaus hohe Frequenz genießt – meist missverstanden. Aristoteles schafft Abhilfe. Den Tugendbegriff mithilfe aristotelischer Überlegungen zu explizieren und auf didaktische Weise zu plausibilisieren, soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Die Fragestellung, welche dem ersten Teil der Untersuchung zugrunde liegt, lautet schlichtweg: ‚Was ist Tugend im aristotelischen Sinn?’. Nach einer terminologischen Bestimmung und begrifflichen Explikation soll – im Sinne der Vermittlungsintention eines Lehrers – der aristotelische Begriff der Tugend didaktisch aufbereitet werden, um darauf basierend eine Lehrsequenz zu konstituieren. ‚Wie können die Schüler zu Klarheiten und Einsichten betreffs der aristotelischen Tugend (areté) gebracht werden?’ lautet demgemäß die Fragestellung des zweiten Teils der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Areté
- Tugend und Lob
- Tugend als Synthese von Vernunft und Gewöhnung
- Sittliche Tugend als Mitte zwischen zwei Extrema
- Zusammenfassung der Bestimmungen bezüglich der Tugend
- Didaktische Überlegungen
- Didaktische Legitimation
- Methodologische Überlegungen
- Lehrsequenz
- Unterrichtseinheit 1
- Unterrichtseinheit 2
- Unterrichtseinheit 3
- Unterrichtseinheit 4
- Unterrichtseinheit 5
- Ein Wort zum Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den aristotelischen Tugendbegriff und seine didaktische Aufbereitung. Zuerst wird der Begriff der Tugend im aristotelischen Sinne geklärt und analysiert. Anschließend soll der Begriff der Tugend didaktisch aufbereitet werden, um eine Lehrsequenz zu entwickeln, die Schülerinnen und Schülern den aristotelischen Tugendbegriff (areté) näherbringt.
- Die Definition von Tugend im Sinne von Aristoteles
- Die Rolle von Habitus und Gewöhnung in der Entwicklung der Tugend
- Der Zusammenhang zwischen Tugend und gesellschaftlichem Kontext
- Die didaktische Aufbereitung des aristotelischen Tugendbegriffs
- Die Entwicklung einer Lehrsequenz, die den Schülern den aristotelischen Tugendbegriff näherbringt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den gängigen, oft abwertenden Umgang mit dem Begriff „Jugend" und stellt die These auf, dass die Jugend ihre vermeintliche "Untugend" durch die Bewusstmachung der Tugend widerlegen muss. Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Analyse des aristotelischen Tugendbegriffs. In Kapitel 2.1 wird die Tugend als ein lobenswerter Habitus definiert, der sich von Affekten und Vermögen unterscheidet. Kapitel 2.2 untersucht die Rolle von Vernunft und Gewöhnung bei der Entwicklung der Tugend, während Kapitel 2.3 die Tugend als Mittelweg zwischen zwei Extremen darstellt. Schließlich fasst Kapitel 2.4 die wichtigsten Bestimmungen des aristotelischen Tugendbegriffs zusammen.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der didaktischen Aufbereitung des aristotelischen Tugendbegriffs. In Kapitel 3.1 wird die didaktische Legitimation der Lehre von der Tugend erläutert, während Kapitel 3.2 methodologische Überlegungen zur Gestaltung des Unterrichts anbietet.
Kapitel 4 beinhaltet eine konkrete Lehrsequenz in fünf Unterrichtseinheiten, die den Schülern den aristotelischen Tugendbegriff näherbringen soll.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem aristotelischen Tugendbegriff (areté), Habitus, Gewöhnung, Vernunft, sittliche Tugend, Mittelweg, didaktische Legitimation, methodologische Überlegungen und Lehrsequenz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Areté“ bei Aristoteles?
Areté steht für Tugend oder Vortrefflichkeit. Es ist ein lobenswerter Habitus, der durch Vernunft und Gewöhnung erworben wird.
Was ist die „Lehre von der Mitte“ (Mesotes)?
Aristoteles definiert sittliche Tugend als die Mitte zwischen zwei Extremen (Mangel und Übermaß), wie z.B. Tapferkeit als Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit.
Wie wird Tugend laut Aristoteles erworben?
Tugend ist kein angeborener Affekt, sondern eine Synthese aus vernünftiger Einsicht und langjähriger Gewöhnung (Habitualisierung).
Wie kann man Aristoteles' Ethik im Unterricht vermitteln?
Durch didaktisch aufbereitete Lehrsequenzen, die Schüler dazu anregen, Begriffe wie „Glück“ und „Tugend“ auf ihr eigenes Leben und die Gesellschaft zu beziehen.
Ist die Jugend heute „tugendlos“?
Die Arbeit hinterfragt dieses Vorurteil und nutzt Aristoteles, um aufzuzeigen, dass Tugend ein bewusster Lernprozess ist, der Reflexion erfordert.
- Citar trabajo
- Michael Steinmetz (Autor), 2006, Die aristotelische Tugend als Lehrstück, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74856