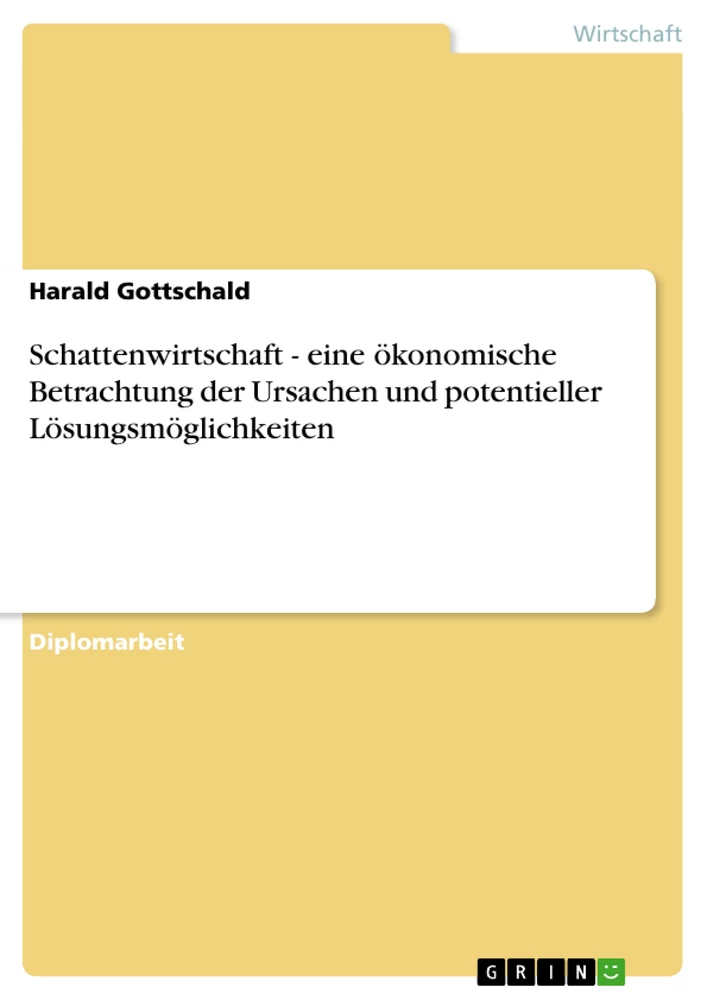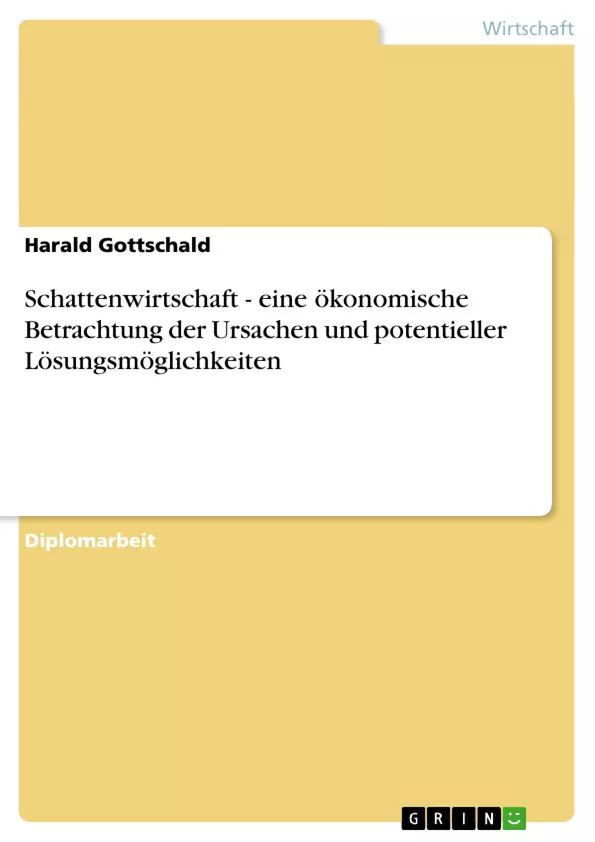Diese Arbeit soll einen fundierten zusammenfassenden Einblick in die Thematik Schattenwirtschaft geben.
Zuerst wie diese überhaupt definiert werden kann, da hier durchaus Uneinigkeit besteht. Ferner wird auf
Messmethoden eingegangen und die Resultate kritisch hinterfragt. Ausserdem werden empirische Länderdaten von Italien, Deutschland und Russland untersucht, als auch OECD Länder im Überblick, um dortige Ursachen schon empirisch sehen zu können.
Danach wird auf die theoretischen Ursachen eingegangen, wie die allgemeine Steuer- und Abgabenbelastung innerhalb einer Volkswirtschaft. Folgend werden mit Hilfe von 4 ausgewählten Dimensionen die Konsequenzen der Schattenwirtschaft untersucht.
Zum Schluss werden Lösungsmöglichkeiten im Sinne einer eher kurzfristigen, als auch einer langfristigen Wirkung vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition Schattenwirtschaft und deren Abgrenzung
- 2.1. Arbeitsdefinition und Abgrenzung
- 2.2. Gesetzliche Definition und Abgrenzung am Beispiel Deutschlands
- 3. Methoden zur Messung der Schattenwirtschaft
- 3.1. Direkte Methoden
- 3.1.1. Befragungen
- 3.1.2. Statistische Erhebungen zur Steuerhinterziehung
- 3.1.3. Kritische Würdigung der direkten Methoden
- 3.2. Indirekte Methoden
- 3.2.1. Ansätze basierend auf der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
- 3.2.2. Monetäre Ansätze zur Messung der Schattenwirtschaft
- 3.2.3. Inputansätze
- 3.3. Kausale Methoden
- 3.3.1. Grundansatz der „weichen Modellierung“
- 3.3.2. Kritik am Modellansatz
- 3.4. Vor- und Nachteile der Methoden
- 3.1. Direkte Methoden
- 4. Empirische Länderergebnisse
- 4.1. Schattenwirtschaft in Italien
- 4.2. Schattenwirtschaft in Deutschland
- 4.3. Schattenwirtschaft in Russland
- 4.4. OECD Länder im Überblick
- 4.5. Der Korruptionsindex nach Transparency International
- 5. Ursachen der Schattenwirtschaft
- 5.1. Steuer- und Abgabenbelastung im offiziellen Wirtschaftssektor
- 5.1.1. Empirische Daten
- 5.1.2. Abgabenbelastung des Faktors Arbeit
- 5.1.3. Steuermoral
- 5.2. Staatliche Regulierungsmaßnahmen
- 5.2.1. Index of economic freedom
- 5.2.2. Gesetzliche Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt
- 5.2.3. Staatsversagen am Beispiel des „Meisterbriefes“
- 5.3. Arbeitszeitregelungen
- 5.3.1. Das neoklassische Einkommen-Freizeit-Modell
- 5.3.2. Das erweiterte Einkommen-Freizeit-Modell
- 5.3.3. Weitere Einflussfaktoren und deren Variation
- 5.4. Ursachen im Überblick
- 5.1. Steuer- und Abgabenbelastung im offiziellen Wirtschaftssektor
- 6. Volkswirtschaftliche Konsequenzen der Schattenwirtschaft
- 6.1. Allokationswirkungen
- 6.2. Verteilungswirkungen
- 6.3. Stabilisierungswirkungen
- 6.4. Fiskalische Wirkungen
- 6.5. Überblick positive versus negative Folgen
- 7. Lösungsmöglichkeiten des Problems Schattenwirtschaft
- 7.1. Langfristige Lösungsstrategien
- 7.2. Kurzfristige Lösungsstrategien
- 8. Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Schattenwirtschaft aus ökonomischer Perspektive. Ziel ist es, die Ursachen der Schattenwirtschaft zu analysieren und potentielle Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten und ökonomische Modelle.
- Definition und Messung der Schattenwirtschaft
- Länderspezifische Ergebnisse zum Umfang der Schattenwirtschaft
- Analyse der Ursachen der Schattenwirtschaft (Steuerbelastung, Regulierung, Arbeitszeitregelungen)
- Volkswirtschaftliche Konsequenzen der Schattenwirtschaft (Allokation, Verteilung, Stabilität, Fiskalpolitik)
- Mögliche Lösungsansätze zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Schattenwirtschaft ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie beschreibt die Relevanz der Thematik und die Forschungsfrage, der in der Arbeit nachgegangen wird. Der Leser erhält einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die Methodik, die angewendet wird, um die Forschungsfrage zu beantworten.
2. Begriffsdefinition Schattenwirtschaft und deren Abgrenzung: Dieses Kapitel klärt den Begriff der Schattenwirtschaft und grenzt ihn von anderen Wirtschaftsaktivitäten ab. Es werden verschiedene Definitionen, sowohl arbeits- als auch gesetzesbasiert, vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung und der Herausarbeitung der zentralen Merkmale der Schattenwirtschaft im Vergleich zu legalen Wirtschaftsaktivitäten. Die Kapitel 2.1 und 2.2 liefern ein detailliertes Verständnis der verschiedenen Perspektiven auf den Begriff und schaffen eine solide Grundlage für die folgenden Kapitel.
3. Methoden zur Messung der Schattenwirtschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Methoden zur Messung der Schattenwirtschaft. Es werden direkte und indirekte Methoden vorgestellt und detailliert erklärt, jeweils mit ihren Vor- und Nachteilen. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 vergleichen diverse Ansätze – von Befragungen und statistischen Erhebungen bis hin zu komplexeren ökonometrischen Modellen – und beleuchten die Herausforderungen bei der Quantifizierung der Schattenwirtschaft. Die kritische Würdigung der Methoden in Kapitel 3.4 hebt die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze hervor und leitet den Leser zum Verständnis der Limitationen bei der Messung dieses Phänomens an.
4. Empirische Länderergebnisse: Kapitel 4 präsentiert empirische Daten zur Schattenwirtschaft in verschiedenen Ländern, darunter Italien, Deutschland und Russland, sowie einen Überblick über OECD-Länder. Es werden die jeweiligen Größenordnungen der Schattenwirtschaft verglichen und mögliche Gründe für die Unterschiede analysiert. Der Korruptionsindex von Transparency International wird als ergänzende Variable zur Erklärung der Unterschiede in den Größenordnungen der Schattenwirtschaft herangezogen und kritisch bewertet. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der empirischen Ergebnisse und der Interpretation der Daten im Lichte der vorangegangenen methodischen Diskussion.
5. Ursachen der Schattenwirtschaft: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen der Schattenwirtschaft. Es untersucht den Einfluss von Steuer- und Abgabenbelastung, staatlichen Regulierungsmaßnahmen und Arbeitszeitregelungen auf das Ausmaß der Schattenwirtschaft. Die Analyse stützt sich auf empirische Daten und ökonomische Modelle, z.B. das Einkommen-Freizeit-Modell. Es werden die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und dem Anreiz zur Teilnahme an der Schattenwirtschaft detailliert erläutert. Die Kapitel 5.1 bis 5.3 bieten eine umfassende Betrachtung der verschiedenen Einflussfaktoren und deren Interaktion.
6. Volkswirtschaftliche Konsequenzen der Schattenwirtschaft: Dieses Kapitel untersucht die volkswirtschaftlichen Folgen der Schattenwirtschaft. Es analysiert die Auswirkungen auf Allokation, Verteilung, Stabilität und Fiskalpolitik. Die Diskussion umfasst sowohl positive als auch negative Effekte und deren jeweilige Bedeutung für die Volkswirtschaft. Die einzelnen Unterkapitel bieten detaillierte Analysen der verschiedenen Auswirkungen und deren Interdependenzen. Der Fokus liegt darauf, die komplexen Folgen der Schattenwirtschaft für die gesamte Volkswirtschaft zu verstehen.
7. Lösungsmöglichkeiten des Problems Schattenwirtschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit möglichen Strategien zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft. Es werden sowohl langfristige als auch kurzfristige Lösungsansätze diskutiert und ihre jeweilige Effektivität analysiert. Die Kapitel 7.1 und 7.2 untersuchen verschiedene Maßnahmen, die darauf abzielen, die Schattenwirtschaft zu reduzieren und die legale Wirtschaft zu stärken. Der Fokus liegt auf der Diskussion der jeweiligen Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Schattenwirtschaft, Messung der Schattenwirtschaft, Ursachen der Schattenwirtschaft, Volkswirtschaftliche Konsequenzen, Lösungsmöglichkeiten, Steuerbelastung, Regulierung, Arbeitszeitregelungen, empirische Daten, ökonomische Modelle, OECD-Länder, Korruption.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Schattenwirtschaft
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Schattenwirtschaft aus ökonomischer Perspektive. Das Ziel ist die Analyse der Ursachen und die Aufzeigen potentieller Lösungsmöglichkeiten. Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten und ökonomische Modelle.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Messung der Schattenwirtschaft, länderspezifische Ergebnisse zum Umfang der Schattenwirtschaft, Analyse der Ursachen (Steuerbelastung, Regulierung, Arbeitszeitregelungen), volkswirtschaftliche Konsequenzen (Allokation, Verteilung, Stabilität, Fiskalpolitik) und mögliche Lösungsansätze zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition und Abgrenzung der Schattenwirtschaft, Methoden zur Messung, empirische Länderergebnisse, Ursachen der Schattenwirtschaft, volkswirtschaftliche Konsequenzen, Lösungsmöglichkeiten und eine kritische Würdigung mit Ausblick. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Welche Methoden zur Messung der Schattenwirtschaft werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert sowohl direkte (Befragungen, statistische Erhebungen) als auch indirekte Methoden (Ansätze basierend auf der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, monetäre Ansätze, Inputansätze) sowie kausale Methoden ("weiche Modellierung"). Die Vor- und Nachteile jeder Methode werden kritisch gewürdigt.
Welche Länder werden in der empirischen Analyse betrachtet?
Die empirische Analyse betrachtet die Schattenwirtschaft in Italien, Deutschland und Russland. Zusätzlich wird ein Überblick über OECD-Länder gegeben. Der Korruptionsindex von Transparency International wird als ergänzende Variable herangezogen.
Welche Ursachen für die Schattenwirtschaft werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Steuer- und Abgabenbelastung, staatlichen Regulierungsmaßnahmen (inkl. Index of economic freedom und Gesetzliche Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt) und Arbeitszeitregelungen (inkl. neoklassisches und erweitertes Einkommen-Freizeit-Modell) auf das Ausmaß der Schattenwirtschaft.
Welche volkswirtschaftlichen Konsequenzen der Schattenwirtschaft werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Schattenwirtschaft auf Allokation, Verteilung, Stabilität und Fiskalpolitik. Sowohl positive als auch negative Effekte werden diskutiert.
Welche Lösungsansätze zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft werden vorgeschlagen?
Die Arbeit diskutiert sowohl langfristige als auch kurzfristige Lösungsstrategien zur Reduktion der Schattenwirtschaft und zur Stärkung der legalen Wirtschaft. Die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Ansätze werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schattenwirtschaft, Messung der Schattenwirtschaft, Ursachen der Schattenwirtschaft, Volkswirtschaftliche Konsequenzen, Lösungsmöglichkeiten, Steuerbelastung, Regulierung, Arbeitszeitregelungen, empirische Daten, ökonomische Modelle, OECD-Länder, Korruption.
- Quote paper
- Harald Gottschald (Author), 2007, Schattenwirtschaft - eine ökonomische Betrachtung der Ursachen und potentieller Lösungsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75000