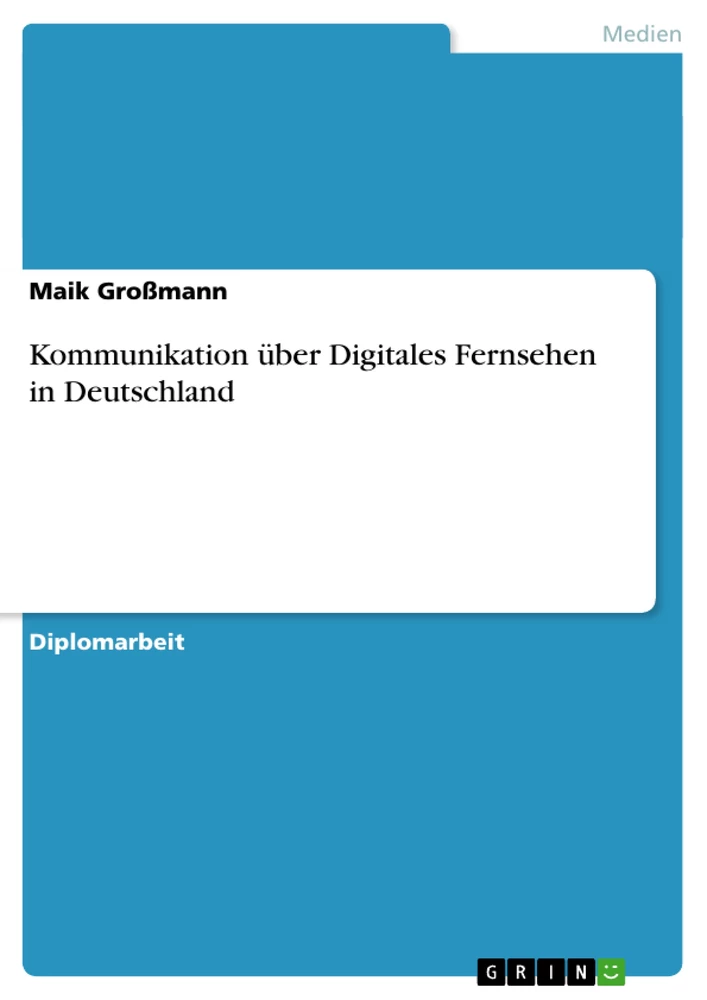Als Ende der 80er Jahre das Verfahren der Digitalisierung entdeckt wurde, schien ein neues Zeitalter der Medien-Kommunikation erreicht. Durch die Übertragung einer möglichst geringen Datenmenge gelang es, weitaus größere Kapazitäten bereitzustellen als es im konventionellen, analogen Verfahren der Fall gewesen war. Enorme Zuwächse in der Programmanzahl wurden auf einen Schlag in Hörfunk und Fernsehen möglich. Rückkanäle sollten zudem aus dem passiven TV-Konsumenten einen aktiven und gar interaktiven Rezipienten machen; digitale Videotheken und virtuelle Klassenzimmer wurden in Aussicht gestellt.
Nicht nur europaweit war man sich einig, gemeinsam in ein digitales Zeitalter aufbrechen zu wollen. Entsprechende Maßnahmen wurden ergriffen – mit unterschiedlichen Erfolgen. In Frankreich und Großbritannien hat sich das digitale Fernsehen inzwischen durchgesetzt, in den USA strebt man gar eine völlige Abschaltung analoger Signale bis 2006 an.
In Deutschland soll dieser Switch Off bis zum Jahre 2010 erfolgen, doch der Weg dorthin hat sich als ein äußerst steiniger erwiesen. Leo Kirch führte das digitale Fernsehen als erster auf dem deutschen Markt ein und scheiterte. Es folgten lange Auseinandersetzungen über Decoder-Standards; außerdem sind die technischen Infrastrukturen insbesondere im Kabelnetzbereich bis heute nicht ausreichend aufgerüstet worden. Man beschloss, das „Überallfernsehen“ zunächst terrestrisch zu verbreiten und setzte vor allem im ersten Halbjahr 2004 dieses Vorhaben in die Tat um.
Spätestens an dieser Stelle, als sich viele Rezipienten scheinbar plötzlich zum Kauf eines entsprechenden Empfangsgerätes genötigt fühlten, zeigte sich ein Kommunikationsproblem. Zwar hat es vor allem seitens der Politik verschiedene Kampagnen zur Aufklärung über die neue Technologie gegeben. Noch immer zeigen aber Teile der Bevölkerung nicht nur geringe Akzeptanz gegenüber diesem Fortschritt, sondern sind auch schlichtweg nicht ausreichend informiert. Dass an dieser Stelle das größte Versäumnis bei der Einführung digitalen Fernsehens in Deutschland liegt, soll diese Arbeit herausstellen.
Es werden Antworten gesucht auf die Frage, warum digitales Fernsehen im Deutschland des Jahres 2004 noch ein Schattendasein führt und warum es sich im Ausland bereits etabliert hat. Weshalb zeigen sich die Bürger so desinteressiert an der unbestritten vorteilhaften neuen Technologie und wem sind in dieser Hinsicht welche Versäumnisse zu unterstellen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Definition Digitales Fernsehen
- Die digitale Technik
- Technische Dienstleistungen
- Vorteile und Möglichkeiten
- Angebots- und Vermarktungsformen
- Zusammenfassung
- Digitales Fernsehen im Ausland
- Kollektive Wegbereitung
- Rahmenbedingungen
- Vermarktung und Verbreitung
- Fallbeispiele
- USA
- Frankreich
- Großbritannien
- Medienpolitische Strategien
- Zusammenfassung
- Digitales Fernsehen in Deutschland
- Anfänge und Wegbereitung
- Rahmenbedingungen
- Problemfelder
- Marktstrukturen
- Medienpolitische Probleme
- Sonstige
- Konsumenteninteresse
- Aktuelle Verbreitung
- Zusammenfassung
- Kommunikation über Digitales Fernsehen in Deutschland
- Akteure und Interessengruppen
- Rezipienten
- Gesellschaftliche Entwicklungen
- Interessen und Handlungsfähigkeit
- Zugangsprobleme
- Programmveranstalter und Medienwirtschaft
- Interessenkonflikte
- Handlungsfähigkeit und Strategien
- Fehler und Versäumnisse
- Die Rolle der Politik
- Möglichkeiten staatlichen Handelns
- Aktivitäten und Initiativen
- Probleme und Versäumnisse
- Sonstige Akteure und Initiativen
- Rezipienten
- Zusammenfassung Kommunikationsprozesse
- Internationaler Vergleich
- Die ideale Kommunikation
- Akteure und Interessengruppen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Einführung des digitalen Fernsehens in Deutschland und untersucht die verschiedenen kommunikativen Prozesse, die diese Entwicklung begleiten. Dabei liegt der Fokus auf den Fragen, warum sich die neue Technologie trotz technischer Möglichkeiten und politischer Förderungen nur schleppend durchsetzt und welche Akteure im Kommunikationsprozess welche Verantwortung tragen.
- Herausforderungen der Digitalisierung des Fernsehens
- Einflussfaktoren auf die Akzeptanz des digitalen Fernsehens
- Rolle des Gesetzgebers und der Medienwirtschaft bei der Kommunikation
- Analyse von Kommunikationsstrategien und deren Wirksamkeit
- Vergleich mit internationalen Entwicklungen und Best-Practice-Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und definiert die Problemstellung, die sich mit der langsamen Einführung des digitalen Fernsehens in Deutschland befasst.
- Kapitel zwei erläutert die grundlegende Funktionsweise des digitalen Fernsehens im Vergleich zum analogen Verfahren.
- Kapitel drei beschreibt die technische Funktionsweise des digitalen Fernsehens, die Vorteile und Möglichkeiten der neuen Technologie und die verschiedenen Angebots- und Vermarktungsformen.
- Kapitel vier befasst sich mit der internationalen Entwicklung des digitalen Fernsehens und präsentiert Fallbeispiele aus den USA, Frankreich und Großbritannien, um die Unterschiede in der Umsetzung der Digitalisierung und der medienpolitischen Strategien aufzuzeigen.
- Kapitel fünf beleuchtet die Situation des digitalen Fernsehens in Deutschland, die anfänglichen Probleme und die Herausforderungen, die sich aus den spezifischen Rahmenbedingungen ergeben.
- Kapitel sechs analysiert die Kommunikationsprozesse rund um die Einführung des digitalen Fernsehens in Deutschland und stellt die verschiedenen Akteure und deren Rollen im Kommunikationsgeschehen vor.
Häufig gestellte Fragen
Warum setzte sich das digitale Fernsehen in Deutschland langsamer durch als im Ausland?
Gründe waren unter anderem gescheiterte Marktstarts (z.B. Kirch), langwierige Streitigkeiten über Decoder-Standards und eine mangelhafte technische Infrastruktur im Kabelnetz.
Welche technischen Vorteile bietet digitales Fernsehen?
Es ermöglicht eine weitaus größere Programmanzahl bei geringerer Datenmenge sowie Zusatzdienste wie digitale Videotheken und interaktive Rückkanäle.
Wann war der offizielle „Switch Off“ in Deutschland geplant?
Das Ziel für die vollständige Abschaltung der analogen Signale in Deutschland war das Jahr 2010.
Welche Rolle spielte die Politik bei der Einführung?
Die Politik startete zwar Aufklärungskampagnen, doch die Arbeit stellt fest, dass Versäumnisse in der Kommunikation zu einer geringen Akzeptanz und mangelnden Information in der Bevölkerung führten.
Welche Länder dienen als positive Vergleichsbeispiele?
In Frankreich, Großbritannien und den USA hatte sich das digitale Fernsehen bereits deutlich früher etabliert als in Deutschland.
- Citation du texte
- Maik Großmann (Auteur), 2005, Kommunikation über Digitales Fernsehen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75011