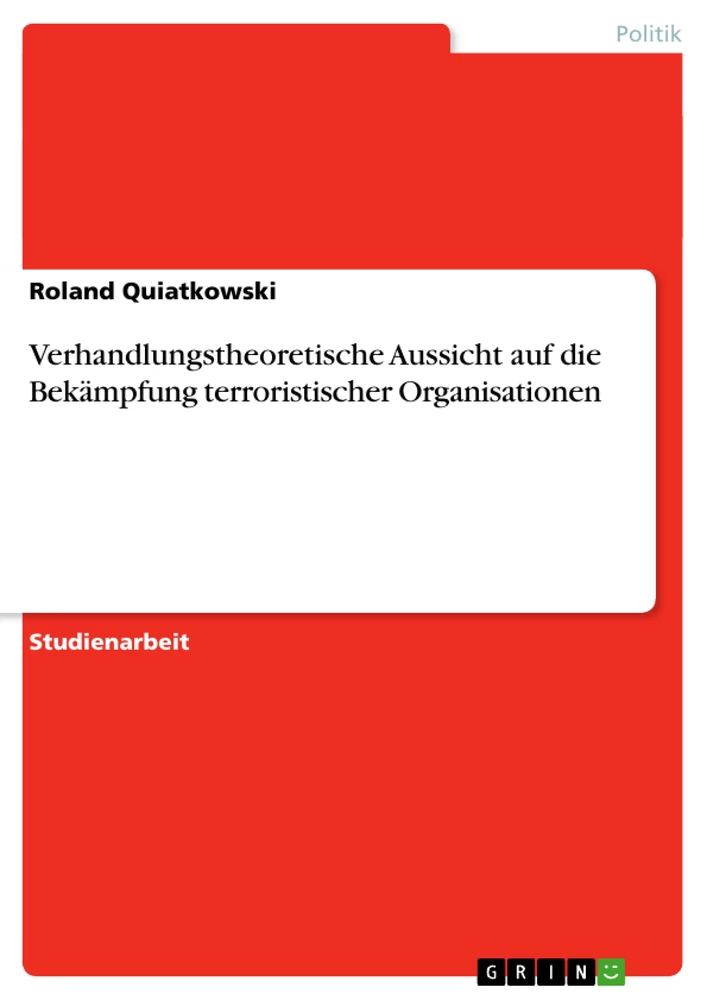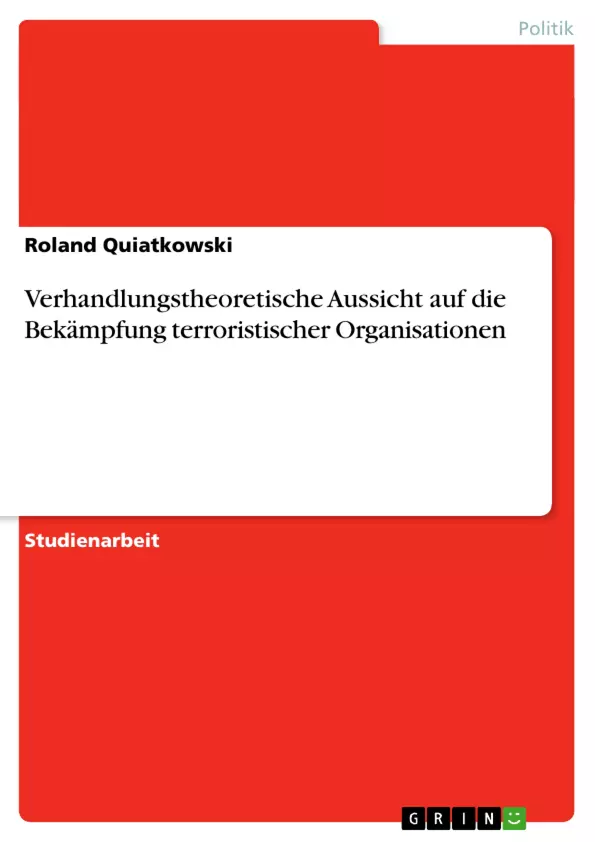Offene Fragen, was das Thema Terrorismus angeht, gibt es zuhauf. So gibt es noch nicht einmal eine einhellig akzeptierte Definition.(vgl. Daase; 2001: S.57) Dennoch wird, so eine bestimmte Form von Staat davon spricht, die jeweilige Definition dieses Staates als "wahr" angenommen. Und auch andere Fragen wie die nach der Beschaffenheit der jeweiligen Organisationen, den Rekrutierungsarten eben dieser, den verwendeten Waffen, ihrer regionalen oder globalen Ausbreitung und den Gründen für terroristische Aktivitäten können noch oder überhaupt nicht befriedigend beantwortet werden. Inwieweit jedoch die Ziele der Terroristen, wie sie also nur umgangssprachlich genannt werden können, realistisch sind, verfehlt werden oder erreicht werden können, lässt sich relativ einfach empirisch nachweisen.
Dennoch soll und kann diese Hausarbeit nicht empirisch argumentieren. Vielmehr wird versucht, mit einer Definition von Terrorismus, die Terrorismus als Kommunikationsform versteht, die Form des Zieles festzulegen oder eine Kategorisierungsform für unterschiedliche Ziele des Terrors zu erarbeiten. Auf eine solche Kategorisierung wird dem folgend, die Art und Weise der Darbringung bestimmter kommunikativer Akte, soll heißen der Übergriffe, auf ihre Möglichkeiten zur Zielerreichung untersucht werden. Das schließt durchaus auch mit ein, dass eine bestimmte Vorgehensweise, mit Terroristen umzugehen, aufgezeigt werden kann oder wenigstens bisher unwirksame Maßnahmen dargestellt werden können.
Dazu sind vorhergehend einige Definitionen nötig, die wie die bereits genannte im Folgenden erläutert werden sollen. Für diese Definitionen wird im einzelnen, konkret den Terrorismus als solchen behandelnde Literatur herangezogen werden, vor allen Dingen Definitionsversuche Christopher Daases und Peter Waldmanns. Neben dieser jedoch soll, in Bezug auf die Idee des Terrorismus als Unterhaltung einfacher Gesprächspartner, auch und gerade Literatur verwendet werden, die die Form eines normalen Sprechaktes und notwendigerweise auch möglicher Ziele eines Sprechaktes untersuchen. Hierzu sei der Aufsatz "Logik der Verständigung" von Hartmut Esser besonders hervorgehoben.
Um die Anschaulichkeit der Arbeit zu gewährleisten, soll mit Beispielen gearbeitet werden. Die herangezogenen Beispiele jedoch können und sollen sich nicht auf real existierende Organisationen beziehen, auch wenn Ähnlichkeiten zu solchen nicht ausgeschlossen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Terrorismus (als Kommunikationsstrategie)
- Terror, ist das ein Spiel?
- Terrorismus als „Bargaining”
- Terrorismus als „Arguing”
- Terror als asymmetrische Gewalt?
- Die Ziele
- Zurück zum Beispiel
- Aussitzen, ein Problem?
- Ähnliche Verhandlungen
- Wie sich also verhalten?
- Kampf ist unausweichlich
- Ist Verlagern eine Lösung?
- Konsequenzen für existierende Konflikte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der theoretischen Betrachtung der Bekämpfung terroristischer Organisationen aus verhandlungstheoretischer Perspektive. Im Mittelpunkt stehen die Analyse des Terrorismus als Kommunikationsform und die Erarbeitung von Strategien für den Umgang mit terroristischen Bedrohungen.
- Definition des Terrorismus als Kommunikationsstrategie
- Analyse der Ziele und Strategien terroristischer Organisationen
- Verhandlungstheoretische Ansätze zur Bekämpfung von Terrorismus
- Bewertung der Effektivität von unterschiedlichen Strategien
- Konsequenzen für den Umgang mit existierenden Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die grundlegenden Fragen und Herausforderungen im Kontext des Terrorismus dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Es werden zentrale Aspekte der Definition des Terrorismus sowie die Schwierigkeiten der empirischen Forschung beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich unterschiedlichen Definitionen des Terrorismus, insbesondere im Kontext von Kommunikation und Strategie. Es wird die These vertreten, dass Terrorismus eine Kommunikationsstrategie darstellt, die darauf abzielt, durch gezielte Gewaltakte eine Reaktion des Gegners zu provozieren.
Das dritte Kapitel untersucht die Ziele terroristischer Organisationen und beleuchtet die Bedeutung von Verhandlungstaktiken und Kommunikationsstrategien.
Das vierte Kapitel analysiert verschiedene Verhandlungsstrategien im Umgang mit terroristischen Organisationen und diskutiert die Auswirkungen von Ressourcen und Machtverhältnissen auf den Erfolg von Verhandlungsprozessen.
Das fünfte Kapitel geht auf die Frage ein, wie sich staatliche Akteure im Umgang mit terroristischen Organisationen verhalten sollten, und stellt die Notwendigkeit eines Kampfes gegen den Terrorismus in den Vordergrund.
Das sechste Kapitel untersucht die Konsequenzen der beschriebenen Strategien und Ansätze für die Bewältigung von existierenden Konflikten.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Kommunikationsstrategie, Verhandlungstheorie, asymmetrische Gewalt, Konfliktlösung, Staatsgewalt, Machtverhältnisse, strategisches Handeln, Kommunikationsakte, Zielerreichung, Verhandlungstaktik, Konfliktmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Terrorismus als Kommunikationsstrategie?
Terrorismus wird hier als eine Form der Kommunikation verstanden, bei der Gewaltakte dazu dienen, eine Botschaft an einen Gegner oder eine Öffentlichkeit zu senden und eine bestimmte Reaktion zu provozieren.
Was ist der Unterschied zwischen „Bargaining“ und „Arguing“ im Terrorismus?
Bargaining bezeichnet Verhandlungsprozesse, die auf Drohungen und Zugeständnissen basieren, während Arguing den Versuch beschreibt, durch Argumente oder moralische Ansprüche zu überzeugen.
Ist Verhandeln mit Terroristen aus theoretischer Sicht sinnvoll?
Die Verhandlungstheorie analysiert, ob und unter welchen Bedingungen Gespräche zu einer Deeskalation führen können oder ob sie die Position der Terroristen lediglich legitimieren.
Warum wird Terrorismus oft als asymmetrische Gewalt bezeichnet?
Asymmetrie bedeutet, dass die Konfliktparteien über sehr ungleiche Ressourcen und Machtmittel verfügen. Terrororganisationen nutzen unkonventionelle Methoden, um die Überlegenheit staatlicher Akteure auszugleichen.
Können terroristische Ziele realistisch erreicht werden?
Empirische Untersuchungen zeigen, dass die langfristigen politischen Ziele oft verfehlt werden, Terrorismus jedoch kurzfristig hohe Aufmerksamkeit und taktische Erfolge erzielen kann.
- Citar trabajo
- Roland Quiatkowski (Autor), 2005, Verhandlungstheoretische Aussicht auf die Bekämpfung terroristischer Organisationen , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75068