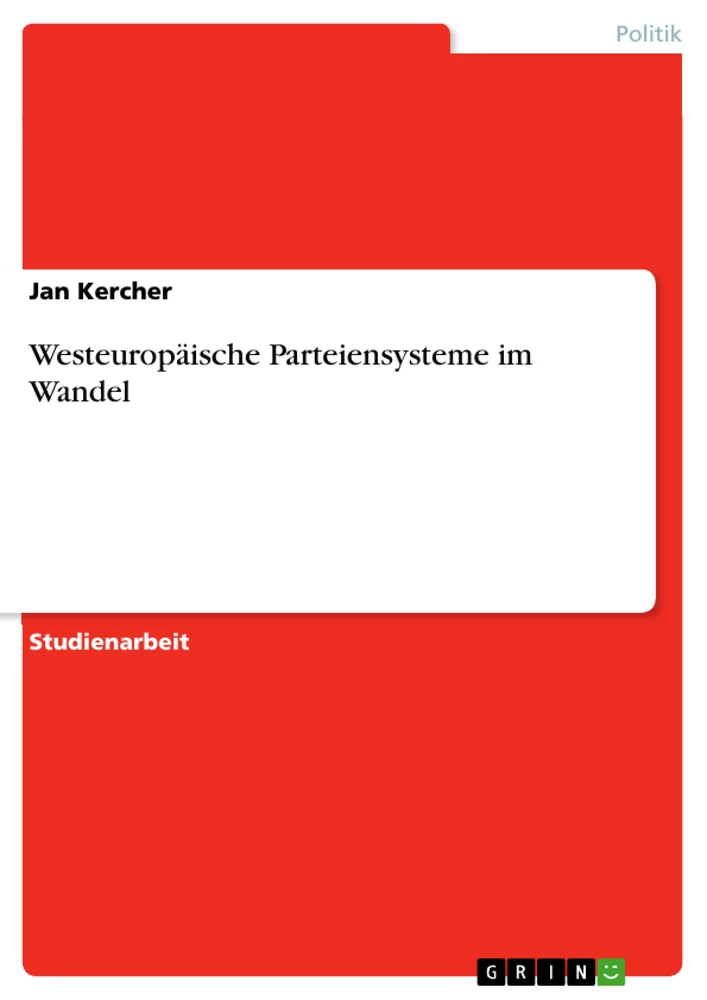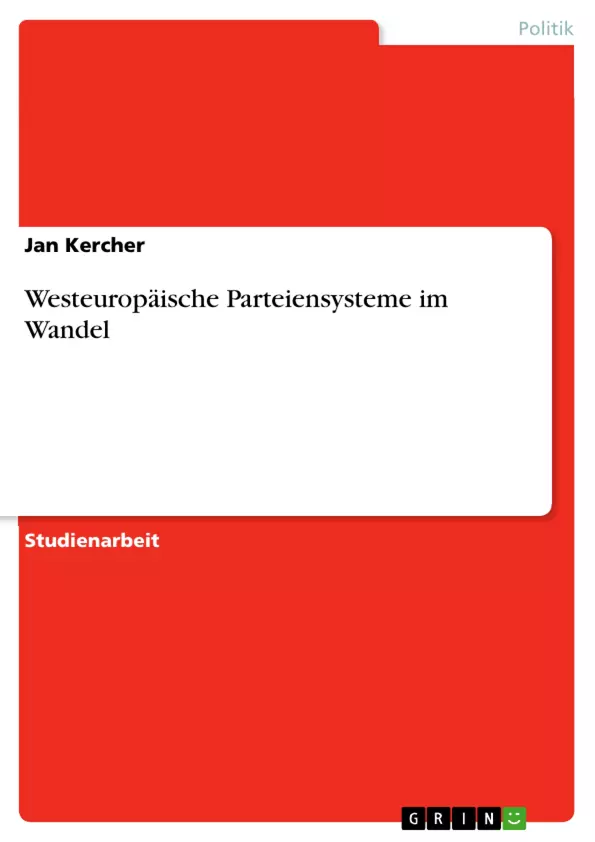Der Wandel von Parteiensystemen beschäftigt die Politikwissenschaft seit nunmehr über zwei Jahrzehnten auf intensive Weise. Waren bis zu den siebziger Jahren hauptsächlich Thesen und Theorien zur Stabilität von Parteiensystemen aufgestellt worden, so setzte von nun an ein Paradigmenwechsel ein, der in der Politikwissenschaft seines gleichen sucht. Plötzlich war von Wertewandel, Transformationstheorie, Postmaterialismus, Dealignment, Realignment und ,,end of ideology" zu lesen und zu hören: Begriffe, mit denen kurz zuvor noch niemand etwas hätte anfangen können.
Doch was versteht man genau unter diesen Bezeichnungen, welche Theorien verbergen sich hinter ihnen und was hat sich davon bis heute im Streit der Politikwissenschaft halten können? Wie können wir die Aussagefähigkeit der Theorien testen, welche Indikatoren dienen hier als Maßstäbe und in welchen Ländern kommen wir hiermit zu welchen Ergebnissen?
Seit der letzten Bundestagswahl beschäftigt ein weiteres Thema die Parteiensystemforschung: mit Bündnis 90 / Die Grünen ist zum ersten Mal eine Partei in der Bundesregierung vertreten, die bisher klar zur neuen, postmaterialistischen Bewegung gezählt wurde. Die Postmaterialismus-Theorie scheint also zumindest in Deutschland nicht vollkommen aus der Luft gegriffen zu sein.
Doch wie verhält es sich mit dem Wandel der Parteiensysteme in anderen Ländern? Sind überall ähnliche Bewegungen und Entwicklungen zu beobachten wie in Deutschland? Oder haben die verschiedenen Theorien nur länderspezifische Bedeutung und Gültigkeit?
Diese Arbeit soll einen Versuch darstellen, den eben genannten Fragen anhand eines Vergleichs verschiedener Forschungsergebnisse auf den Grund zu gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typologisierung von Parteiensystemen
- Erste Typologisierungsansätze und Definition des Parteiensystems
- Weiterentwicklung durch Niedermayer
- Fragmentierung eines Parteiensystems
- Polarisierung eines Parteiensystems
- Bestimmungsfaktoren der Parteiensystementwicklung
- Institutionelle Rahmenbedingungen: Das Wahlsystem
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Die Cleavage-Theorie
- Erweiterung durch Inglehart und Dalton: Wertewandel als neues Cleavage
- Erweiterung auf insgesamt sieben „issue dimensions“ durch Lijphart
- Veränderungen der Angebotsseite: die Allerweltspartei nach Kirchheimer
- Zusammenfassung und Hypothesenbildung
- Vergleich dreier europäischer Parteiensysteme
- Die Bedeutung der Cleavages
- Die Bedeutung des Links-Rechts-Gegensatzes
- Die Entwicklung der Fragmentierung und der Polarisierung
- Das wiedervereinigte Deutschland als Sonderfall
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit widmet sich der Untersuchung des Wandels von west- europäischen Parteiensystemen. Sie analysiert die Entwicklung der Par- teiensysteme in den letzten Jahrzehnten und hinterfragt, welche Theorien und Faktoren diesen Wandel prägen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein besseres Verständnis für die Dynamik von Parteiensystemen zu gewinnen und die Gültigkeit verschiedener Theorien im Vergleich unterschiedlicher Länder zu testen.
- Typologisierung von Parteiensystemen
- Bestimmungsfaktoren der Parteiensystementwicklung
- Entwicklung der Fragmentierung und Polarisierung von Parteiensyste- men
- Die Bedeutung der Cleavages und des Links-Rechts-Gegensatzes
- Vergleich der Parteiensysteme ausgewählter europäischer Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Typologisierung von Parteiensyste- men. Es werden verschiedene Ansätze zur Klassifizierung von Parteiensyste- men vorgestellt, wobei die Bedeutung der Anzahl der Parteien, des Formats und der qualitativen Merkmale im Vordergrund steht. Das Kapitel befasst sich insbesondere mit der Weiterentwicklung der Typologie durch Niedermayer, der sechs zusätzliche Merkmale einführt, um die Komplexität von Parteiensystemen besser erfassen zu können.
Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Bestimmungsfaktoren der Parteiensystementwicklung beleuchtet. Neben den institutionellen Rahmen- bedingungen, wie dem Wahlsystem, werden die gesellschaftlichen Rahmen- bedingungen im Kontext der Cleavage-Theorie erörtert. Die Bedeutung des Wertewandels und die Erweiterung der Cleavage-Theorie durch Inglehart und Dalton sowie Lijphart werden ebenfalls behandelt. Des Weiteren wird die Entwicklung der „Allerweltspartei“ nach Kirchheimer untersucht.
Das dritte Kapitel vergleicht verschiedene europäische Parteiensysteme und analysiert deren Entwicklung im Hinblick auf die Bedeutung der Cleavages, den Links-Rechts-Gegensatz, die Fragmentierung und Polarisierung. Die Arbeit beleuchtet dabei auch den Sonderfall des wiedervereinigten Deutschlands.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Parteiensystem- forschung wie Typologisierung von Parteiensystemen, Bestimmungs- faktoren der Parteiensystementwicklung, Cleavage-Theorie, Werte- wandel, Fragmentierung, Polarisierung, Allerweltsparteien, Links- Rechts-Gegensatz und vergleichende Analyse europäischer Parteiensysteme.
Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich westeuropäische Parteiensysteme in den letzten Jahrzehnten verändert?
Es gab einen Wandel von stabilen Systemen hin zu mehr Fragmentierung und Polarisierung, getrieben durch Faktoren wie Wertewandel und neue gesellschaftliche Konfliktlinien.
Was besagt die Cleavage-Theorie?
Die Cleavage-Theorie besagt, dass Parteiensysteme auf tief verwurzelten gesellschaftlichen Konflikten (z.B. Arbeit vs. Kapital, Kirche vs. Staat) basieren.
Was ist eine "Allerweltspartei" (Catch-all party)?
Nach Otto Kirchheimer ist dies eine Partei, die ihre ideologische Tiefe reduziert, um Wähler aus allen gesellschaftlichen Schichten anzusprechen.
Was bedeutet Polarisierung eines Parteiensystems?
Polarisierung beschreibt die ideologische Distanz zwischen den Parteien in einem System, was die Regierungsbildung erschweren kann.
Warum gilt das wiedervereinigte Deutschland als Sonderfall?
Deutschland ist ein Sonderfall, da hier zwei unterschiedliche politische Sozialisationen (Ost und West) in einem Parteiensystem zusammengeführt wurden, was zu spezifischen Fragmentierungsmustern führte.
- Arbeit zitieren
- Jan Kercher (Autor:in), 2001, Westeuropäische Parteiensysteme im Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/751