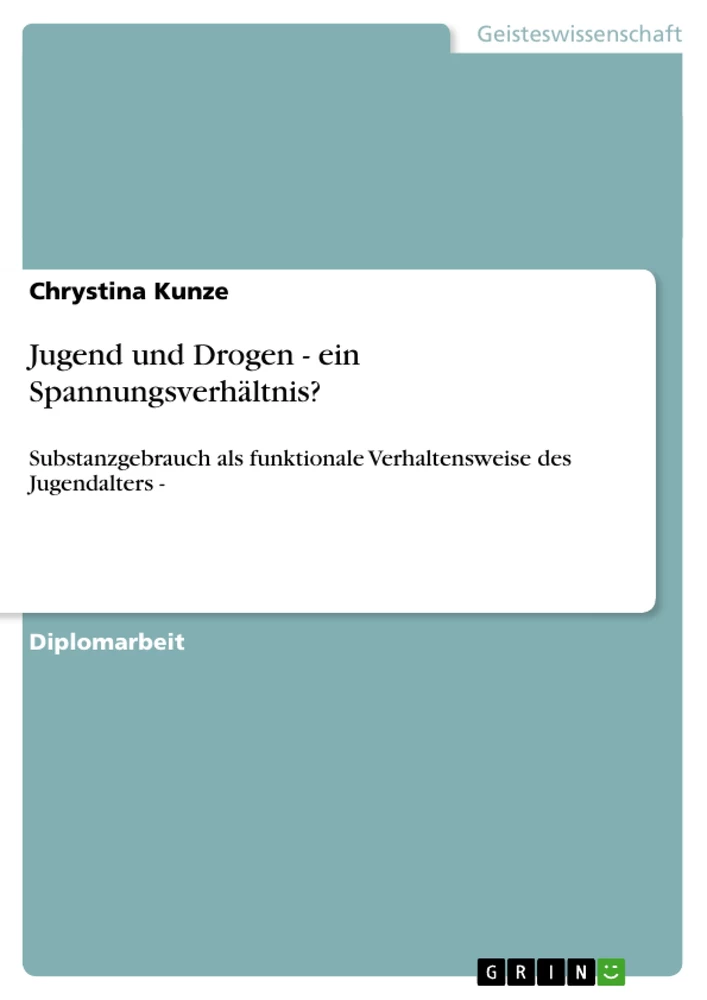Der jugendliche Konsum von Rauschmittel stößt - trotz wachsender Behauptung der akzeptanzorientierten Drogenarbeit - auch gegenwärtig auf Unverständnis und Ablehnung sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Wissenschaften. Er wird dabei vorschnell als deviantes und inadäquates Verhalten etikettiert, dessen Ursachen weitestgehend auf genetische Dispositionen, ungünstige Bedingungen des Aufwachsens bei einhergehenden unbewältigten Sozialisationserfahrungen zurückgeführt werden. Diese Deutungsmuster sind in der gesellschaftlichen Prämisse der drogenabstinenten Lebensführung - hierbei besonders im Kindes- und Jugendalter - aufgrund der antizipierten Gefahren einer (scheinbar zwangsläufigen) Abhängigkeitsgenese verwurzelt. Sie bilden sich dabei in einem ambivalenten Verständnis über Rauschmittel ab, das es in einem ersten Teil der Arbeit gilt, anhand einer theoretischen Einführung in das Drogen-Thema herauszuarbeiten und zu wertneutralisieren.
Ein zweiter Teil der Arbeit beschäftigt sich tiefgründig mit der Jugendphase als einen eigenständigen Biographieabschnitt, dessen Signifikanz sich in der Individuations- und Integrationsleistung des einzelnen Heranwachsenden abzeichnet. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse beinhaltet die Adoleszenz vielfältige Anforderungen, die auf die Ausbildung einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit bei einhergehendem Übergang in einen gesellschaftlichen Erwachsenenstatus abzielen. Die umfangreiche Annäherung an die Spezifik des Jugendalters soll ein grundlegendes Verständnis über deren biographiestrukturierende Chancen und Risikopotentiale evozieren.
Daran anknüpfend fokussiert der dritte Teil der Arbeit den jugendlichen Substanzgebrauch vor dem Hintergrund lebensphasenbedingter Entwicklungsaufgaben. Im Verständnis eines (risikoexponierten) Bewältigungshandelns wird er als funktionale Verhaltensweise dargestellt, der spezifische Funktionen in der Auseinandersetzung mit den sowohl individuellen als auch gesellschaftlichen Herausforderungen der Jugendphase aufweist.
Ziel dieser Arbeit ist es, Zusammenhänge des Drogengebrauches und entwicklungsbedingter Veränderungen herauszuarbeiten, um daran eine individuelle Sinnhaftigkeit und bewältigungsadäquate Funktionalität besagter gesundheitsrelevanter Risikoverhaltensweise aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretische Annäherung an das Thema Drogen
- 1.1. Rauschmittel aus pharmakologischer Sicht
- 1.1.1. Sedierende Rauschmittel
- 1.1.2. Halluzinogene Rauschmittel
- 1.1.3. Stimulierende Rauschmittel
- 1.1.4. Synthetische Rauschmittel
- 1.2. Rauschmittel aus rechtlicher Sicht
- 1.3. Drogengebrauch, -missbrauch und -abhängigkeit
- 1.3.1. Der Gebrauch von Drogen
- 1.3.2. Drogenmissbrauch und -abhängigkeit als diagnostizierbare Syndrome
- 1.4. Erklärungsansätze des Rauschmittelgebrauches
- 1.4.1. Individuumzentrierte Erklärungsansätze des Rauschmittelgebrauches
- 1.4.2. Gesellschaftszentrierte Erklärungsansätze des Rauschmittelgebrauches
- 1.4.3. Multifaktorielle Erklärungsansätze des Rauschmittelgebrauches
- 1.1. Rauschmittel aus pharmakologischer Sicht
- 2. Annäherung an die Spezifik der Jugend
- 2.1. Jugend als wissenschaftliches Konstrukt
- 2.1.1. Perioden des Jugendalters
- 2.2. Entwicklungspsychologische Aspekte der Adoleszenz
- 2.3. Soziologische Aspekte der Jugendphase
- 2.3.1. Gesellschaftlicher Wandel als Katalysator der Jugendphase
- 2.3.2. Neuvermessung der Jugendphase
- 2.4. Sozialisationstheoretische Aspekte der Jugendphase
- 2.4.1. Die Gleichaltrigen als jugendlicher Lebensbereich
- 2.4.2. Das Elternhaus als jugendlicher Lebensbereich
- 2.4.3. Die Bildungseinrichtungen als jugendlicher Lebensbereich
- 2.4.4. Die Freizeit als jugendlicher Lebensbereich
- 2.1. Jugend als wissenschaftliches Konstrukt
- 3. Jugendlicher Drogenkonsum als funktionale Verhaltensweise
- 3.1. Substanzgebrauch als Risikoverhaltensweise
- 3.1.1. Das mehrdimensionale Entstehungsmodell juvenilen Risikoverhaltens
- 3.1.2. Substanzgebrauch als Bewältigungshandeln
- 3.2. Prävalenzen jugendlichen Rauschmittelkonsums
- 3.2.1. Der Jugendgesundheitssurvey 2003
- 3.2.2. Studie „Moderne Drogen- und Suchtprävention“ (MODRUS I, II) 2000
- 3.2.3. Drogenaffinitätsstudie 2004
- 3.3. Funktionen und Motivationen jugendlichen Rauschmittelkonsums
- 3.1. Substanzgebrauch als Risikoverhaltensweise
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den jugendlichen Drogenkonsum als funktionale Verhaltensweise. Ziel ist es, die komplexen Zusammenhänge zwischen Jugendphase, gesellschaftlichen Einflüssen und dem Substanzgebrauch zu beleuchten. Die Arbeit analysiert sowohl pharmakologische und rechtliche Aspekte des Drogenkonsums als auch verschiedene Erklärungsansätze für dessen Entstehung.
- Pharmakologische und rechtliche Rahmenbedingungen des Drogenkonsums
- Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte der Jugendphase
- Erklärungsansätze für jugendlichen Drogenkonsum (individuell, gesellschaftlich, multifaktoriell)
- Prävalenzen des jugendlichen Rauschmittelkonsums anhand verschiedener Studien
- Funktionen und Motivationen des jugendlichen Substanzgebrauchs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Jugend und Drogen ein und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas hervorgehoben und die methodische Vorgehensweise kurz erläutert. Die Arbeit untersucht den jugendlichen Substanzgebrauch nicht als pathologisches Phänomen, sondern als mögliche funktionale Verhaltensweise im Kontext der Adoleszenz.
1. Theoretische Annäherung an das Thema Drogen: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über Drogen aus pharmakologischer und rechtlicher Sicht. Es werden verschiedene Substanzgruppen (sedierend, halluzinogen, stimulierend, synthetisch) klassifiziert und ihre Wirkungen beschrieben. Der rechtliche Rahmen wird durch die Erläuterung relevanter Gesetze und Strategien auf europäischer und bundesdeutscher Ebene eingegrenzt. Schließlich werden verschiedene Erklärungsansätze für Drogengebrauch, -missbrauch und -abhängigkeit vorgestellt, von individuum- über gesellschaftszentrierte bis hin zu multifaktoriellen Modellen.
2. Annäherung an die Spezifik der Jugend: Dieses Kapitel beleuchtet die Jugendphase als eigenständiges Entwicklungsabschnitt. Es werden wissenschaftliche Konstrukte von Jugend, entwicklungspsychologische Aspekte der Adoleszenz und soziologische Perspektiven auf die Jugendphase diskutiert. Die Bedeutung von Sozialisationsprozessen im Kontext von Familie, Gleichaltrigen und Bildungseinrichtungen wird umfassend dargestellt. Gesellschaftliche Veränderungen und strukturelle Einflüsse auf die Jugend werden berücksichtigt, um ein vielschichtiges Bild der Jugendphase zu zeichnen.
3. Jugendlicher Drogenkonsum als funktionale Verhaltensweise: Dieses Kapitel untersucht den jugendlichen Drogenkonsum als potenziell funktionale Verhaltensweise im Kontext der Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz und möglicher Bewältigungsstrategien. Es werden Ergebnisse verschiedener Studien (Jugendgesundheitssurvey, MODRUS, Drogenaffinitätsstudie) zur Prävalenz des Rauschmittelkonsums bei Jugendlichen präsentiert und interpretiert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Funktionen und Motivationen hinter dem Substanzgebrauch, die im Zusammenhang mit Risikoverhalten und Bewältigung von Belastungen stehen.
Schlüsselwörter
Jugend, Drogenkonsum, Substanzgebrauch, Risikoverhalten, Adoleszenz, Entwicklungspsychologie, Soziologie, Prävalenz, Erklärungsansätze, Sucht, Abhängigkeit, Sozialisation, Bewältigung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Funktionale Verhaltensweise.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Jugendlicher Drogenkonsum als funktionale Verhaltensweise"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den jugendlichen Drogenkonsum nicht als pathologisches Phänomen, sondern als potenziell funktionale Verhaltensweise im Kontext der Adoleszenz. Sie beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Jugendphase, gesellschaftlichen Einflüssen und dem Substanzgebrauch.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt pharmakologische und rechtliche Aspekte des Drogenkonsums, entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte der Jugendphase, verschiedene Erklärungsansätze für jugendlichen Drogenkonsum (individuell, gesellschaftlich, multifaktoriell), Prävalenzen des jugendlichen Rauschmittelkonsums anhand verschiedener Studien und die Funktionen und Motivationen des jugendlichen Substanzgebrauchs.
Welche Drogen werden betrachtet?
Die Arbeit klassifiziert verschiedene Substanzgruppen, darunter sedierende, halluzinogene, stimulierende und synthetische Rauschmittel, und beschreibt deren Wirkungen. Der Fokus liegt jedoch nicht auf einzelnen Substanzen, sondern auf dem jugendlichen Konsumverhalten im Allgemeinen.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt den rechtlichen Rahmen des Drogenkonsums, indem sie relevante Gesetze und Strategien auf europäischer und bundesdeutscher Ebene erläutert.
Welche Erklärungsansätze für Drogenkonsum werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Erklärungsansätze für Drogengebrauch, -missbrauch und -abhängigkeit: individuumzentrierte, gesellschaftszentrierte und multifaktorielle Modelle.
Welche Entwicklungspsychologischen und Soziologischen Aspekte der Jugend werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die Jugendphase als eigenständigen Entwicklungsabschnitt. Wissenschaftliche Konstrukte von Jugend, entwicklungspsychologische Aspekte der Adoleszenz und soziologische Perspektiven auf die Jugendphase werden diskutiert. Die Bedeutung von Sozialisationsprozessen im Kontext von Familie, Gleichaltrigen und Bildungseinrichtungen wird umfassend dargestellt. Gesellschaftliche Veränderungen und strukturelle Einflüsse auf die Jugend werden berücksichtigt.
Welche Studien werden zur Prävalenz des jugendlichen Rauschmittelkonsums herangezogen?
Die Arbeit präsentiert und interpretiert Ergebnisse verschiedener Studien zur Prävalenz des Rauschmittelkonsums bei Jugendlichen, darunter der Jugendgesundheitssurvey 2003, die Studie „Moderne Drogen- und Suchtprävention“ (MODRUS I, II) 2000 und die Drogenaffinitätsstudie 2004.
Wie wird jugendlicher Drogenkonsum in dieser Arbeit betrachtet?
Jugendlicher Drogenkonsum wird in dieser Arbeit als potenziell funktionale Verhaltensweise im Kontext der Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz und möglicher Bewältigungsstrategien untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse der Funktionen und Motivationen hinter dem Substanzgebrauch, die im Zusammenhang mit Risikoverhalten und Bewältigung von Belastungen stehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugend, Drogenkonsum, Substanzgebrauch, Risikoverhalten, Adoleszenz, Entwicklungspsychologie, Soziologie, Prävalenz, Erklärungsansätze, Sucht, Abhängigkeit, Sozialisation, Bewältigung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Funktionale Verhaltensweise.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Einleitung, Kapitel zu theoretischen Annäherungen an das Thema Drogen, Kapitel zur Spezifik der Jugend, Kapitel zum jugendlichen Drogenkonsum als funktionale Verhaltensweise und Resümee gegliedert. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
- Citar trabajo
- Chrystina Kunze (Autor), 2006, Jugend und Drogen - ein Spannungsverhältnis? , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75146