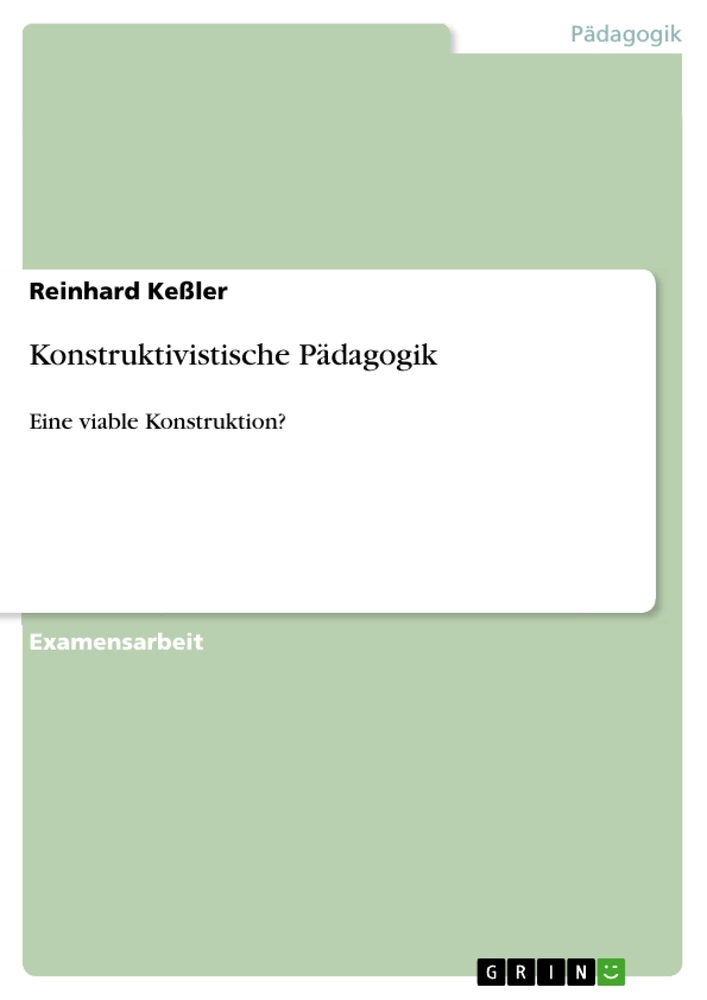Zur Begründung der These von der Konstruktion aller Kognition bedienen sich die Konstruktivisten eines Experimentes, welches dem Nachweis des blinden Fleckes auf der Retina dient. Die Tatsache, dass das Sichtfeld trotz nachweisbarer Unterbrechung zusammenhängend wahrgenommen wird, gilt ihnen als Beweis für den selbstreferentiellen Aufbau kognitiver Strukturen. „Man sieht nicht, dass man nichts sieht“, folgert von Förster und erklärt so das eigentliche Nichtsehen zum Ausgangspunkt konstruktiven, subjektspezifischen Sehens. Bereits auf der Ebene der empirischen Bezugswissenschaften schleicht sich jedoch eine Unschärfe in das konstruktivistische Denken ein, die den Grundstein für die sich anschließenden Erklärungsnotstände der Erkenntnistheorie und ihrer pädagogischen Indienstnahme legt. Zwar vermag es die neurophysiologische Forschung, genaue Analysen der materiellen Beschaffenheit des Gehirns vorzulegen und Beschreibungsmodelle für den Transfer sinnlicher Wahrnehmungsimpulse in die subjektspezifische Systemstruktur des Gehirns zu entwickeln, die Unmöglichkeit jedoch, die gehirninterne Hervorbringung individueller Wahrnehmungsresultate durch die Verknüpfung gegenwärtig erlebter und in der Vergangenheit bereits verarbeiteter Sinneseindrücke nachzuzeichnen, beschreibt ein Nichtsehen, dass dem blinden Fleck auf der Retina insofern ähnelt, als sich auch diesem nur durch die entkräftende Überlagerung mit dem Sichtbaren begegnen lässt. Die Verabsolutierung der These der strukturdeterminierten Kognition wird so zur zwingenden Notwendigkeit einer Neurophysiologie, die ihr Sehen der Sichtbarkeit materieller Spezifik verdankt. Im ersten Teil dieses Textes werden sowohl die neurobiologischen Grundlagen als auch die sich aus ihnen ableitenden konstruktivistischen Thesen dargestellt.
Das Kompensationsverhalten setzt sich auf der Ebene des Pädagogischen in einem zugespitzten Modus fort. Um pädagogische Handlungsfelder in die konstruktivistische Theorie aufnehmen zu können, müssen inhärente Setzungen durch inkonsistente Zugriffe umgedeutet werden. Die terminologisch erneuerte Verabsolutierung eines selbstgesteuerten Lernprozesses führt die konstruktivistische Pädagoik jedoch in die Affirmation der Zugriffsstrukturen einer ökonomisierten Gesellschaft. Welche Gestalt die konstruktivistische Pädagogik unter diesen Bedingungen annimmt und welche pädagogische Relevanz dem konstruktivistischen Denken zukommt wird im zweiten Teil dieses Textes analytisch- kritisch beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil I: Konstruktivistische Erkenntnistheorie und ihre Überführung in die Pädagogik
- 2. Empirische Fundamente.
- 2.1 Kognitionsbiologische Ansätze und gehirnphysiologische Argumente
- 2.2 Autopoietische Systeme
- 2.3 Sprache und Bewusstsein
- 3. Konstruktivistische Konsequenzen.
- 3.1 Erkenntnistheoretische Konsequenzen.
- 3.2 Das Viabilitätskonzept.
- 3.3 Ethische Konsequenzen...
- 4. Konstruktivistische Pädagogik.....
- 4.1 Anthropologische Grundlagen und die Modellierung des Subjekts...
- 4.2 Konstruktivistische Lehr- und Lerntheorie......
- 4.2.1 Lernen..........\li>
- 4.2.2 Kommunizieren........
- 4.2.3 Lehren...........
- 4.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse.…......
- 4.3 Konstruktivistische Didaktik.
- 4.3.1 Die konstruktivistische Unterrichtssituation.
- 4.3.1.1 Die Modellierung der Inhalte
- 4.3.1.2 Die Modellierung der unterrichtlichen Beziehungen
- 4.3.2 Die konstruktivistische Unterrichtsgestaltung
- 4.3.3 Konstruktivistische Unterrichtsziele und -inhalte
- 4.3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse..........\li>
- Teil II: Kritik der konstruktivistischen Erkenntnistheorie und ihrer pädagogischen Indienstnahme ………………………..\n
- 5. Unschärfen konstruktivistischer Erkenntnistheorie
- 5.1 Konstruktivistische Theoriebildung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
- 5.2 Die logischen Inkonsistenzen konstruktivistischer Erkenntnistheorie
- 5.2.1 Die konstruktivistische Behauptung eigener Geltung
- 5.2.2 Der konstruktivistische Blick auf die empirischen Wissenschaften.............
- 5.3 Kritik der viabilistischen Wahrnehmungskonzeption
- 5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6. Kritik konstruktivistischer Pädagogik.
- 6.1 Die Konstruktivität aller Kognition und der homo materia
- 6.2 Kritik der konstruktivistischen Lehr- und Lerntheorie…........
- 6.2.1 Unbestimmtes Lernen.
- 6.2.2 Aporien konstruktivistischer Kommunikation
- 6.2.3 Die Entprofessionalisierung der Lehre.
- 6.3 Kritik konstruktivistischer Didaktik.
- 6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7. Schlussbetrachtungen..........\li>
- Die konstruktivistische Erkenntnistheorie und ihre Überführung in die Pädagogik.
- Die empirischen Fundamente und ihre Bedeutung für die konstruktivistische Theorie.
- Die Konsequenzen des konstruktivistischen Erkenntnisverständnisses für die pädagogische Praxis.
- Kritik an der konstruktivistischen Erkenntnistheorie und ihren pädagogischen Implikationen.
- Schlussfolgerungen und Beurteilung der Viabilität der konstruktivistischen Pädagogik.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Konstruktivistische Pädagogik – eine viable Konstruktion?“ setzt sich zum Ziel, die konstruktivistische Erkenntnistheorie und ihre pädagogischen Implikationen zu untersuchen. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die empirischen Fundamente und die Folgen für das Verständnis von Lernen, Lehren und der Gestaltung von Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der konstruktivistischen Pädagogik ein und stellt den Forschungsgegenstand sowie die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den Anspruch der konstruktivistischen Pädagogik, einen Paradigmenwechsel in der Didaktik zu vollziehen, und kritisiert die Abkehr von einer objektiven Wirklichkeit.
Teil I beschäftigt sich mit der konstruktivistischen Erkenntnistheorie und ihren pädagogischen Implikationen. Kapitel 2 erläutert die empirischen Fundamente der Theorie und beleuchtet kognitionsbiologische Ansätze, autopoietische Systeme und die Rolle von Sprache und Bewusstsein.
Kapitel 3 analysiert die konstruktivistischen Konsequenzen für die Erkenntnistheorie, das Viabilitätskonzept und die ethischen Implikationen. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der konstruktivistischen Pädagogik und ihren anthropologischen Grundlagen, der konstruktivistischen Lehr- und Lerntheorie sowie der konstruktivistischen Didaktik.
Teil II widmet sich der Kritik an der konstruktivistischen Erkenntnistheorie und ihren pädagogischen Implikationen. Kapitel 5 beleuchtet Unschärfen und logische Inkonsistenzen der Theorie und kritisiert die viabilistische Wahrnehmungskonzeption.
Kapitel 6 analysiert die Kritik an der konstruktivistischen Pädagogik, insbesondere die Kritik an der Konstruktivität aller Kognition, der konstruktivistischen Lehr- und Lerntheorie und der konstruktivistischen Didaktik.
Schlüsselwörter
Konstruktivistische Pädagogik, Erkenntnistheorie, Viabilität, Empirische Fundamente, Kritik, Lehr- und Lerntheorie, Didaktik, Unterricht, Subjekt, Objektivität, Intersubjektivität, Perturbation, Paradigmenwechsel, Wissensvermittlung, Wissenwerwerb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernbehauptung der konstruktivistischen Pädagogik?
Sie behauptet, dass Wissen nicht objektiv vermittelt werden kann, sondern dass jeder Lernende Informationen basierend auf seinen eigenen kognitiven Strukturen individuell konstruiert.
Was bedeutet "Viabilität" in diesem Kontext?
Viabilität ersetzt den Begriff der Wahrheit. Eine Konstruktion gilt als viabel (gangbar), wenn sie in der Erfahrungswelt des Subjekts funktioniert und zur Problemlösung beiträgt.
Welche Rolle spielen neurobiologische Grundlagen?
Konstruktivisten nutzen Erkenntnisse über das Gehirn (z.B. den blinden Fleck), um zu argumentieren, dass das Gehirn ein selbstreferentielles System ist, das seine eigene Realität erzeugt.
Wie verändert der Konstruktivismus die Rolle des Lehrers?
Der Lehrer ist kein Wissensvermittler mehr, sondern ein Begleiter oder "Lernumgebungsgestalter", der Perturbationen (Anstöße) liefert, um Lernprozesse beim Schüler auszulösen.
Was wird an der konstruktivistischen Pädagogik kritisiert?
Kritikpunkte sind unter anderem logische Inkonsistenzen (der Anspruch auf eigene Geltung bei gleichzeitiger Leugnung objektiver Wahrheit) und die Gefahr einer Entprofessionalisierung der Lehre.
- Quote paper
- Reinhard Keßler (Author), 2006, Konstruktivistische Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75367