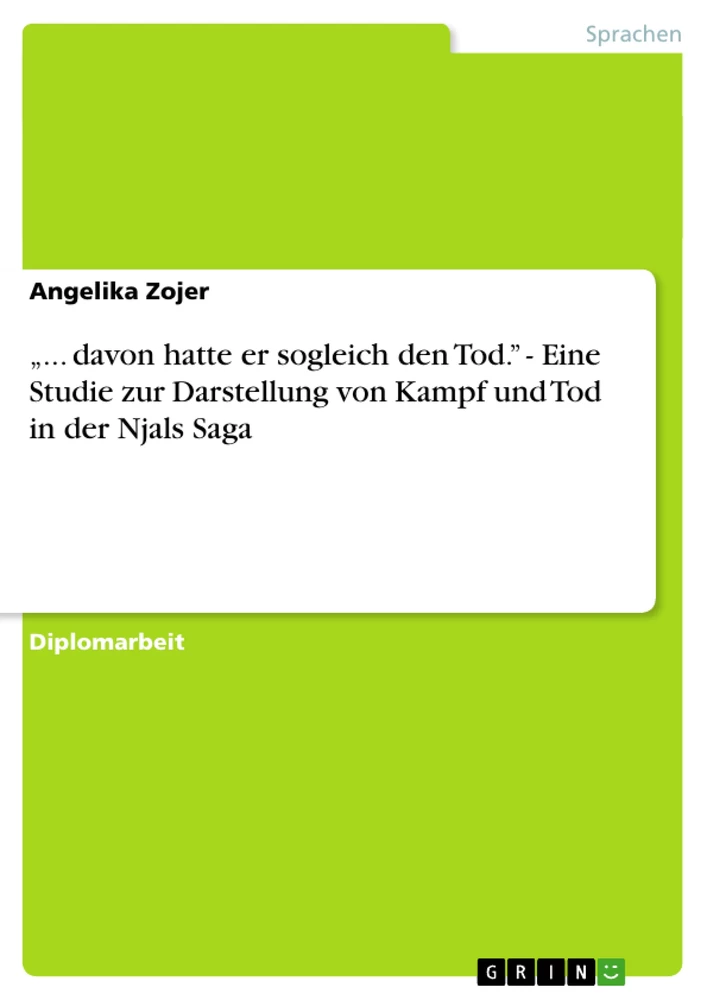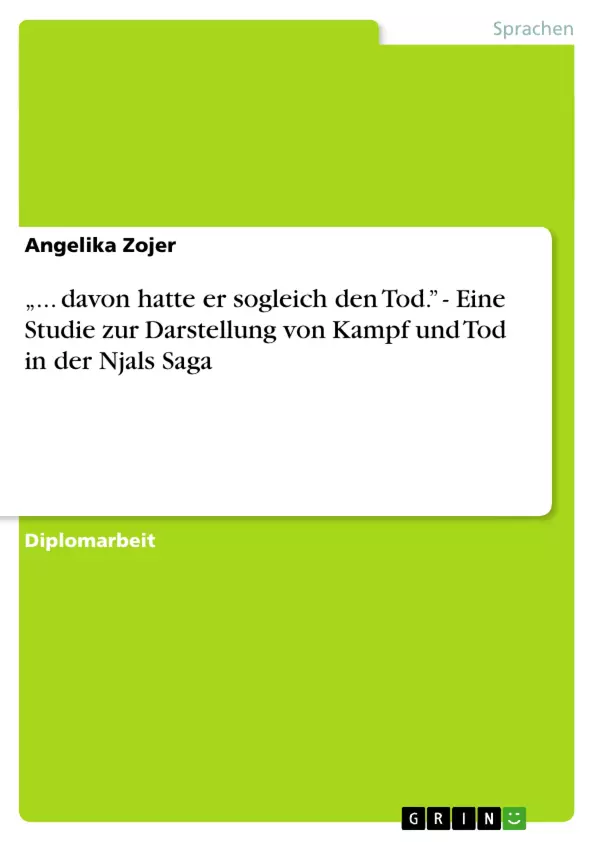Wer sich dem Genuss von Sagaliteratur hingibt, wird – bisweilen mit Erschrecken –feststellen, dass sie in vielen Fällen einen nahezu unerträglich detailgetreuen Realismus in der Darstellung der Kampfszenen aufweist. Ganz im Gegensatz zur Heldendichtung etwa, die derartig anarchisch brutalen Schilderungen selten nähere Aufmerksamkeit widmet.
Es stellt sich also das Bedürfnis ein, nach Prinzipien und Bedingungen des kriegerischen Handelns und infolge nach dessen Darstellung zu fragen:
Wie wird mit dem Gegner umgegangen, gibt es ethische, den Aggressionen Einhalt gebietende Normen? Existiert ein moralisches Bewusstsein, das solches Treiben verurteilt, oder wird es als gegeben hingenommen?
Sagas stehen oft unter dem Verdikt der Grobschlächtigkeit. Warum erfreuten sich Schilderungen von offensichtlich in Szene gesetzter Gewalt derartiger Beliebtheit, wie erlangten sie ihren beachtlichen Stellenwert in der Sagaliteratur? Lässt sich die Ergötzung am Tode mit den christlichen Idealen vereinbaren? Welche Rolle spielen Autor und Publikum, kann man von einer wechselseitigen Kommunikation sprechen? Lässt sich innerhalb der Kampf- und Todesdarstellungen eine Rezipientenlenkung erkennen oder gar eine Erzählkonvention feststellen?
Trotz dieser – zugegebenermaßen weit gefassten – Fragestellung wagte ich mich an die wohl beliebteste, wahrscheinlich am häufigsten analysierte Saga der Isländer heran, an die Brennú Njals Saga.
Inhaltsverzeichnis
- Geleitwort
- 1.) Einleitung
- 2.) Über die NJALSSAGA
- 2.1) Einführendes zu Herkunft, Tradition, Quellenlage und Forschungsgeschichte
- 2.1.1) Alter, Handschriften, Ausgaben
- 2.1.2) Quellen
- 2.1.3) Schauplätze
- 2.2) Äquivalenzliste der in der Abhandlung vorkommenden, deutsch gebrauchten Eigennamen
- 2.3) Soziogramm der handlungstragenden Personen
- 2.4) Inhalt
- 2.5) Das Umfeld der Entstehung
- 2.5.1) Historischer Hintergrund
- 2.5.2) Sozialer Hintergrund
- a) Der soziale Kontext der Sagaproduktion
- b) Die NJÁLA und die Familie der Svínfellingar
- c) Der Autor und sein Publikum
- 3.) Sagatradition und Erzählkunst: Auswirkungen auf Publikum und Autor
- 3.1) Grundsätze der Sagatradition
- 3.2) Objektive Erzählweise und Rezipientenlenkung – zwei sich ausschließende Gegensätze?
- 3.3) Rhetorik im Dienste der Manipulation?
- Exkurs: Der NEKROLOG - ein rhetorisches Werkzeug zur Rezipientenlenkung?
- 4.) Die FEHDE - Das Gerüst der Saga?
- 4.1) Verwurzelung in der Bevölkerung
- 4.2) Eigenheiten und Merkmale - Versuch einer Definition
- 4.3) Die FEHDEN der Njála
- 4.3.1) ,,Dramatische Rollen" als Konfliktträger
- 4.3.2) Die Konfliktkonstellationen der Njalssaga
- 4.4) Grenzen und Normen, Moral und Ethik
- 4.4.1) Blutige Details – allzeit willkommen oder nur situationsbedingt akzeptiert?
- 4.4.2) Rache-Normen und Wiedergutmachung
- 5.) Wie stirbt „Mann“ in der Njalssaga
- 5.1) Todesthema HOLMGANG
- 5.2) Todesthema HINTERHALT
- 5.2.1) Analyse der Kampfsequenzen des Typus HINTERHALT
- 5.3) Todesthemen ATTENTAT und AFFEKT-TOTSCHLAG
- 5.3.1) Analyse der Kampfsequenzen des Typus ATTENTAT und AFFEKT-TOTSCHLAG
- 5.4) Das Todesthema ÜBERFALL
- 5.4.1) Analyse der Kampfsequenzen des Typus ÜBERFALL
- 5.4.2) Analyse der auf den Mordbrand folgenden Textstellen, um Funktion und Zugang zu Gewaltdarstellungen zu verdeutlichen
- 5.5) Das Todesthema SCHLACHT/GRUPPENKAMPF
- 5.5.1) SCHLACHT: Erläuterung und Analyse der Kampfsequenzen
- 5.5.2) SEESCHLACHT: Erläuterung und Analyse der Kampfsequenzen
- 5.5.3) LANDSCHLACHT: Erläuterung und Analyse der Kampfsequenzen
- 5.5.4) GRUPPENKAMPF: Erläuterung und Analyse der Kampfsequenzen
- 5.6) Todesthema ÜBERSINNLICHES
- 5.6.1) Analyse der Textstellen, in denen ÜBERSINNLICHES eine Rolle spielt
- 5.7) Erwähnung von Krankheit-und-Alter-Todes, Unglücken und thematisch unklare Todesdarstellungen
- 5.7.1) Analyse der Textstellen der Typen KRANKHEIT-UND-ALTER-TOD, UNGLÜCK und THEMATISCH UNKLARE TODESDARSTELLUNGEN
- 6.) Die Kampfschilderungen der Njála – Einzigartige Stilblüten oder Gemeingut der Sagatradition?
- 6.1) Vergleichsbeispiel I: Die LAXDÖLASAGA
- 6.1.1) Zur LAXDÖLASAGA
- 6.1.2) Komparative Analyse der Kampf- und Todesdarstellungen
- 6.1.3) Resümee
- 6.2) Vergleichsbeispiel II: Die Sturlungasaga
- 6.2.1) Zur STURLUNGASAGA
- 6.2.2) Komparative Analyse der Kampf- und Todesdarstellungen
- 6.2.3) Resümee
- 7.) Einstellung der Protagonisten zu Kampf und Todesrisiko: Vergleich mit abendländischer Denkweise und zeitgenössischer Literatur des europäischen Mittelalters
- 7.1) Zur Einstellung der Nordmänner
- 7.2) Denktraditionen des Abendlandes
- 7.2.1) Kampf und Tod - Fiktionale Literatur des abendländischen Mittelalters
- 8.) Mord, Totschlag und Christentum – ein unvereinbarer Widerspruch?
- 9.) Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „davon hatte er sogleich den Tod“ - Eine Studie zur Darstellung von Kampf und Tod in der Njalssaga beschäftigt sich mit der Analyse der Kampfschilderungen in der Njalssaga. Das Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Arten des Kampfes und des Todes in der Saga zu untersuchen und deren Bedeutung für die Handlung, die Figuren und die Welt der Saga zu erforschen.
- Die Rolle des Todes in der Njalssaga
- Die Darstellung von Kampf und Gewalt in der Saga
- Der Einfluss der Sagatradition auf die Gestaltung des Textes
- Die Beziehung zwischen Konflikt, Rache und Moral in der Njalssaga
- Der Vergleich der Kampfschilderungen in der Njalssaga mit anderen Sagas
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Njalssaga ein und liefert Informationen zu ihrer Entstehung, ihren Quellen und ihrem Umfeld. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Sagatradition und der Erzählkunst der Njalssaga. Dabei werden die Prinzipien der Sagatradition erläutert sowie die Frage, ob objektive Erzählweise und Rezipientenlenkung einander ausschließen. Kapitel drei untersucht die Rolle der Fehde in der Njalssaga, ihre Verwurzelung in der Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Handlung. Die verschiedenen Konfliktkonstellationen der Saga werden analysiert und die Grenzen zwischen Rache und Wiedergutmachung werden beleuchtet.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung des Todes in der Njalssaga, die verschiedenen Arten des Todes und die mit ihnen verbundenen Kampfsequenzen werden analysiert. Dazu gehören Tod durch Holmgang, Hinterhalt, Attentat, Überfall, Schlacht und Übersinnliches.
Kapitel fünf untersucht die Kampfschilderungen in der Njalssaga und vergleicht sie mit denen in anderen Sagas, insbesondere mit der Laxdæla saga und der Sturlunga saga. Dabei wird die Frage untersucht, ob die Kampfschilderungen der Njalssaga einzigartige Stilblüten darstellen oder Gemeingut der Sagatradition sind.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Einstellung der Protagonisten zu Kampf und Todesrisiko und vergleicht diese mit abendländischer Denkweise und zeitgenössischer Literatur des europäischen Mittelalters.
Schlüsselwörter
Njalssaga, Sagatradition, Kampf, Tod, Fehde, Gewalt, Rache, Wiedergutmachung, Holmgang, Hinterhalt, Attentat, Überfall, Schlacht, Übersinnliches, Laxdæla saga, Sturlunga saga, Nordmänner, abendländische Denkweise, europäisches Mittelalter, Christentum.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Kampfszenen in der Njals Saga so realistisch dargestellt?
Die Sagaliteratur nutzt einen detailgetreuen Realismus, um die Härte des Lebens und die Konsequenzen von Fehden greifbar zu machen. Dies diente der Rezipientenlenkung und entsprach dem Geschmack des zeitgenössischen Publikums.
Was ist ein 'Holmgang' in der Saga?
Der Holmgang war ein ritueller Zweikampf, der oft zur rechtlichen Klärung von Streitigkeiten oder zur Wiederherstellung der Ehre eingesetzt wurde und häufig tödlich endete.
Welche Rolle spielt die Blutrache in der Njals Saga?
Die Fehde und die damit verbundene Rache bilden das strukturelle Gerüst der Saga. Sie zeigen die moralischen und ethischen Normen der isländischen Gesellschaft, in der Ehre oft über dem Leben stand.
Wie vertragen sich Gewalt und Christentum in der Saga?
Die Saga entstand in einer Übergangszeit. Während Gewalt als soziales Mittel akzeptiert war, thematisiert die Saga auch christliche Ideale wie Vergebung, was einen spannungsvollen Kontrast in der Erzählung bildet.
Was versteht man unter 'Rezipientenlenkung' in diesem Kontext?
Der Autor nutzt Techniken wie Nekrologe oder rhetorische Mittel, um die Sympathien des Lesers für bestimmte Figuren zu steuern und die moralische Bewertung von Kampfhandlungen zu beeinflussen.
- Citar trabajo
- Angelika Zojer (Autor), 2005, „... davon hatte er sogleich den Tod.” - Eine Studie zur Darstellung von Kampf und Tod in der Njals Saga, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75377