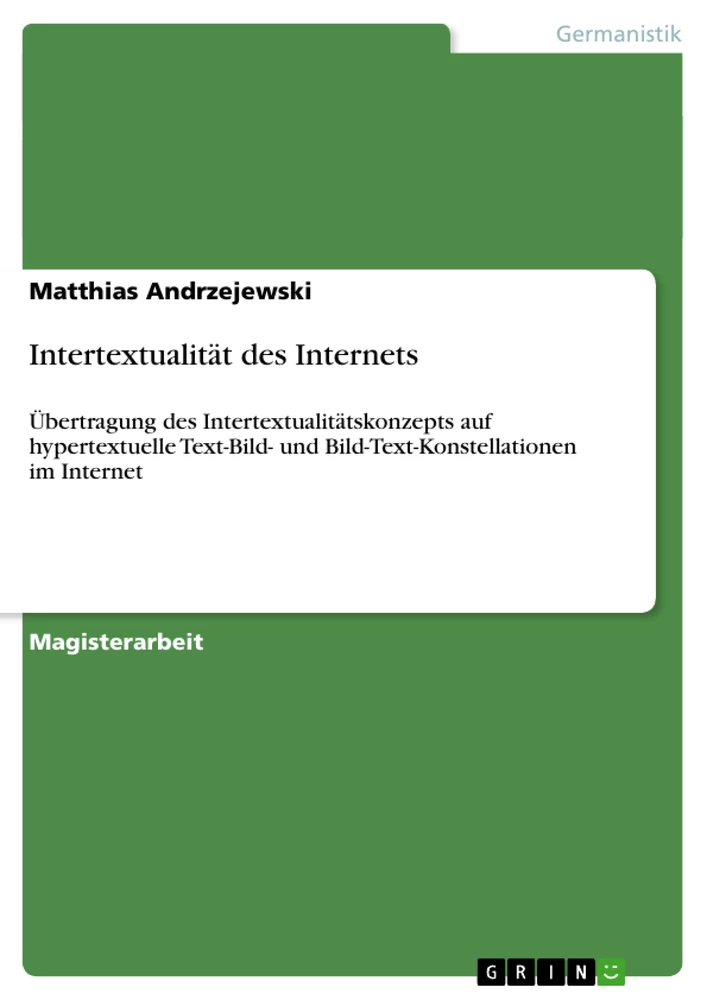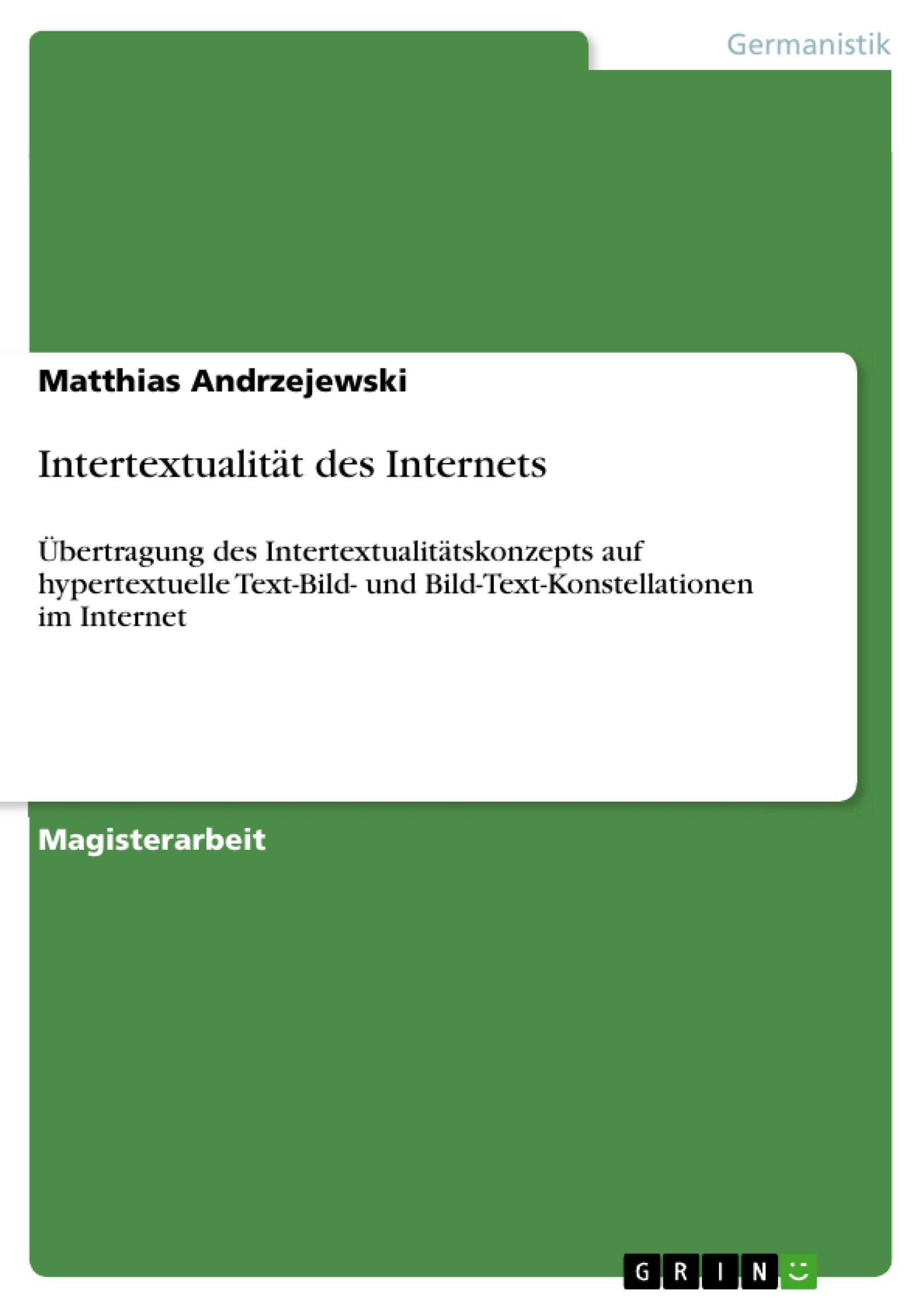In der Auseinandersetzung mit dem Internet und literaturtheoretischen Begriffen wie der Intertextualität liegt die Herausforderung in der Zusammenführung eines globalisierten kulturellen Phänomens und einem theoretischen Konstrukt nicht in der Schwierigkeit dieses Vorhabens, sondern in dessen scheinbarer Einfachheit. In der digitalen globalen Vernetzung, der ständigen Verfügbarkeit von Informationen und dem immensen Informationsangebot scheint die Intertextualität im Hypertext des Internets ihre Bestimmung gefunden zu haben.
Neben der Schrift erfahren auch das Bild und der Ton durch ihre Digitalisierung, ja sogar die Interaktivität selbst, die der Prozess, gleichsam der Motor des multimedialen Informationsaustausches ist, eine semiotische Neuordnung, in der Weise, dass sie auf dieselbe binäre Signifikantenstruktur verweisen und auf einer weiteren Ebene unmittelbar Bezeichnendes eines Signifikaten sind. Eben diese semiotische und strukturelle Homogenität der digitalisierten Medien ermöglicht die Konzipierung von Text-Bild-Ton-Konstellationen, die eine multisensorielle Rezeption der daraus resultierenden Werke verlangt.
Doch inwieweit erfüllen Text und Bild im Internet die semiotischen Anforderungen der Intertextualität/-medialität und können Text und Bild mit steigendem Grad der Intensivierung hypertextueller Möglichkeiten mit dem Intertextualitätskonzept vereinbart werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 2.1 Internet Plattform oder Medium?
- 2.2 Intertextualität und Intermedialität
- 2.2.1 Text
- 2.2.2 Bild
- 2.2.3 Intertextualität
- 2.2.3.1 Bachtin
- 2.2.3.2 Kristeva
- 2.2.3.3 Genette
- 2.2.3.4 Einzeltextreferenz, Systemreferenz und die „Bezogenheit auf eine Sache“
- 2.2.4 Intermedialität
- 2.3 Hypertextualität
- 2.3.1 Idealer Hypertext und fehlende Kommunikation
- 2.3.2 Hypertextuelle Intermedialität, die Homogenität und ihre Lesbarkeit
- 3. Textualität und Bildlichkeit im Hypertext
- 3.1 hyperlink
- 3.2 Das Bild im Internet
- 3.2.1 Elektronisches und digitales Bild
- 3.2.2 Netzbild
- 3.2.3 hyperimage
- 3.2.3.1 hyperimages im Internet – Ein Beispiel
- 3.3 Digitaler Text und Textformen im Internet
- 3.3.1 Netzliteratur
- 3.3.2 Hyperliteratur
- 4. Inter-/Hypertextuelle Synthese von Text und Bild
- 4.1 Netzkunst
- 4.2 Hyperfiction
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Übertragbarkeit des Intertextualitätskonzepts auf hypertextuelle Text-Bild- und Bild-Text-Konstellationen im Internet. Ziel ist die Klärung des Verhältnisses von Intertextualität und Hypertext im digitalen Raum, unter Berücksichtigung der multimedialen Natur des Internets. Die Arbeit analysiert, inwieweit Text und Bild die semiotischen Anforderungen der Inter-/Hypertextualität erfüllen.
- Der mediale Status des Internets und seine Auswirkungen auf Intertextualität und Intermedialität.
- Die Definition und Abgrenzung von Intertextualität und Intermedialität im Kontext des Internets.
- Analyse von Text- und Bildformen im digitalen Raum (Netzliteratur, Hyperliteratur, Netzbild, hyperimage).
- Untersuchung der Synthese von Text und Bild in der Netzkunst und Hyperfiction.
- Überprüfung der Vereinbarkeit von Text und Bild mit dem Intertextualitätskonzept im hypertextuellen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die scheinbar einfache, aber herausfordernde Aufgabe, das globalisierte Phänomen Internet mit dem literaturtheoretischen Konzept der Intertextualität zu verbinden. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Hypertext und Intertextualität im Internet und betont die multimediale Natur des Internets mit seinen Text-Bild-Ton-Konstellationen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Text-Bild- und Bild-Text-Hypertextkonzepten und der Rolle von Netzkunst und Hyperfiction.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel widmet sich der Abgrenzung zentraler Begriffe. Es kategorisiert das Internet als Medium, analysiert die Transformation verschiedener Medienformen im digitalen Raum und definiert die Begriffe „Text“ und „Bild“. Es werden verschiedene Intertextualitätskonzepte (Bachtin, Kristeva, Genette) sowie der Begriff der Intermedialität diskutiert, um eine einheitliche Terminologie für die spätere Analyse zu schaffen. Besonders Gérard Genettes „Transtextualität“ und deren Unterkategorie „Hypertextualität“ werden im Verhältnis zum literarischen und technischen Hypertextbegriff beleuchtet.
3. Textualität und Bildlichkeit im Hypertext: Kapitel 3 untersucht die Textualität und Bildlichkeit im Kontext des Internets. Es analysiert den Hyperlink als Verknüpfungselement, verschiedene Formen des digitalen Bildes (elektronisches, digitales, Netzbild, hyperimage) und digitale Textformen (Netzliteratur, Hyperliteratur). Die Kapitel beleuchtet die spezifischen Eigenschaften von Text und Bild im digitalen Netzwerk und deren Darstellung in hypertextuellen Strukturen.
4. Inter-/Hypertextuelle Synthese von Text und Bild: In diesem Kapitel werden die Synthese von Text und Bild im Internet im Kontext von Netzkunst und Hyperfiction untersucht. Es analysiert die intermedialen Strukturen und die Interaktion zwischen Rezipienten und Autoren, oft innerhalb des Produktionsprozesses des Werks. Die Beispiele von Netzbild, hyperimage, Netzliteratur, Hyperliteratur, Netzkunst und Hyperfiction dienen als Grundlage für die Übertragung des Intertextualitätskonzepts auf das Internet und die Untersuchung dessen (literarischer) Hypertextualität.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Intermedialität, Hypertext, Internet, Digitalisierung, Text, Bild, Netzkunst, Hyperfiction, Netzliteratur, Hyperliteratur, Genette, Bachtin, Kristeva, multimediale Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Intertextualität und Hypertext im Internet
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Übertragbarkeit des Intertextualitätskonzepts auf hypertextuelle Text-Bild- und Bild-Text-Konstellationen im Internet. Sie analysiert das Verhältnis von Intertextualität und Hypertext im digitalen Raum und berücksichtigt die multimediale Natur des Internets. Ein Fokus liegt auf der Analyse, inwieweit Text und Bild die semiotischen Anforderungen der Inter-/Hypertextualität erfüllen.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und grenzt zentrale Begriffe wie Internet (als Medium), Intertextualität, Intermedialität, Hypertextualität, Text und Bild im digitalen Kontext ab. Verschiedene Intertextualitätskonzepte von Bachtin, Kristeva und Genette werden diskutiert, ebenso der Begriff der Transtextualität nach Genette und sein Verhältnis zum literarischen und technischen Hypertextbegriff.
Welche Medienformen und -typen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Text- und Bildformen im digitalen Raum, darunter Netzliteratur, Hyperliteratur, Netzbild, hyperimage, Netzkunst und Hyperfiction. Der Hyperlink als Verknüpfungselement und die spezifischen Eigenschaften von Text und Bild im digitalen Netzwerk werden untersucht.
Wie wird die Synthese von Text und Bild im Internet behandelt?
Die Synthese von Text und Bild wird im Kontext von Netzkunst und Hyperfiction untersucht. Die Arbeit analysiert intermediale Strukturen und die Interaktion zwischen Rezipienten und Autoren, oft innerhalb des Produktionsprozesses. Beispiele für Netzbild, hyperimage, Netzliteratur, Hyperliteratur, Netzkunst und Hyperfiction dienen als Grundlage für die Übertragung des Intertextualitätskonzepts auf das Internet und die Untersuchung dessen (literarischer) Hypertextualität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfrage), Begriffsbestimmung (Definition zentraler Begriffe), Textualität und Bildlichkeit im Hypertext (Analyse von Text- und Bildformen im Internet), Inter-/Hypertextuelle Synthese von Text und Bild (Untersuchung von Netzkunst und Hyperfiction) und Fazit (Zusammenfassung der Ergebnisse).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Intertextualität, Intermedialität, Hypertext, Internet, Digitalisierung, Text, Bild, Netzkunst, Hyperfiction, Netzliteratur, Hyperliteratur, Genette, Bachtin, Kristeva, multimediale Rezeption.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie lässt sich das Konzept der Intertextualität auf hypertextuelle Text-Bild- und Bild-Text-Konstellationen im Internet übertragen? Die Arbeit untersucht dabei das Verhältnis von Hypertext und Intertextualität im digitalen Raum und berücksichtigt die multimediale Natur des Internets.
Welche Autoren werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Intertextualitätskonzepte von Michail Bachtin, Julia Kristeva und Gérard Genette.
- Citation du texte
- Matthias Andrzejewski (Auteur), 2004, Intertextualität des Internets, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75436