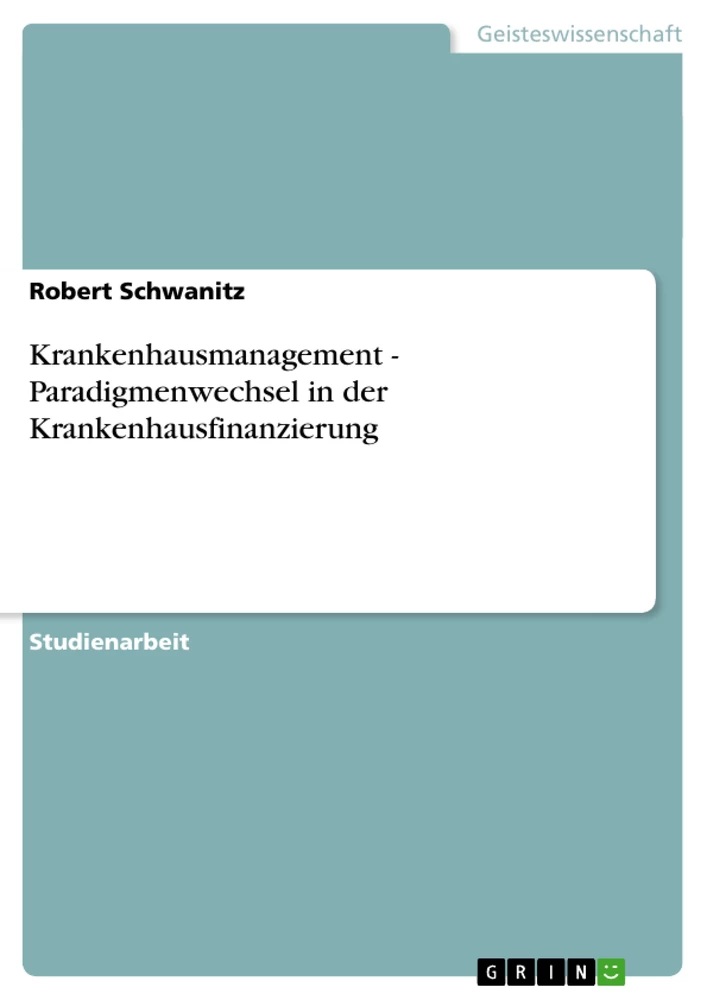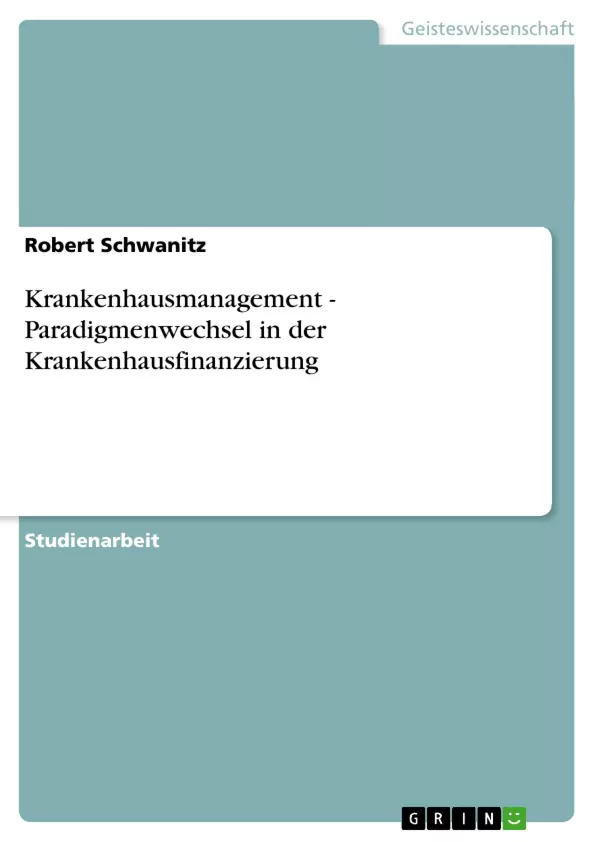Das deutsche Gesundheitssystem gilt allgemein als reformbedürftig. Gerade jetzt in diesen Tagen nimmt die große Koalition Anlauf, um erneut eine Reform auf den Weg zu bringen. Dabei ist es bemerkenswert, wie viele Versuche es in den vergangenen Jahrzehnten seitens deutscher Regierungen gegeben, und wie re-sistent sich das deutsche Gesundheitssystem v.a. gegenüber den Versuchen zur Kostenreduzierung erwiesen hat. Allein in den letzten 35 Jahren nahmen die Kosten im Gesundheitswesen um 1005% zu, während das Bruttoinlandsprodukt nur um 538% stieg. Gleichzeitig fiel der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im gleichen Zeitraum von 28,2 auf 26,1 Millionen (vgl. Spiegel Nr. 27, 19). Diese Zahlen verdeutlichen die Misere des deutschen Gesundheitssystems. Bei steigenden Kosten bricht die wichtigste Einnahmebasis der Gesetzlichen Krankernversicherung weg. Gleichzeitig wird unsere Bevölkerung im Durchschnitt älter und beansprucht immer teurere Leistungen einer moderner werdenden Medi-zin.
Der Fokus dieser Arbeit ist es aber nicht, das Gesundheitssystem, seine Ausgaben und Akteure in Gänze zu analysieren. Im Mittelpunkt soll hier nur ein Akteur stehen: die Institution Krankenhaus. Die Krankenhäuser sehen sich in den letzten Jahren verstärktem Druck ausgesetzt, der sie dazu zwingt, Strukturen und Pro-zesse an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Dieser Druck ist nicht das Resultat einer strukturellen Veränderung des Gesundheitssystems, sondern viel-mehr der Versuche zur Kostendämpfung im bestehenden System. Die Finanzie-rung der Institution Krankenhaus wird vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Die Einführung von Fallpauschalen, den so genannten Diagnosis Related Groups , zum Jahresbeginn 2003 stellt hier zweifellos die größte Veränderung dar. Gab es im Vorhinein speziell in den 90er Jahren eher zaghafte Versuche die Krankenhausfinanzierung zu reformieren, so steht das Fallpauschalengesetz vom 23.4.2002 für einen Paradigmenwechsel in diesem Bereich und für einen ersten strukturellen Eingriff in das seit 1972 bestehende System.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Krankenhausfinanzierung in Deutschland
- 1.1 Das System der dualen Finanzierung
- 1.2 Die bisherigen Versuche der Kostendämpfung
- 1.3 Das System der DRGs
- 1.4 Grundzüge und Begrifflichkeiten des DRG Systems
- 2. Praxisbeispiel: Die Implantation von ICDs
- 2.1 Was sind ICDs?
- 2.2 Kosten: ICD-Implantation vor und nach der DRG-Einführung
- 2.3 Aufgetretene Organisationsdefizite
- 2.3.1 Intern: Die OP-Planung
- 2.3.2 Intern: Prä-operative Maßnahmen
- 2.3.3 Extern: Zulieferer
- 3. Management-Ansätze
- 3.1 Schnittstellenübergreifende Kooperation und Standardisierung
- 3.2 Moderne Informationssysteme
- 3.3 Gezielte Personalentwicklung und Teamfähigkeit
- 3.4 Kooperative Produktentwicklung
- 3.5 Fazit: Management-Ansätze
- 4. DRGs: Die Ökonomisierung der Medizin?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Krankenhausfinanzierung in Deutschland, insbesondere dem Paradigmenwechsel hin zur Fallpauschalensystematik (DRGs). Sie untersucht die Auswirkungen dieser Reform auf die Krankenhauslandschaft und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für das Management der Krankenhäuser ergeben.
- Das System der dualen Krankenhausfinanzierung in Deutschland
- Die Einführung von Fallpauschalen (DRGs) als Paradigmenwechsel
- Die Auswirkungen der DRGs auf die Krankenhauslandschaft
- Management-Ansätze zur Bewältigung der neuen Herausforderungen
- Der Einfluss der DRGs auf die Ökonomisierung der Medizin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Krankenhausfinanzierung in Deutschland ein und beleuchtet die Problematik steigender Kosten im Gesundheitswesen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Institution Krankenhaus und die Herausforderungen, die sich durch die Einführung von Fallpauschalen (DRGs) ergeben.
Kapitel 1 gibt einen Überblick über das System der Krankenhausfinanzierung in Deutschland seit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972, einschließlich des dualistischen Systems der Investitions- und Betriebskostenfinanzierung.
Kapitel 2 analysiert anhand des Praxisbeispiels der ICD-Implantation die Auswirkungen der DRG-Einführung auf die Krankenhauslandschaft. Es werden die Kosten vor und nach der Einführung der Fallpauschalen sowie die daraus resultierenden Organisationsdefizite im stationären Bereich betrachtet.
Kapitel 3 behandelt Management-Ansätze, die sich aus den neuen Herausforderungen im Krankenhausmanagement ergeben. Es werden Lösungsansätze wie schnittstellenübergreifende Kooperation, moderne Informationssysteme, gezielte Personalentwicklung und kooperative Produktentwicklung diskutiert.
Schlüsselwörter
Krankenhausfinanzierung, DRGs, Fallpauschalen, Krankenhausmanagement, Ökonomisierung der Medizin, ICD-Implantation, Investitionskosten, Betriebskosten, dualistisches System, Management-Ansätze, Gesundheitsreform.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das DRG-System für Krankenhäuser?
Die Einführung von Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups) im Jahr 2003 markierte einen Paradigmenwechsel, der Krankenhäuser zu mehr ökonomischer Effizienz und Prozessoptimierung zwingt.
Wie funktioniert die duale Krankenhausfinanzierung?
Die Finanzierung ist geteilt: Die Bundesländer tragen die Investitionskosten, während die Krankenkassen die laufenden Betriebskosten über Fallpauschalen finanzieren.
Welche Management-Ansätze helfen bei der DRG-Umstellung?
Wichtige Ansätze sind schnittstellenübergreifende Kooperation, Standardisierung von Abläufen, moderne Informationssysteme und gezielte Personalentwicklung.
Was zeigt das Beispiel der ICD-Implantation?
Anhand der Implantation von Defibrillatoren (ICDs) werden die Kostenunterschiede vor und nach der DRG-Einführung sowie interne Organisationsdefizite bei der OP-Planung verdeutlicht.
Führen DRGs zu einer Ökonomisierung der Medizin?
Kritiker befürchten, dass durch den Kostendruck medizinische Entscheidungen zunehmend von wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden, was als Ökonomisierung bezeichnet wird.
Warum steigen die Kosten im Gesundheitswesen trotz Reformen?
Gründe sind der medizinische Fortschritt, eine alternde Bevölkerung, die teurere Leistungen beansprucht, und die Abnahme sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.
- Quote paper
- Robert Schwanitz (Author), 2006, Krankenhausmanagement - Paradigmenwechsel in der Krankenhausfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75457