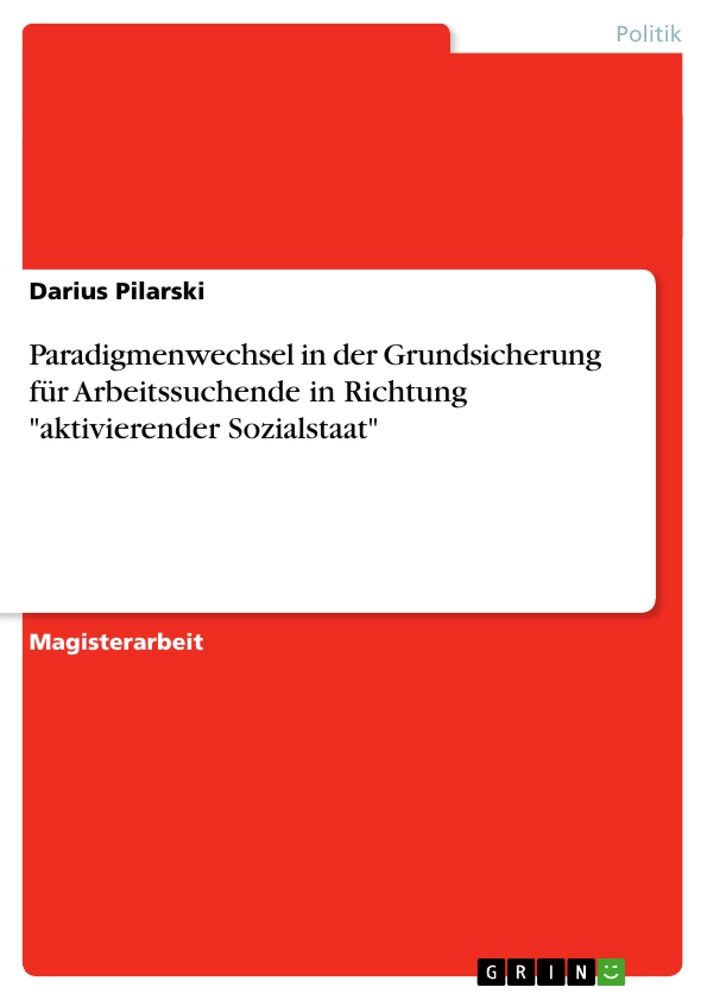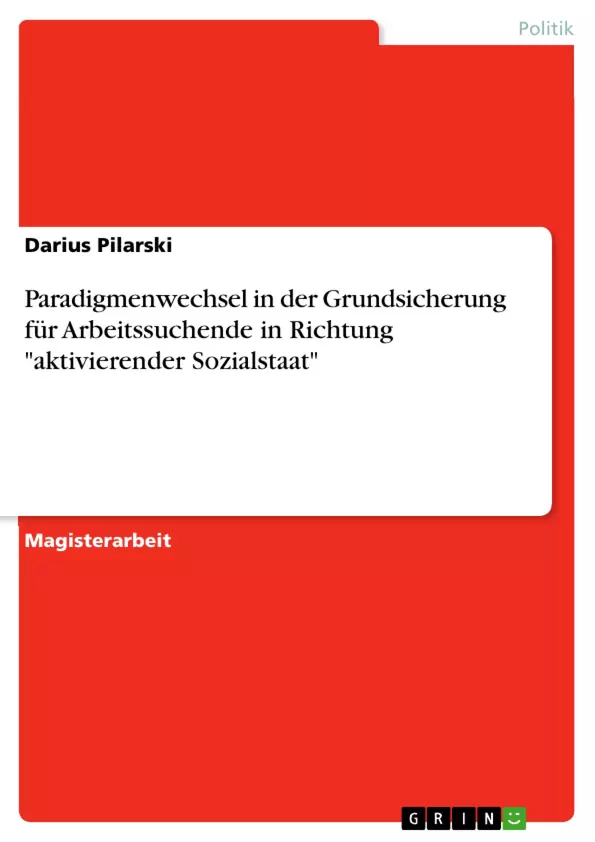Mit der Umsetzung der Hartz-Konzepte, der „größte[n] arbeitsmarktpolitische[n] Reform seit dem Arbeitsförderungsgesetz 1969“, wurde von der Kommission die Halbierung der Arbeitslosenzahl bis Ende 2005 in Aussicht gestellt. Die Wiedereingliederung – insbesondere von Langzeitarbeitslosen – sollte durch ein gezieltes Fördern und Fordern erfolgen. Gerade die Verbindung der Aspekte „Geben“ und „Nehmen“ ist hier als ein Novum anzusehen. Kritiker sahen durch die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe „das bisher unterste Netz unseres Sozialsystems (gemeint ist die Sozialhilfe) zerrissen“. In der Grundsicherung für Arbeitssuchende lässt sich der Policy-Wandel von einer aktiven, hin zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik besonders gut ablesen. Was ist aber unter aktivierender Politik bzw. dem aktivierenden Sozialstaat zu verstehen? Wie ist es zu Hartz IV gekommen und was ist im Zweiten Sozialgesetzbuch überhaupt „aktivierend“? Im Rahmen dieser Arbeit soll das Konzept des aktivierenden Staates und vor diesem Hintergrund der Politikwechsel, der sich mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vollzogen haben soll, vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der aktivierende (Sozial-)Staat
- 2.1 Das Leitbild
- 2.2 Wandel zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik unter Rot-Grün
- 2.3 Die Europäische Beschäftigungsstrategie
- 2.4 Der aktivierende Sozialstaat in der Kritik
- 3. Exkurs - Vorreiter Dänemark
- 3.1 Der dänische Arbeitsmarkt
- 3.2 Die Reformen – ein Mix aus „welfare“ und „workfare“
- 4. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 4.1 Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
- 4.2 Maßnahmen auf dem Weg zur Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 4.3 Die Hartz-Kommission
- 4.3.1 Der Bericht
- 4.3.2 Die Umsetzung
- 4.4 Aufgabenträgerschaft und Finanzierungsverantwortung
- 4.5 Grundphilosophie „Fördern und Fordern“
- 4.6 Einzelmaßnahmen im Hinblick auf den aktivierenden Sozialstaat
- 4.6.1 Vermittlung als Instrument der Aktivierung
- 4.6.2 Ausgestaltung der Lohnersatzleistungen als Mittel zur Druckerhöhung
- 4.6.3 Verantwortungsteilung durch Eingliederungsvereinbarung
- 4.6.4 Arbeitsgelegenheit als „Geschenk“ an die Gesellschaft
- 4.6.5 Eingliederung in Arbeit als Investition in die Zukunft
- 4.6.6 Zwangsmaßnahmen
- 4.7 Verhältnis zwischen Autonomie und Zwang - Eine Zwischenbilanz
- 5. Fazit - Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Paradigmenwechsel in der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Richtung eines „aktivierenden Sozialstaates“, insbesondere im Kontext der Hartz-Reformen. Die Arbeit analysiert die Ziele und Auswirkungen dieser Reformen, den Wandel der Arbeitsmarktpolitik und die Kritik an dem Konzept des aktivierenden Sozialstaates.
- Analyse des aktivierenden Sozialstaates und seiner Leitbilder
- Bewertung der Hartz-Reformen und ihrer Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit
- Untersuchung des Verhältnisses von Fördern und Fordern im SGB II
- Diskussion der Rolle von Autonomie und Zwang im System der Grundsicherung
- Vergleich mit dem dänischen Modell als Beispiel eines Vorreiters im Bereich der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und beleuchtet die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland trotz der Hartz-Reformen. Sie skizziert die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden, wie z.B. die Analyse des aktivierenden Sozialstaates, die Bewertung der Hartz-Reformen und die Untersuchung des Spannungsfeldes zwischen Autonomie und Zwang im System der Grundsicherung.
2. Der aktivierende (Sozial-)Staat: Dieses Kapitel beschreibt das Leitbild des aktivierenden Sozialstaates, den Wandel der Arbeitsmarktpolitik unter Rot-Grün und die Europäische Beschäftigungsstrategie. Es analysiert kritische Positionen zum aktivierenden Sozialstaat und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen.
3. Exkurs - Vorreiter Dänemark: Der Exkurs beleuchtet das dänische Arbeitsmarktmodell als Beispiel für einen erfolgreichen Mix aus "welfare" und "workfare". Der Fokus liegt auf den dänischen Reformen und ihrer Wirksamkeit im Vergleich zum deutschen Modell. Die Analyse betont die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme im Hinblick auf die Aktivierung von Arbeitslosen.
4. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende: Dieses zentrale Kapitel analysiert die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), die Maßnahmen auf dem Weg dorthin und die Rolle der Hartz-Kommission. Es untersucht die „Fördern und Fordern“-Philosophie, die einzelnen Maßnahmen des SGB II, sowie das Verhältnis zwischen Autonomie und Zwang im System. Die verschiedenen Instrumente der Aktivierung (Vermittlung, Lohnersatzleistungen, Eingliederungsvereinbarung, Arbeitsgelegenheiten) werden detailliert beschrieben und kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Aktivierender Sozialstaat, Hartz IV, Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosigkeit, Fördern und Fordern, Autonomie, Zwang, Eigenverantwortung, Dänemark, Europäische Beschäftigungsstrategie, Policy-Wandel.
FAQ: Magisterarbeit - Der aktivierende Sozialstaat und die Hartz-Reformen
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Paradigmenwechsel in der Grundsicherung für Arbeitssuchende hin zum „aktivierenden Sozialstaat“, insbesondere im Kontext der Hartz-Reformen. Analysiert werden die Ziele und Auswirkungen dieser Reformen, der Wandel der Arbeitsmarktpolitik und die Kritik am Konzept des aktivierenden Sozialstaates.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert den aktivierenden Sozialstaat und seine Leitbilder, bewertet die Hartz-Reformen und deren Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit, untersucht das Verhältnis von Fördern und Fordern im SGB II, diskutiert die Rolle von Autonomie und Zwang in der Grundsicherung und vergleicht das deutsche Modell mit dem dänischen als Beispiel eines Vorreiters in der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der aktivierende (Sozial-)Staat, Exkurs - Vorreiter Dänemark, Die Grundsicherung für Arbeitssuchende und Fazit - Perspektiven. Kapitel 4, "Die Grundsicherung für Arbeitssuchende", analysiert detailliert das SGB II, die Hartz-Reformen und die einzelnen Maßnahmen zur Aktivierung von Arbeitslosen.
Was wird im Kapitel "Der aktivierende (Sozial-)Staat" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das Leitbild des aktivierenden Sozialstaates, den Wandel der Arbeitsmarktpolitik unter Rot-Grün und die Europäische Beschäftigungsstrategie. Es analysiert kritische Positionen zum aktivierenden Sozialstaat und die damit verbundenen Herausforderungen.
Was ist der Fokus des Exkurses zu Dänemark?
Der Exkurs beleuchtet das dänische Arbeitsmarktmodell als Beispiel für einen erfolgreichen Mix aus "welfare" und "workfare". Es werden die dänischen Reformen und ihre Wirksamkeit im Vergleich zum deutschen Modell analysiert, wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme im Hinblick auf die Aktivierung von Arbeitslosen hervorgehoben werden.
Wie wird die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) analysiert?
Kapitel 4 analysiert die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), die Maßnahmen auf dem Weg dorthin und die Rolle der Hartz-Kommission. Es untersucht die „Fördern und Fordern“-Philosophie, die einzelnen Maßnahmen des SGB II und das Verhältnis zwischen Autonomie und Zwang im System. Die Instrumente der Aktivierung (Vermittlung, Lohnersatzleistungen, Eingliederungsvereinbarung, Arbeitsgelegenheiten) werden detailliert beschrieben und kritisch bewertet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aktivierender Sozialstaat, Hartz IV, Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosigkeit, Fördern und Fordern, Autonomie, Zwang, Eigenverantwortung, Dänemark, Europäische Beschäftigungsstrategie, Policy-Wandel.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht unter anderem die Analyse des aktivierenden Sozialstaates, die Bewertung der Hartz-Reformen und die Untersuchung des Spannungsfeldes zwischen Autonomie und Zwang im System der Grundsicherung. Ein weiterer Fokus liegt auf der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland trotz der Hartz-Reformen.
- Citar trabajo
- Darius Pilarski (Autor), 2007, Paradigmenwechsel in der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Richtung "aktivierender Sozialstaat", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75588