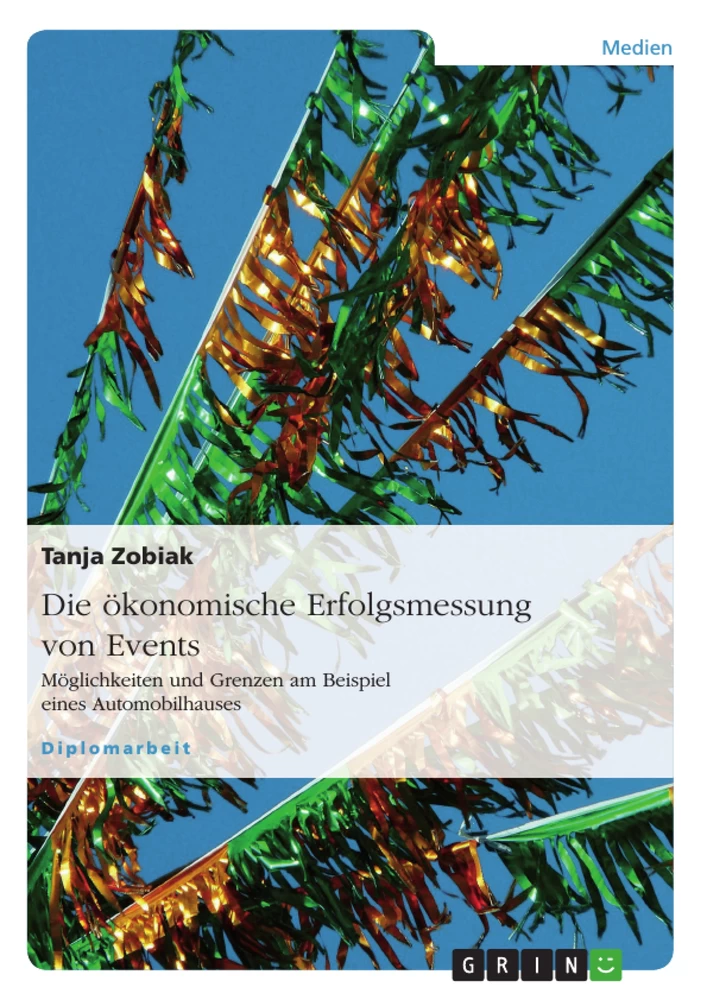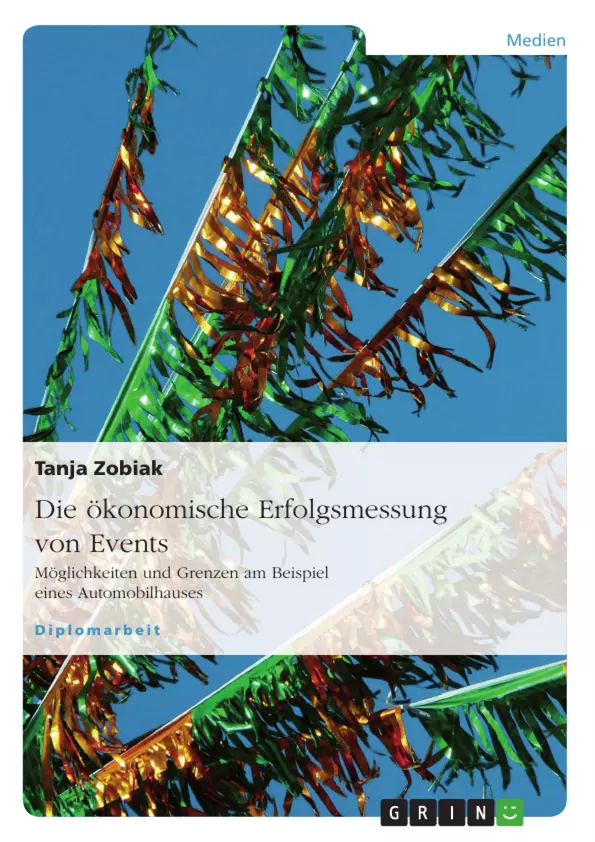„Eventmarketing ohne Messung ist wie der Dartwurf eines Blinden: Einige der Dartpfeile können die Zielscheibe treffen, aber ohne Feedback ist die Wiederholung des Erfolgs reiner Zufall.“
Dies bildet ziemlich greifbar das Verhalten vieler Unternehmen im Bezug auf Events ab. Dabei wird das Kommunikationsinstrument „Event“ als „Self-fullfilling-Prophecy“ angesehen und ausdauernd gehofft, dass das eintritt worauf man hofft. Ist eine Veranstaltung objektiv erfolgreich und tritt das Erhoffte ein, so wird diese wiederholt, ohne jegliche Gewissheit, ob auch der Erfolg wiederholbar ist. An dieser Stelle teilt sich der Weg. Bei einer erfolgreichen Wiederholung wird das eigentliche Konzept oftmals so lange angewandt, bis sich auch wirklich niemand mehr dafür interessiert. Ist ein Event jedoch nicht vom erhofften Erfolg begleitet, so heißt es, das Thema Event sei keine sinnvolle Maßnahme für das Unternehmen oder die Marke und zudem viel zu teuer. Folglich gibt es zwei Ergebnisse. Auf der einen Seite steht die Gruppe der ausdauernden Wiederholer, die ihre Kunden im Laufe der Zeit langweilen. Auf der anderen Seite befindet sich die Gruppe derer, die von Beginn an keinen Erfolg mit Events haben. In beiden Fällen gibt es ein Ergebnis: das Kommunikationsinstrument Event wird nicht mehr genutzt, ohne überhaupt zu hinterfragen, wo der Fehler lag. Andere dagegen integrieren sogar eine Erfolgskontrolle, lassen jedoch deren Ergebnisse unbeachtet. Ein solcher Zustand ist in traditionellen, aber auch in modernen Unternehmen keine Seltenheit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Begrifflichkeiten
- 2.1.1.1 Definition Events
- 2.1.1.2 Einordnung in den Kommunikationsmix
- 2.1.2 Definition und Abgrenzung der Erfolgsmessung
- 2.2 Theoretische Analyse der Erfolgsmessung von Events
- 2.2.1 Wertmessung von Marken
- 2.2.1.1 Markenwert
- 2.2.1.2 Markenwertmessung
- 2.2.1.2.1 Qualitative, nicht-monetäre Bewertungsverfahren
- 2.2.1.2.2 Monetäre Bewertungsverfahren
- 2.2.1.3 Firmenwert vs. Markenwert
- 2.2.1.4 Übertragung auf das Event
- 2.2.2 Erfolgsmessung von Events
- 2.2.2.1 Abgrenzung von qualitativen und ökonomischen Verfahren
- 2.2.2.2 Grundlagen für die ökonomische Erfolgsmessung von Events
- 2.2.2.2.1 Anforderungen an Verfahren zur Erfolgsmessung
- 2.2.2.2.2 Budgetierung von Events
- 2.2.2.2.3 Komponenten der Erfolgsmessung
- 2.2.2.2.4 Wirkungskategorien
- 2.2.2.2.5 Probleme / Grenzen
- 2.2.2.3 Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.2.2.3.1 Das S-O-R-Modell
- 2.2.2.3.2 Das TESI-Modell
- 2.2.2.3.3 Ansätze der Werbewirkungsforschung
- 2.2.2.4 Komponenten der Erfolgsmessung
- 2.2.2.4.1 Diagnosemessung
- 2.2.2.4.2 Ergebniskontrolle
- 2.3 Grundidee zur Berechnung
- 2.4 Beispiel einer empirischen Befragung
- 2.4.1 Durchführung
- 2.4.2 Aufbau der Fragebögen
- 2.4.3 Analyseformen
- 2.4.4 Ergebnisse
- 2.4.5 Kritische Reflexionen
- 2.5 Handlungsempfehlungen
- 2.5.1 Event-Typologie
- 2.5.2 Entscheidungshilfe
- 2.5.2.1 First Steps für Kleinstunternehmen
- 2.5.2.2 First Steps für Großunternehmen und Konzerne
- Begriffsbestimmung und Einordnung der Erfolgsmessung von Events
- Theoretische Analyse verschiedener Methoden zur ökonomischen Erfolgsmessung
- Anwendung empirischer Methoden zur Untersuchung der Eventwirkung
- Entwicklung einer praxisorientierten Entscheidungshilfe für die Eventplanung
- Bewertung der Grenzen und Herausforderungen bei der ökonomischen Erfolgsmessung von Events
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ökonomische Erfolgsmessung von Events am Beispiel eines Automobilhauses. Ziel ist es, Möglichkeiten und Grenzen dieser Messung aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der ökonomischen Erfolgsmessung von Events ein und stellt die Problemstellung dar, dass die Erfolgsmessung von Events oft schwierig und ungenau ist. Es werden die Ziele der Arbeit formuliert und der Aufbau der Arbeit erläutert. Die Einleitung hebt die Relevanz einer präzisen Erfolgsmessung für die strategische Eventplanung hervor und skizziert die Herausforderungen, die sich dabei stellen.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es definiert den Begriff "Event" und ordnet ihn in den Kommunikationsmix ein. Es analysiert verschiedene Ansätze zur Erfolgsmessung von Events, differenziert zwischen qualitativen und quantitativen Methoden und stellt wichtige Modelle wie das S-O-R-Modell und das TESI-Modell vor. Die Kapitel beschreibt Anforderungen an Verfahren zur Erfolgsmessung und beleuchtet die Problematik der Budgetierung sowie die verschiedenen Wirkungskategorien. Der Fokus liegt auf der ökonomischen Erfolgsmessung, wobei auch die Einbeziehung von Markenwert und Firmenwert diskutiert wird.
2.3 Grundidee zur Berechnung: Dieses Kapitel präsentiert ein grundlegendes Berechnungsmodell zur Ermittlung des Eventnutzens. Es beschreibt die wichtigsten Parameter und Variablen, die in die Berechnung einfließen und skizziert die Methodik zur Quantifizierung des Erfolgs. Das Kapitel ist entscheidend, um die theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 praktisch anzuwenden. Es dient als Brücke zwischen Theorie und empirischem Teil der Arbeit.
2.4 Beispiel einer empirischen Befragung: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer empirischen Befragung, die zur Überprüfung der theoretischen Ansätze dient. Es erläutert den Aufbau der Fragebögen, die angewandten Analysemethoden und präsentiert die wichtigsten Ergebnisse. Kritische Reflexionen über die Methoden und die Grenzen der Befragung runden dieses Kapitel ab. Der Fokus liegt auf der Auswertung der Daten und der Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage.
2.5 Handlungsempfehlungen: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt Handlungsempfehlungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Es wird eine Event-Typologie vorgestellt und eine Entscheidungshilfe für die Auswahl geeigneter Erfolgsmessverfahren entwickelt. Es werden konkrete Schritte für Kleinunternehmen und Großunternehmen aufgezeigt, um die ökonomische Erfolgsmessung in die Praxis umzusetzen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit der Ergebnisse und der Entwicklung konkreter Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Ökonomische Erfolgsmessung, Events, Automobilhaus, Markenwert, Markenwertmessung, Eventmarketing, Kommunikationsmix, S-O-R-Modell, TESI-Modell, Empirische Befragung, HandlungsEmpfehlungen, Budgetierung, Wirkungskategorien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ökonomische Erfolgsmessung von Events am Beispiel eines Automobilhauses
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ökonomische Erfolgsmessung von Events, speziell im Kontext eines Automobilhauses. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Erfolgsmessung und entwickelt Handlungsempfehlungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Begriffsbestimmung und Einordnung der Erfolgsmessung von Events, die theoretische Analyse verschiedener Methoden zur ökonomischen Erfolgsmessung (inklusive Markenwert und Firmenwert), die Anwendung empirischer Methoden zur Untersuchung der Eventwirkung, die Entwicklung einer praxisorientierten Entscheidungshilfe für die Eventplanung und eine kritische Bewertung der Grenzen und Herausforderungen bei der ökonomischen Erfolgsmessung von Events.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene theoretische Modelle, darunter das S-O-R-Modell und das TESI-Modell, um die Wirkungsweise von Events zu analysieren und die Erfolgsmessung zu konzeptionalisieren. Zusätzlich werden Ansätze der Werbewirkungsforschung berücksichtigt.
Welche Methoden der Erfolgsmessung werden untersucht?
Die Arbeit differenziert zwischen qualitativen und quantitativen Methoden der Erfolgsmessung und konzentriert sich auf die ökonomische Erfolgsmessung. Es werden verschiedene Ansätze zur Bewertung des Markenwerts und des Firmenwerts im Zusammenhang mit Events diskutiert.
Wie wird die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die empirische Untersuchung basiert auf einer Befragung. Die Arbeit beschreibt den Aufbau der Fragebögen, die angewandten Analysemethoden, die wichtigsten Ergebnisse und bietet eine kritische Reflexion der Methodik und der Grenzen der Befragung.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit bietet Handlungsempfehlungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Es wird eine Event-Typologie vorgestellt und eine Entscheidungshilfe für die Auswahl geeigneter Erfolgsmessverfahren entwickelt. Konkrete Schritte für Klein- und Großunternehmen zur Umsetzung der ökonomischen Erfolgsmessung werden aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ökonomische Erfolgsmessung, Events, Automobilhaus, Markenwert, Markenwertmessung, Eventmarketing, Kommunikationsmix, S-O-R-Modell, TESI-Modell, Empirische Befragung, Handlungsempfehlungen, Budgetierung, Wirkungskategorien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Teil zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Grundidee der Berechnung des Eventnutzens, ein Kapitel zur Beschreibung der empirischen Befragung und schließlich ein Kapitel mit Handlungsempfehlungen. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Erfolgsmessung von Events aufzuzeigen und praxisorientierte Handlungsempfehlungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe zu entwickeln, am Beispiel eines Automobilhauses.
- Citation du texte
- Diplom-Medienwirtin Tanja Zobiak (Auteur), 2007, Die ökonomische Erfolgsmessung von Events, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75695