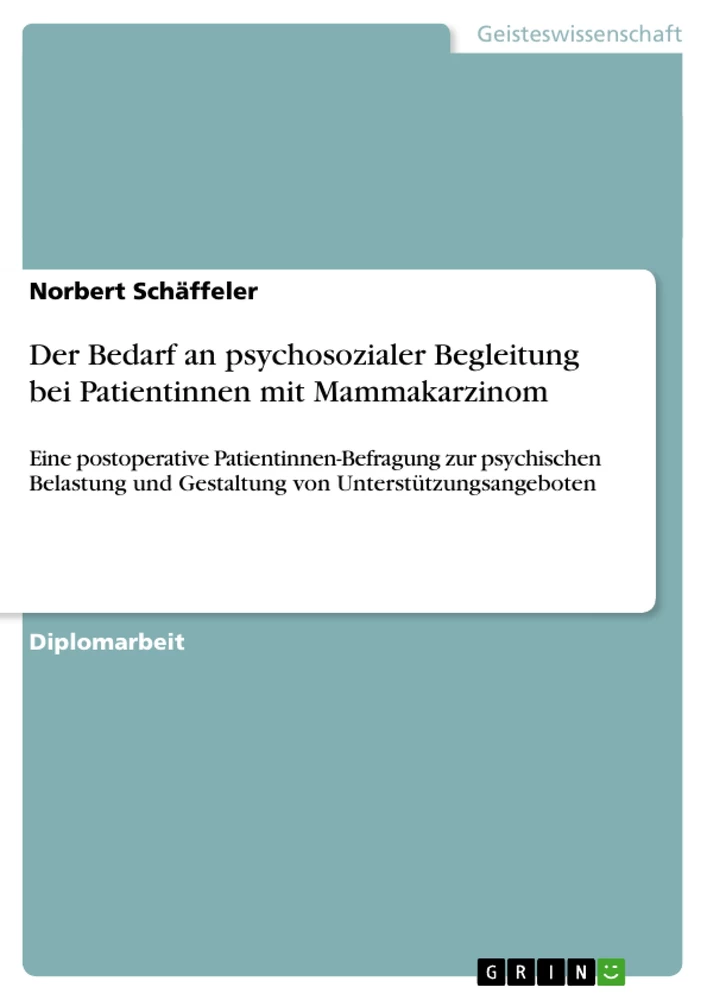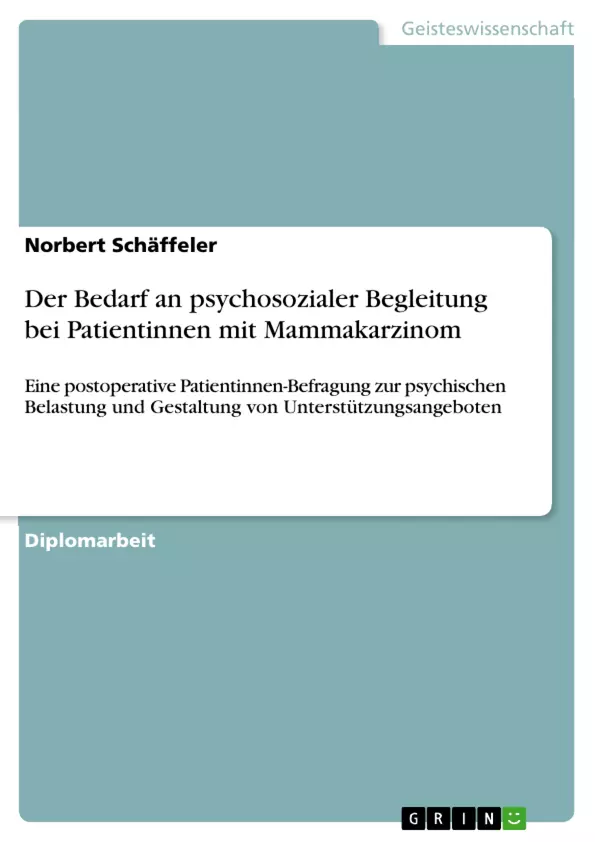Die Diagnose Brustkrebs stellt für alle Betroffenen eine äußerst belastende Situation dar. Viele der Patientinnen leiden im Laufe ihrer Erkrankung unter komorbiden psychischen Störungen (v.a. Ängste, Depression und Anpassungsstörungen), die bei etwa einem Drittel behandlungsbedürftig sind. Das Ausmaß der Störungen wird von den behandelnden Ärzten aber eher unterschätzt und nur wenige der Frauen nehmen psychosoziale Begleitangebote in Anspruch.
Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Wunsch nach psychosozialer Begleitung von Frauen mit Mammakarzinom in Zusammenhang mit psychischen Belastungen sowie ihre Vorstellungen zur Gestaltung von Unterstützungsangeboten zu untersuchen. Können die Frauen mit psychischen Belastungen, die eine Begleitung wünschen, mit Hilfe von Screening-Fragebögen identifiziert werden? Wie sollten nach Ansicht dieser Frauen psychosoziale Begleitangebote gestaltet werden?
Dazu wurden insgesamt N=115 Frauen hinsichtlich ihrer psychischen Belastung befragt, die aufgrund ihrer Brustkrebs-Erkrankung zur primären Operation in der Tübinger Frauenklinik waren. N=67 Frauen nahmen zusätzlich im zeitlichen Abstand von 4-6 Wochen nach ihrem Klinikaufenthalt an einem Telefoninterview teil.
Bei den eingesetzten Screening-Instrumenten (Hospital Anxiety and Depression Scale–HADS-D, Gesundheitsfragebogen für Patienten–PHQ-D) wiesen insgesamt 22% (HADS-D) bzw. 58% (PHQ-D) der Frauen auffällige Werte im Bereich Depression und 49% im Bereich Angst auf, 24% zeigten auffällige Werte hinsichtlich einer Panikattacke bzw. Panikstörung.
Insgesamt 41% (n=47) der Frauen äußerten zunächst in der Klinik einen Wunsch nach psychosozialer Begleitung, der von n=27 Frauen nach 4-6 Wochen im Telefoninterview bestätigt wurde (konstanter Wunsch). Diese Frauen mit konstantem Wunsch fallen durch eine doppelte Belastung auf den Skalen Depression und Angst/ Panik auf.
Alle Frauen, die im Telefoninterview ein Angebot wünschten, wiesen im Screening signifikant höhere Werte auf und gaben höhere körperliche und psychische Belastungen an. Der Wunsch scheint von medizinischen Charakteristika der Erkrankung unabhängig zu sein.
Weder kann das Screening diejenigen Patientinnen zuverlässig identifizieren, die ein Begleitangebot wünschen, noch reicht der subjektive Wunsch nach psychosozialer Begleitung allein aus, um alle belasteten Frauen zu erkennen. Dennoch ist er deutlich aussagekräftiger als vielfach angenommen wird und identifiziert die meisten der belasteten Frauen.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Medizinische Grundlagen und Therapie des Mammakarzinoms
- 2.1 Diagnose
- 2.2 Klassifikation des Tumors
- 2.3 Medizinische Therapie
- 2.3.1 Operative Therapie
- 2.3.2 Adjuvante Therapien: Chemotherapie
- 2.3.3 Adjuvante Therapien: Endokrine Therapie
- 2.3.4 Adjuvante Therapien: Radiotherapie
- 2.3.5 Rekonstruktion/ Wiederaufbau
- 2.3.6 Nachsorge
- 2.3.7 Rehabilitation
- Kapitel 3: Psychopathologische Komorbidität bei Brustkrebs
- 3.1 Häufige Störungsbilder bei Mammakarzinom
- 3.1.1 Depression
- 3.1.2 Angststörungen
- 3.1.3 Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)
- 3.1.4 Anpassungsstörungen
- 3.2 Bedarfserhebung durch Screening und Diagnostik
- 3.3 Prädiktoren für psychische Morbidität bei Brustkrebspatientinnen
- 3.4 Krankheitsverarbeitung
- 3.5 Gestaltung therapeutischer Angebote
- 3.5.1 Ziele und Inhalte therapeutischer Angebote
- 3.5.2 Zeitpunkt therapeutischer Angebote
- 3.5.3 Akzeptanz und Inanspruchnahme therapeutischer Angebote
- 3.5.4 Wirksamkeit therapeutischer Begleitangebote
- 3.1 Häufige Störungsbilder bei Mammakarzinom
- Kapitel 4: Zielsetzung und Fragestellungen
- Kapitel 5: Methodik
- 5.1 Datenerhebung
- 5.2 Fragebogen
- 5.3 Telefoninterview
- 5.4 Ergänzende medizinische Informationen
- 5.5 Auswertung der Daten
- Kapitel 6: Ergebnisse
- 6.1 Beschreibung der Telefonstichprobe
- 6.1.1 Demographische Daten der Telefonstichprobe
- 6.1.2 Medizinische Daten
- 6.1.3 Psychologische Daten
- 6.1.4 Unterschiede zwischen Telefonstichprobe und Fragebogenstichprobe
- 6.2 Reihenfolgeeffekt der Screeninginstrumente
- 6.3 Unterschiede nach Zeitpunkt der Befragung
- 6.4 Wunsch nach psychosozialer Begleitung
- 6.4.1 Konstanz des Wunsches über den Untersuchungszeitraum
- 6.4.2 Unterschiede aufgrund psychischer Belastungen
- 6.4.3 Unterschiede aufgrund medizinischer Charakteristika und körperlicher Belastungen
- 6.5 Wie soll ein bedarfsgerechtes psychosoziales Angebot nach Ansicht der Patientinnen aussehen?
- 6.5.1 Gewünschter Zeitpunkt des Beratungsangebotes
- 6.5.2 Themen des Beratungsangebotes
- 6.5.3 Form der Begleitung
- 6.5.4 Ansprechpartner
- 6.5.5 Bewältigungsressourcen
- 6.1 Beschreibung der Telefonstichprobe
- Kapitel 7: Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Pilotstudie untersucht den Bedarf an psychosozialer Begleitung bei Patientinnen mit Mammakarzinom. Ziel ist die Erforschung des Wunsches nach Unterstützung und dessen Korrelation mit der tatsächlich vorhandenen psychischen Belastung. Die Studie analysiert, ob der subjektiv empfundene Bedarf mit objektiven Messungen übereinstimmt und wie stabil dieser Wunsch über die Zeit ist.
- Bedarf an psychosozialer Unterstützung bei Brustkrebspatientinnen
- Zusammenhang zwischen subjektivem Wunsch und objektiv messbarer psychischer Belastung
- Stabilität des Wunsches nach psychosozialer Begleitung über die Zeit
- Gestaltung bedarfsgerechter psychosozialer Angebote
- Integration psychosozialer Angebote in die medizinische Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung beschreibt die psychische Belastung von Brustkrebspatientinnen, die hohe Prävalenz komorbider psychischer Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen und die unzureichende Integration psychologischer Begleitangebote in die medizinische Versorgung. Die Studie zielt darauf ab, den Wunsch nach psychosozialer Unterstützung zu untersuchen und dessen Übereinstimmung mit objektiven Messungen der psychischen Belastung zu überprüfen. Weiterhin soll die Stabilität des Wunsches über die Zeit und die Gestaltung bedarfsgerechter Angebote erforscht werden.
Kapitel 2: Medizinische Grundlagen und Therapie des Mammakarzinoms: Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die medizinischen Aspekte des Mammakarzinoms, von der Diagnose und Klassifizierung des Tumors bis hin zu den verschiedenen Therapiemethoden (operative Therapie, Chemotherapie, endokrine Therapie, Radiotherapie, Rekonstruktion) und der Nachsorge. Es liefert das medizinische Fundament für das Verständnis der körperlichen und emotionalen Herausforderungen, denen die Patientinnen gegenüberstehen.
Kapitel 3: Psychopathologische Komorbidität bei Brustkrebs: Dieses Kapitel beleuchtet die psychopathologischen Komorbiditäten, die häufig bei Brustkrebspatientinnen auftreten, wie Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen. Es wird die Bedeutung von Screening- und Diagnosemethoden zur Erfassung des psychischen Bedarfs diskutiert und auf Prädiktoren für psychische Morbidität eingegangen. Darüber hinaus werden verschiedene Ansätze zur Krankheitsverarbeitung und die Gestaltung therapeutischer Angebote, inklusive ihrer Akzeptanz und Wirksamkeit, behandelt.
Schlüsselwörter
Mammakarzinom, psychosoziale Begleitung, psychische Belastung, Screening, Bedarfsanalyse, Patientenzufriedenheit, Therapieangebote, Komorbidität, Depression, Angststörungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Pilotstudie: Bedarf an psychosozialer Begleitung bei Patientinnen mit Mammakarzinom
Was ist das Thema dieser Studie?
Die Studie untersucht den Bedarf an psychosozialer Begleitung bei Frauen mit Brustkrebs (Mammakarzinom). Im Fokus steht der Wunsch der Patientinnen nach Unterstützung, dessen Korrelation mit der tatsächlich vorhandenen psychischen Belastung und die Stabilität dieses Wunsches über die Zeit.
Welche Aspekte des Mammakarzinoms werden behandelt?
Die Studie betrachtet sowohl die medizinischen Grundlagen des Mammakarzinoms (Diagnose, Therapieformen wie Operation, Chemotherapie, Radiotherapie etc.) als auch die damit verbundenen psychischen Belastungen. Es werden häufige psychische Komorbiditäten wie Depressionen und Angststörungen beleuchtet.
Wie wird der Bedarf an psychosozialer Unterstützung ermittelt?
Der Bedarf wird mithilfe verschiedener Methoden erhoben: Ein Fragebogen, Telefoninterviews und ergänzende medizinische Informationen liefern Daten zur psychischen Belastung und zum Wunsch nach Unterstützung. Die Daten werden anschließend analysiert, um den tatsächlichen Bedarf zu bestimmen und ihn mit dem subjektiv empfundenen Wunsch abzugleichen.
Welche Fragen werden in der Studie untersucht?
Die Studie untersucht folgende zentrale Fragen: Stimmt der subjektiv empfundene Bedarf an psychosozialer Unterstützung mit objektiven Messungen der psychischen Belastung überein? Wie stabil ist der Wunsch nach Unterstützung über die Zeit? Wie sollte ein bedarfsgerechtes psychosoziales Angebot gestaltet sein (Zeitpunkt, Themen, Form, Ansprechpartner)?
Welche psychischen Belastungen werden betrachtet?
Die Studie konzentriert sich auf häufige psychische Komorbiditäten bei Brustkrebspatientinnen, darunter Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS). Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen diesen Belastungen und dem Wunsch nach psychosozialer Unterstützung.
Wie sieht die Methodik der Studie aus?
Die Datenerhebung erfolgt mittels Fragebögen und Telefoninterviews. Ergänzend werden medizinische Informationen berücksichtigt. Die Auswertung der Daten analysiert den Zusammenhang zwischen subjektivem Wunsch nach Unterstützung und objektiv messbarer psychischer Belastung, sowie die Stabilität des Wunsches über die Zeit.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die Beschreibung der Stichprobe (demografische, medizinische und psychologische Daten), die Analyse des Reihenfolgeeffekts von Screeninginstrumenten, Unterschiede nach Zeitpunkt der Befragung, den Wunsch nach psychosozialer Begleitung (Stabilität, Unterschiede aufgrund psychischer und medizinischer Belastungen) und die Gestaltung eines bedarfsgerechten psychosozialen Angebots (gewünschter Zeitpunkt, Themen, Form, Ansprechpartner).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Studie wird Schlussfolgerungen über den tatsächlichen Bedarf an psychosozialer Begleitung bei Brustkrebspatientinnen ziehen, den Zusammenhang zwischen subjektivem Wunsch und objektiver Belastung aufzeigen und Empfehlungen zur Gestaltung bedarfsgerechter Angebote geben. Die Ergebnisse sollen zur Verbesserung der psychosozialen Versorgung von Brustkrebspatientinnen beitragen.
Wer sind die Zielgruppen dieser Studie?
Die Zielgruppen sind Brustkrebspatientinnen, medizinisches Personal (Onkologen, Psychoonkologen), Psychologen, und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, die an der Verbesserung der Versorgung von Brustkrebspatientinnen interessiert sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Mammakarzinom, psychosoziale Begleitung, psychische Belastung, Screening, Bedarfsanalyse, Patientenzufriedenheit, Therapieangebote, Komorbidität, Depression, Angststörungen.
- Citation du texte
- Dipl. Pädagoge, Dipl. Psychologe Norbert Schäffeler (Auteur), 2007, Der Bedarf an psychosozialer Begleitung bei Patientinnen mit Mammakarzinom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75699