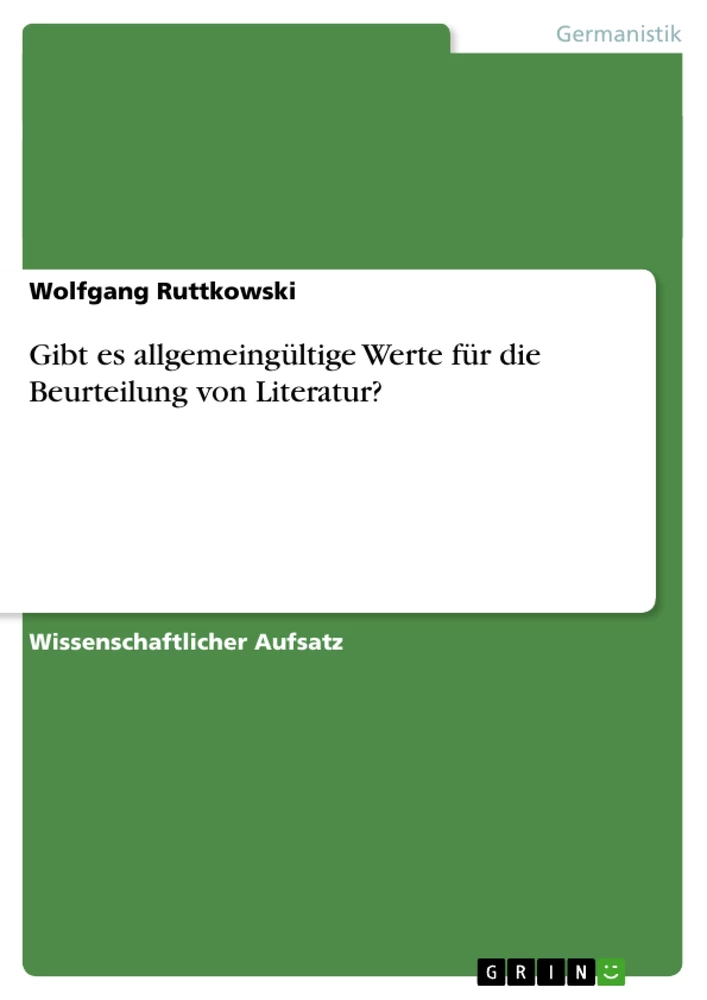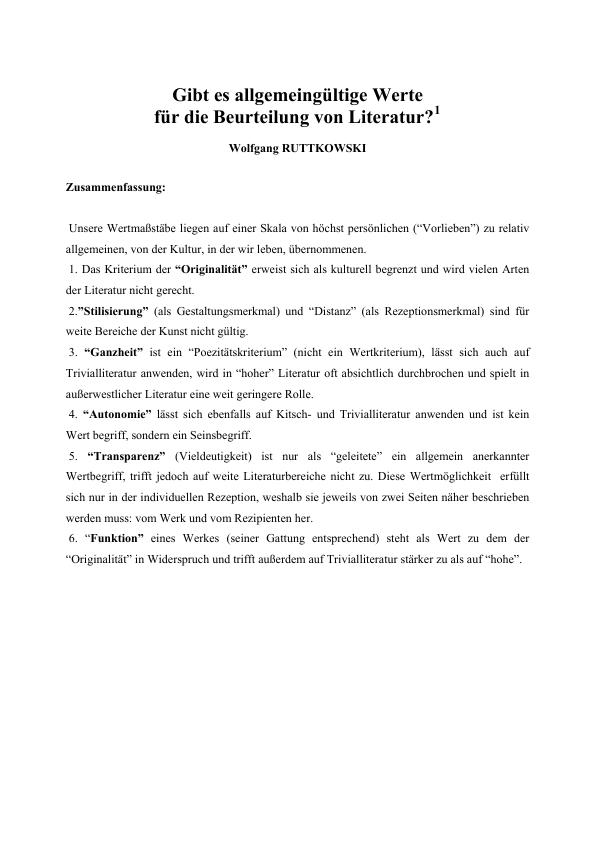Unsere Wertmaßstäbe liegen auf einer Skala von höchst persönlichen (“Vorlieben”) zu relativ allgemeinen, von der Kultur, in der wir leben, übernommenen.
1. Das Kriterium der “Originalität” erweist sich als kulturell begrenzt und wird vielen Arten der Literatur nicht gerecht.
2. ”Stilisierung” (als Gestaltungsmerkmal) und “Distanz” (als Rezeptionsmerkmal) sind für weite Bereiche der Kunst nicht gültig.
3. “Ganzheit” ist ein “Poezitätskriterium” (nicht ein Wertkriterium), lässt sich auch auf Trivialliteratur anwenden, wird in “hoher” Literatur oft absichtlich durchbrochen und spielt in außerwestlicher Literatur eine weit geringere Rolle.
4. “Autonomie” lässt sich ebenfalls auf Kitsch- und Trivialliteratur anwenden und ist kein Wertbegriff, sondern ein Seinsbegriff.
5. “Transparenz” (Vieldeutigkeit) ist nur als “geleitete” ein allgemein anerkannter Wertbegriff, trifft jedoch auf weite Literaturbereiche nicht zu. Diese Wertmöglichkeit erfüllt sich nur in der individuellen Rezeption, weshalb sie jeweils von zwei Seiten näher beschrieben werden muss: vom Werk und vom Rezipienten her.
6. “Funktion” eines Werkes (seiner Gattung entsprechend) steht als Wert zu dem der “Originalität” in Widerspruch und trifft außerdem auf Trivialliteratur stärker zu als auf “hohe”.
(Vortrag vor dem Jap. Germanistenverband, Keio Daigaku, Tokyo, 7.6.1997; In: Acta Humanistica 29/1, Foreign Langs. and Lit. S. No. 25, 1998, 20-86)
Inhaltsverzeichnis
- I. Grundlegende Unterscheidungen und Klarlegungen
- II. Die wichtigsten “immanenten\" Wertkriterien:
- 1. Originalität
- 2. Distanz
- 3. Ganzheit
- 4. Autonomie
- 5. Transparenz
- 6. Funktion
- III. Einwände gegen immanente Wertkriterien:
- 1. Kunst versus Kitsch
- 2. Gesellschaftlich-kulturelles Bezugssystem der Wertkriterien
- 3. Problematik des Schönheitsbegriffs
- IV. Besprechung von fremden literarischen Wertkriterien:
- 1. japanische
- 2. indische
- V. Zusammenfassung
- VI. Literatur
- VII. Gemeinsame und unterscheidende Merkmale
- VIII. Liste von Wertkriterien
- IX. Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Frage, ob es allgemeingültige Werte für die Beurteilung von Literatur gibt. Er analysiert verschiedene immanente Wertkriterien und untersucht, ob diese universell gültig sind oder durch kulturelle Einflüsse geprägt werden.
- Die Gültigkeit von immanenten Wertkriterien wie Originalität, Distanz, Ganzheit, Autonomie, Transparenz und Funktion.
- Die Abhängigkeit von Wertkriterien von gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten.
- Die Problematik des Schönheitsbegriffs in der Literaturkritik.
- Die Einordnung von Kunst und Kitsch im Kontext von literarischen Wertkriterien.
- Die Vergleichbarkeit von literarischen Werten in verschiedenen Kulturen (z.B. Japan und Indien).
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt grundlegende Unterscheidungen und Klärungen ein, um den Begriff "Wertung" in der Literaturwissenschaft zu präzisieren. Es werden zwei Schulen der Literaturkritik vorgestellt, die unterschiedliche Positionen zur Wertung einnehmen. Darüber hinaus werden wichtige Begriffsdefinitionen und Unterscheidungen wie "Werten" und "Bewerten" sowie "konstitutive" und "komparative" Kriterien geklärt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den wichtigsten "immanenten" Wertkriterien, die im Westen oft zur Beurteilung von Literatur verwendet werden. Es werden die Kriterien Originalität, Distanz, Ganzheit, Autonomie, Transparenz und Funktion analysiert und ihre Relevanz für die Literaturkritik diskutiert.
Im dritten Kapitel werden Einwände gegen die immanenten Wertkriterien vorgebracht. Es wird argumentiert, dass diese Wertkriterien nicht universell gültig sind, sondern von gesellschaftlichen und kulturellen Einflüssen geprägt werden.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Besprechung von literarischen Wertkriterien in anderen Kulturkreisen, insbesondere in Japan und Indien. Es wird untersucht, welche Werte in diesen Kulturen zur Beurteilung von Literatur relevant sind und wie diese sich von westlichen Wertvorstellungen unterscheiden.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den zentralen Themen der Literaturkritik, insbesondere mit der Frage nach allgemeingültigen Wertmaßstäben für die Bewertung von Literatur. Zu den Schlüsselbegriffen gehören: immanente Wertkriterien, Originalität, Distanz, Ganzheit, Autonomie, Transparenz, Funktion, kulturelle Bedingtheit, Kunst, Kitsch, Vergleichbarkeit von Werten, japanische Literatur, indische Literatur.
- Citation du texte
- Dr. Wolfgang Ruttkowski (Auteur), 1998, Gibt es allgemeingültige Werte für die Beurteilung von Literatur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7572