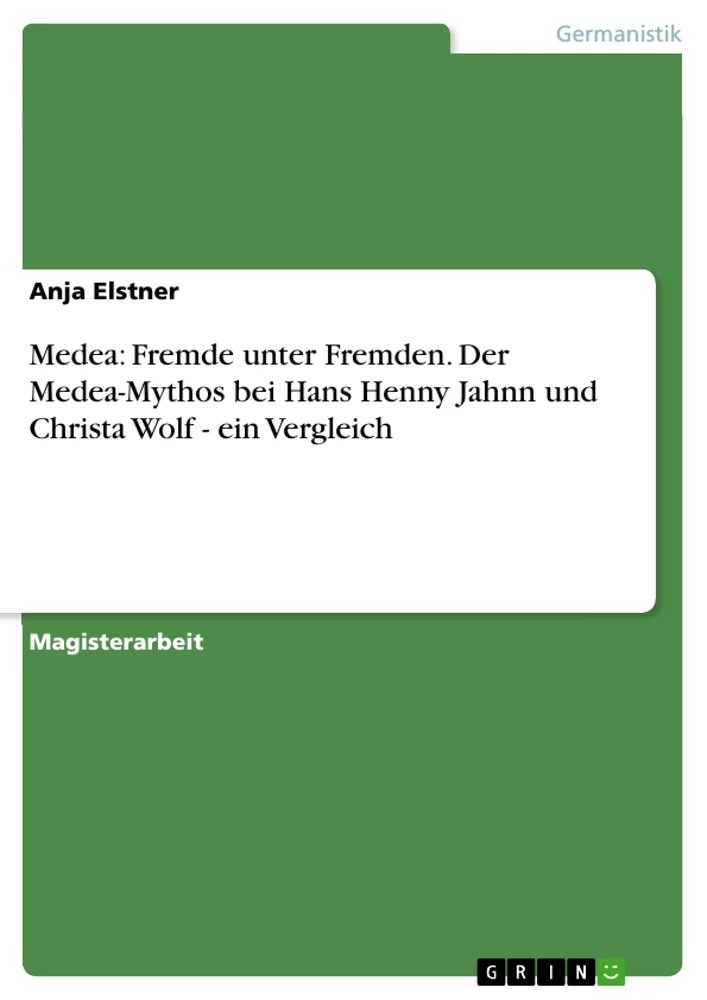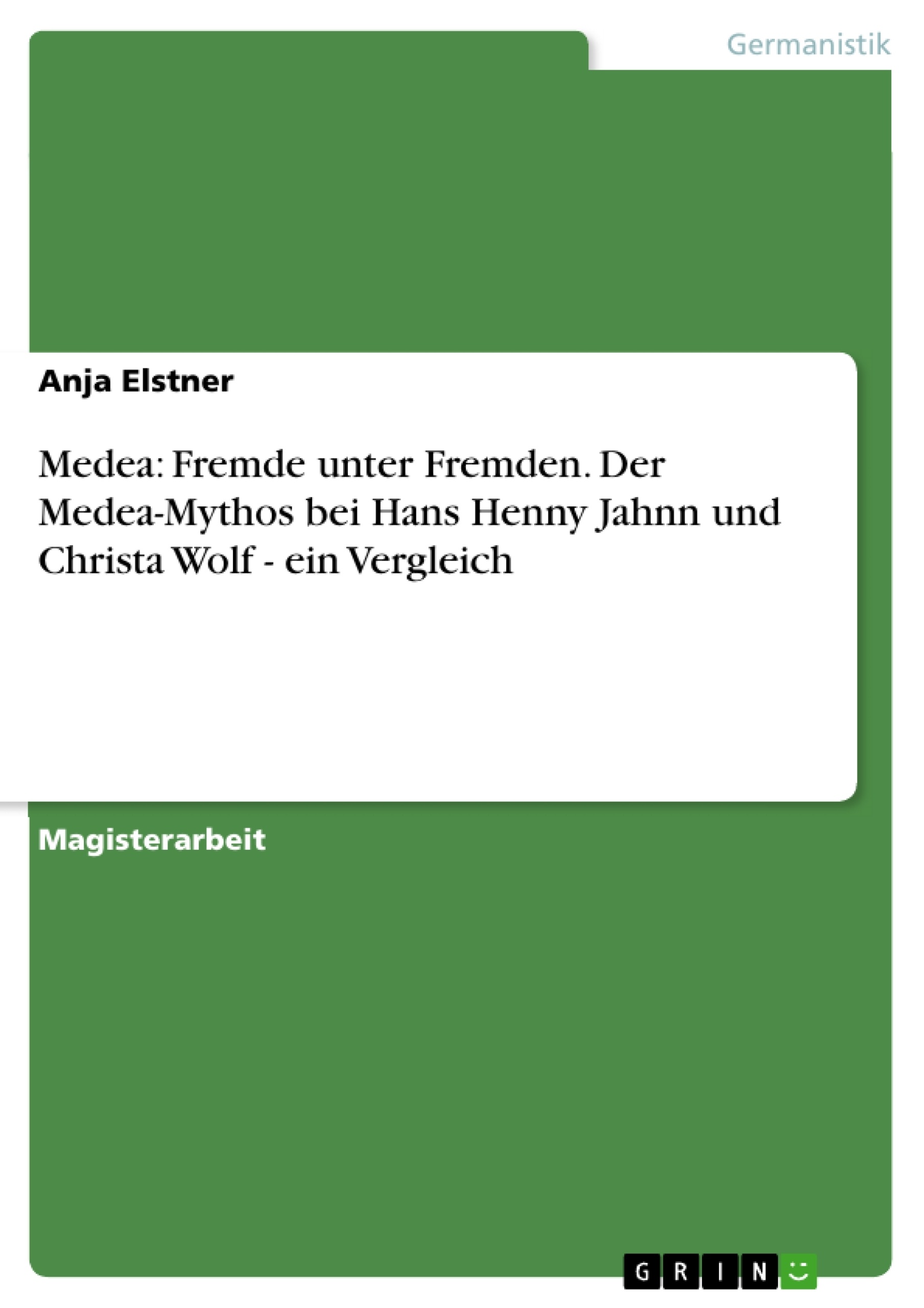Der Mythos von Medea, der Göttin, Zauberin, Priesterin, Heilerin, Mutter, Liebenden und Todbringenden hat über die Jahrtausende hinweg Kunst und Literatur beschäftigt. Seine erste einschneidende Bearbeitung erfuhr er durch Euripides, dessen Medeadrama 431 v. Chr. bei den Dionysien aufgeführt wurde. Bereits vor Euripides ist die Figur der Medea in vielen Schriften belegt, so in Hesiods Theogonie, bei Appollonius von Rhodos, in der Korinthiaka des Eumelos. Sie ist sowohl in der griechischen als auch in der römischen Literatur existent.
Die Figur der Medea hat in den 2500 Jahren ihrer literarischen Existenz verschiedene Rollen eingenommen und die verschiedensten Deutungsansätze durchlaufen. So galt beispielsweise die thessalische Medea der vorepischen Zeit als „eine Göttin aus dem Kreise der Hekate“ , die korinthische Medea wiederum wurde als eine Göttin „aus dem Bereich der Hera und der Aphrodite“ angesehen, bevor sie bedeutungsgeschichtlich zur Heroine herabsank.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Begriff des Mythos
- 2. Die Geschichte des Medea-Mythos
- 2.1 Der antike Medea-Mythos
- 2.2 Das Medeadrama des Euripides
- 3. Der Medea-Mythos in Hans Henny Jahnns Drama „Medea“
- 3.1 Die Aspekte der Fremdheit Medeas
- 4. Der Medea-Mythos in Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“
- 4.1 Christa Wolfs Mythosverständnis
- 4.2 Die Verarbeitung des Medea-Stoffs
- 4.3 Medea: Fremde unter Fremden
- 5. Assimilation ausgeschlossen – Medea im Vergleich
- 6. Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit verfolgt das Ziel, den Medea-Mythos in den literarischen Bearbeitungen von Hans Henny Jahnn und Christa Wolf vergleichend zu untersuchen. Im Fokus steht dabei die Darstellung Medeas als Fremde in beiden Werken und die unterschiedlichen Interpretationen des Mythos.
- Der Begriff des Mythos und seine literaturwissenschaftliche Definition
- Die Geschichte des Medea-Mythos von der Antike bis zur Gegenwart
- Die Darstellung der Fremdheit Medeas bei Jahnn und Wolf
- Der Vergleich der beiden literarischen Bearbeitungen hinsichtlich ihrer Interpretation des Mythos
- Die Frage nach der Assimilation und der Rolle der Fremdheit in beiden Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung des Medea-Mythos in der Literaturgeschichte. Sie hebt die lange Rezeptionsgeschichte des Mythos hervor, von Euripides bis zu zeitgenössischen Autoren wie Christa Wolf und Hans Henny Jahnn, und betont die Vielschichtigkeit der Figur Medea und ihrer Interpretationen über die Jahrhunderte. Die Arbeit kündigt den Vergleich der Medea-Darstellungen bei Jahnn und Wolf an, wobei der Aspekt der Fremdheit im Mittelpunkt steht.
1. Der Begriff des Mythos: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs „Mythos“ aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, beginnend mit der etymologischen Bedeutung des griechischen Wortes „μῦθος“. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen dem Mythos als traditioneller Erzählstoff und den individuellen literarischen Adaptionen. Es wird herausgearbeitet, dass der Mythos sowohl feste Elemente als auch variable, flexible Bestandteile aufweist, die von den Autoren interpretiert und neu gestaltet werden können.
2. Die Geschichte des Medea-Mythos: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Medea-Mythos von seinen antiken Ursprüngen bis zu den literarischen Bearbeitungen, die im Zentrum der Arbeit stehen. Es werden wichtige Stationen der Rezeption, wie Euripides' Medeadrama und weitere literarische Werke, skizziert. Die Kapitel unterstreichen die Wandelbarkeit der Figur Medeas und die unterschiedlichen Deutungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Die unterschiedlichen Aspekte, wie z.B. Medea als Göttin oder Heroine, werden angesprochen.
3. Der Medea-Mythos in Hans Henny Jahnns Drama „Medea“: Dieses Kapitel analysiert Jahnns Drama „Medea“ und konzentriert sich auf die Darstellung Medeas als Fremde. Es werden die Aspekte der Fremdheit in Jahnns Werk im Detail untersucht und die Bedeutung dieses Aspekts für die Interpretation des Dramas erläutert. Die Analyse untersucht die spezifischen Mittel und Strategien, die Jahnn einsetzt, um Medeas Andersartigkeit und Außenseitertum darzustellen.
4. Der Medea-Mythos in Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“: Dieses Kapitel befasst sich mit Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“. Es analysiert Wolfs Verständnis des Mythos und ihre spezifische Verarbeitung des Medea-Stoffs. Der Fokus liegt auf der Darstellung Medeas als Fremde und auf der Frage, wie Wolf diesen Aspekt in ihrem Roman verarbeitet. Die verschiedenen „Stimmen“ und Perspektiven im Roman und ihre Bedeutung für das Verständnis der Figur Medea werden hier eingehend erläutert.
5. Assimilation ausgeschlossen – Medea im Vergleich: Dieses Kapitel stellt einen Vergleich der Medea-Darstellungen bei Jahnn und Wolf dar, wobei die Frage nach der Assimilation im Mittelpunkt steht. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung Medeas und der Interpretation des Mythos herausgearbeitet. Die Analyse vergleicht die verschiedenen Strategien, die beide Autoren verwenden, um Medeas Fremdheit darzustellen und ihre Konsequenzen zu erörtern.
Schlüsselwörter
Medea-Mythos, Fremdheit, Hans Henny Jahnn, Christa Wolf, Vergleichende Literaturwissenschaft, Mythosdeutung, Assimilation, Drama, Roman, Antike, Moderne, Literarische Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Vergleichende Analyse des Medea-Mythos bei Jahnn und Wolf
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht vergleichend die Darstellung des Medea-Mythos in den literarischen Werken von Hans Henny Jahnn und Christa Wolf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Figur Medeas als Fremde und den unterschiedlichen Interpretationen des Mythos in beiden Werken.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Hans Henny Jahnns Drama „Medea“ und Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“. Es wird ein Vergleich der beiden literarischen Bearbeitungen des Mythos vorgenommen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind der Begriff des Mythos, die Geschichte des Medea-Mythos, die Darstellung der Fremdheit Medeas bei Jahnn und Wolf, ein Vergleich der mythologischen Interpretationen in beiden Werken und die Frage nach Assimilation und der Rolle der Fremdheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition des Mythosbegriffs, ein Kapitel zur Geschichte des Medea-Mythos, Kapitel zur Analyse von Jahnns und Wolfs Werken, ein Vergleichskapitel und eine Schlussbemerkung. Es werden Kapitelzusammenfassungen bereitgestellt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die unterschiedlichen Interpretationen des Medea-Mythos bei Jahnn und Wolf vergleichend zu untersuchen und die Darstellung Medeas als Fremde in beiden Werken zu analysieren.
Welche Aspekte der Fremdheit werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht, wie die Fremdheit Medeas in den jeweiligen Werken dargestellt wird und welche Bedeutung dieser Aspekt für die Interpretation des Dramas bzw. des Romans hat. Es werden die spezifischen Mittel und Strategien der Autoren analysiert.
Wie wird der Vergleich zwischen Jahnn und Wolf durchgeführt?
Der Vergleich konzentriert sich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung Medeas und der Interpretation des Mythos. Die verschiedenen Strategien, die beide Autoren zur Darstellung von Medeas Fremdheit verwenden, werden verglichen und ihre Konsequenzen erörtert. Die Frage nach der Assimilation spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medea-Mythos, Fremdheit, Hans Henny Jahnn, Christa Wolf, Vergleichende Literaturwissenschaft, Mythosdeutung, Assimilation, Drama, Roman, Antike, Moderne, Literarische Rezeption.
Wie wird der Begriff „Mythos“ definiert?
Die Arbeit widmet sich der literaturwissenschaftlichen Definition des Begriffs „Mythos“, unterscheidet zwischen traditionellem Erzählstoff und individuellen literarischen Adaptionen und beleuchtet die Flexibilität des Mythos als interpretierbarer und gestaltbarer Stoff.
Welche Bedeutung hat die antike Medea-Geschichte für die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt die Geschichte des Medea-Mythos von seinen antiken Ursprüngen bis zu den modernen literarischen Bearbeitungen von Jahnn und Wolf. Die antike Medea-Geschichte, insbesondere Euripides’ Medeadrama, dient als Ausgangspunkt für die Analyse der modernen Interpretationen.
- Quote paper
- Anja Elstner (Author), 2006, Medea: Fremde unter Fremden. Der Medea-Mythos bei Hans Henny Jahnn und Christa Wolf - ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75768