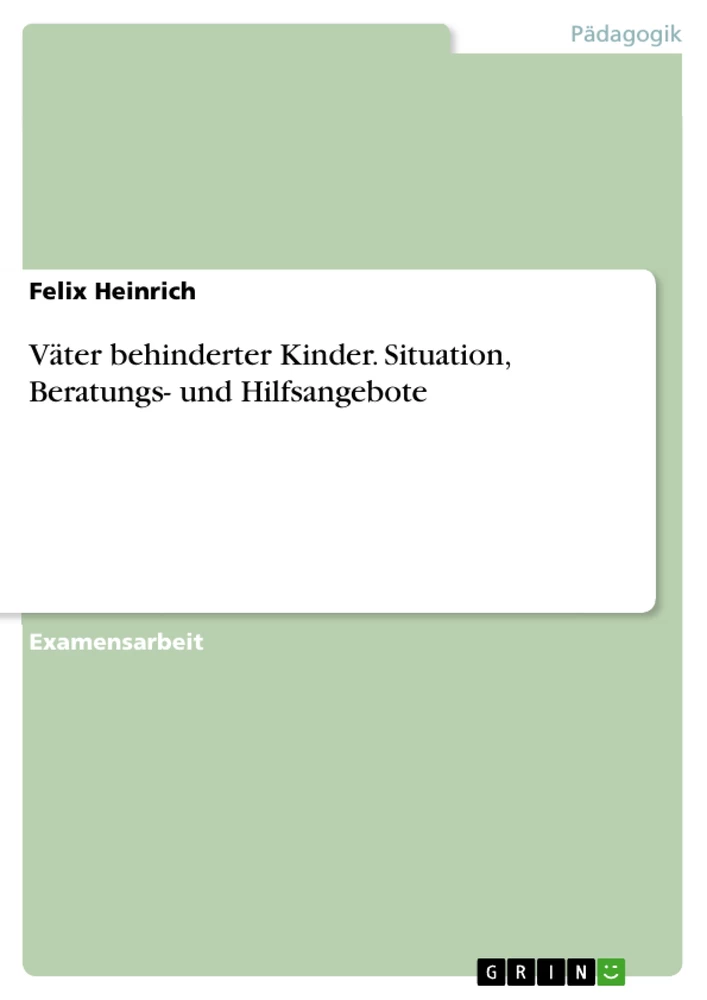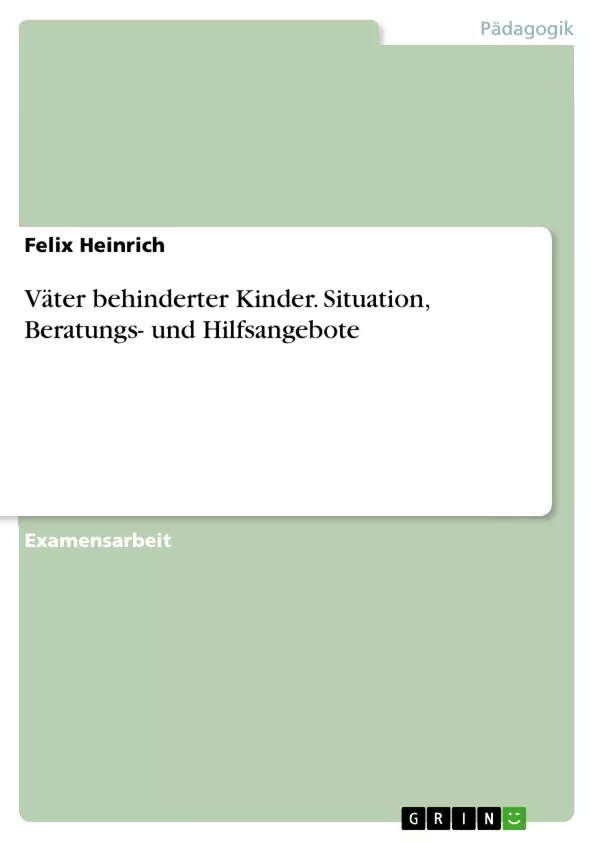Thema dieser Arbeit sind Beratungs- und Hilfeangebote für Väter behinderter Kinder.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Frage, zu welchen Veränderungen, Belastungen und Herausforderungen es in der Familie durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung kommen kann.
Kapitel 2 erläutert die grundlegenden Prozesse männlicher Sozialisation; dabei werden Prinzipien, mit Hilfe derer Männer ihr Mannsein „bewältigen“ – ihre Identität behaupten – genauer betrachtet.
Kapitel 3 befasst sich mit Konzepten und Vorstellungen von Vaterschaft und den damit verbundenen Aufgaben und Funktionen.
Kapitel 4 schließlich handelt von Vätern behinderter Kinder. Herausforderungen und Belastungen, denen Väter behinderter Kinder aufgrund ihrer Sozialisation sowie ihrer Stellung und Funktion in der Gesellschaft bzw. in der Familie ausgesetzt sind, werden vorgestellt. Durch die Behinderung können Väter ihre männliche Identität in Frage gestellt sehen. Die in Kapitel 2.3 beschriebenen Prinzipien zur Bewältigung des Mannseins verlieren an Wirksamkeit. Es werden „gebrochene“ Prinzipien beschrieben, mit denen sich Väter behinderter Kinder auseinandersetzen müssen.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit Beratungs- und Hilfsangeboten für Väter behinderter Kinder. Es wird erläutert, was unter diesen Angeboten zu verstehen ist und welche Ziele mit ihnen verfolgt werden. Beratungs- und Hilfeangebote – so die Auffassung dieser Arbeit – sind größtenteils Angebote der Familienbildung. Aus diesem Grund werden die wesentlichen Bestandteile der Familienbildung skizziert und es wird untersucht, wo sich Angebote für Väter behinderter Kinder im System der Familienbildung verorten lassen. Des Weiteren werden Faktoren erörtert, welche Vätern die Inanspruchnahme von Beratung und Hilfe erleichtern. Schließlich wird am Beispiel der „Häuser für Kinder und Familien“ dargestellt, wie Väter in die familienorientierte Bildungsarbeit nachhaltig eingebunden werden können.
In Kapitel 6 werden drei Beratungs- und Hilfsangebote für Väter behinderter Kinder aus der Praxis vorgestellt. Diese Angebote sollen Anregungen für die Gestaltung ähnlicher Programme geben und zeigen, welche Gesichtspunkte bei der Konzeption und Durchführung solcher Angebote beachtet werden müssen.
Kapitel 7 schließlich fasst die zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammen und schließt mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Familien behinderter Kinder
- Die Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind
- Die Auseinandersetzung mit der Behinderung
- Männer
- Männliche Sozialisation
- Bewältigungsmuster des Mannseins
- Bewältigungsprinzipien des Mannseins
- Väter
- Vom Paar zur Familie
- Vaterschaftskonzepte
- Die Vater-Kind-Beziehung
- Väter behinderter Kinder
- Das Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie
- Mangelnde gesellschaftliche Anerkennung des Vaters
- Gebrochene Bewältigungsprinzipien männlicher Identität
- Chancen die sich für Väter behinderter Kinder ergeben
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Beratungs- und Hilfsangebote für Väter behinderter Kinder
- Ziele
- Einbindung in die Familienbildung
- Erleichterung der Inanspruchnahme von Beratungs- und Hilfsangeboten für Väter behinderter Kinder
- Didaktik und Methodik
- Häuser für Kinder und Familien - ein inklusives Modell zur Beratung und Unterstützung von Vätern behinderter Kinder?
- Beispielhafte Beratungs- und Hilfsangebote für Väter behinderter Kinder
- Vätertreffen der Bildungs- und Erholungsstätte Langau e. V.
- Eltern-Selbsthilfegruppe Ostwind
- Segeltörn für Väter mit lebensverkürzend erkrankten oder gestorbenen Kindern der Deutschen Kinderhospizakademie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Situation von Vätern behinderter Kinder und analysiert die Herausforderungen, die sich ihnen stellen. Ziel ist es, die spezifischen Bedürfnisse dieser Väter zu beleuchten und geeignete Beratungs- und Hilfsangebote zu entwickeln.
- Die veränderte Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind
- Die spezifischen Bewältigungsmuster und Herausforderungen von Vätern behinderter Kinder
- Die Bedeutung von gesellschaftlicher Anerkennung und Unterstützung für Väter
- Die Rolle von Beratungs- und Hilfsangeboten in der Unterstützung von Vätern behinderter Kinder
- Die Entwicklung eines inklusiven Modells zur Beratung und Unterstützung von Vätern behinderter Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Thema und beleuchtet die veränderten Bedeutungen von Kindern im Laufe des vergangenen Jahrhunderts. Im ersten Kapitel wird die Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind untersucht, wobei die realen, emotionalen und sozialen Veränderungen sowie die Chance der Behinderung betrachtet werden. Kapitel zwei analysiert die männliche Sozialisation und die Bewältigungsmuster des Mannseins. Das dritte Kapitel widmet sich der Vaterschaft, beleuchtet die Erweiterung und Modernisierung der Vaterrolle sowie verschiedene Vaterschaftskonzepte. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Situation von Vätern behinderter Kinder, analysiert die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, und zeigt Chancen auf, die sich für sie ergeben können. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Möglichkeiten von Beratungs- und Hilfsangeboten für Väter behinderter Kinder und diskutiert die Einbindung in die Familienbildung. Im sechsten Kapitel werden exemplarische Beratungs- und Hilfsangebote vorgestellt, z. B. Vätertreffen, Selbsthilfegruppen und Segeltörns.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert Väter behinderter Kinder, Familien mit einem behinderten Kind, männliche Sozialisation, Bewältigungsmuster, Vaterschaft, Beratungs- und Hilfsangebote, Familienbildung, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Belastungen sind Väter behinderter Kinder ausgesetzt?
Sie stehen oft im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie und erleben eine mangelnde gesellschaftliche Anerkennung ihrer spezifischen Rolle.
Wie beeinflusst die männliche Sozialisation den Umgang mit der Behinderung?
Traditionelle Bewältigungsmuster des Mannseins können durch die Behinderung des Kindes in Frage gestellt werden, was zu Identitätskrisen führen kann.
Welche Beratungsangebote gibt es für betroffene Väter?
Es gibt Vätertreffen, Selbsthilfegruppen und spezielle Angebote der Familienbildung, wie z.B. pädagogische Segeltörns oder Wochenendseminare.
Was sind "Häuser für Kinder und Familien"?
Dies ist ein inklusives Modell, das Beratung und Unterstützung bietet und Väter nachhaltig in die Bildungsarbeit einbindet.
Warum nehmen Väter seltener Hilfe in Anspruch?
Die Arbeit untersucht Faktoren, die Vätern den Zugang zu Hilfe erleichtern können, da klassische Angebote oft eher auf Mütter zugeschnitten sind.
- Quote paper
- Felix Heinrich (Author), 2007, Väter behinderter Kinder. Situation, Beratungs- und Hilfsangebote, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75855