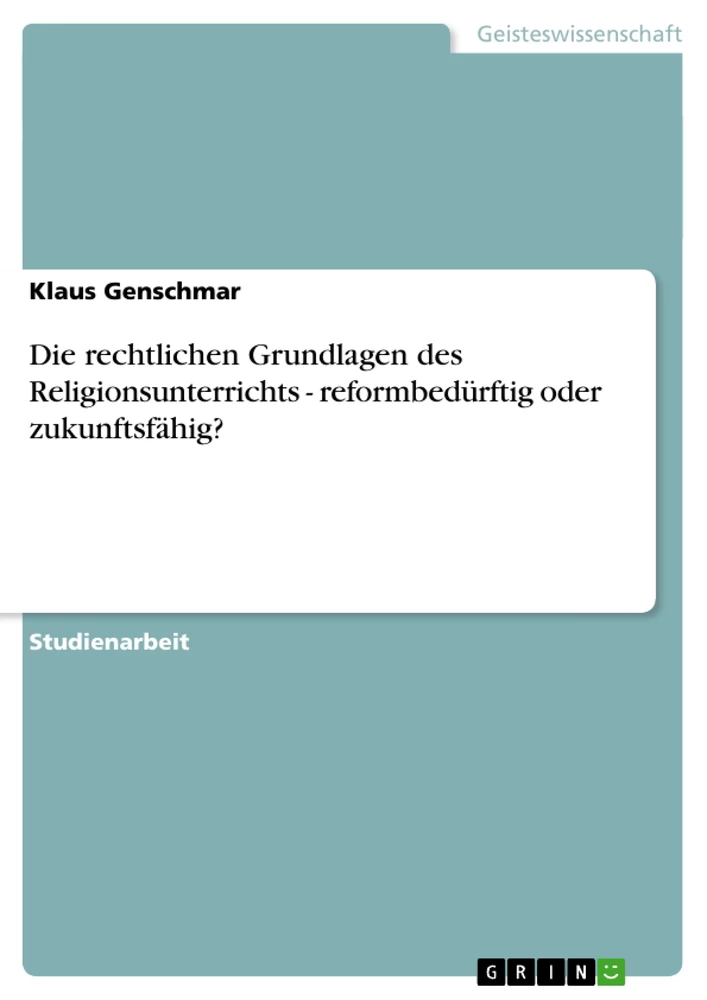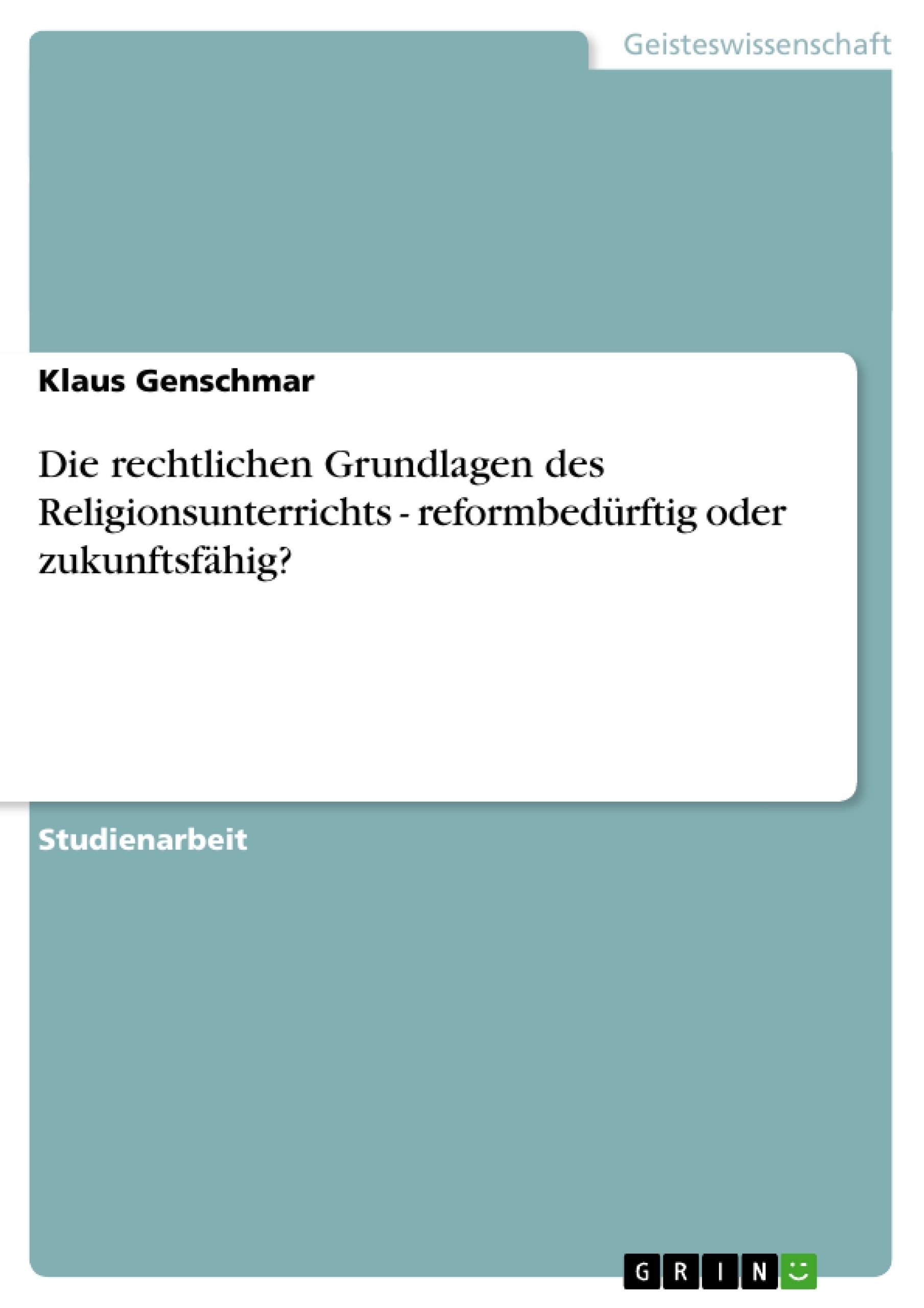Religionsunterricht gehört als ordentliches Schulfach in den Kanon der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, wie Geschichte, Geographie oder Sozialkunde. Im weitesten Sinne dient er der Belehrung über die Inhalte einer Religion. Im erweiterten Sinne ist er ein Schulfach, das nicht nur unterrichten, sondern auch zum Glauben hinführen soll. Dies tut er aber nicht in missionarischer Absicht, sondern in vermittelnder Funktion der jeweiligen Religionen bzw. Konfessionen.
[...]
In dieser Hausarbeit geht es nicht vordergründig um eine direkte Auseinandersetzung mit dem LER-Problem in Brandenburg. Vielmehr soll unter Vorstellung der rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts der Brandenburger Fall exemplarisch herangezogen werden, um abzuwägen, ob die rechtlichen Grundlagen des Grundgesetzes noch zeitgemäß sind oder einer Reform bedürfen. Zudem soll am Beispiel des Brandenburger LER-Falls geprüft werden, ob eine juristische Lösung überhaupt sinnvoll ist und ob man dieses Problem überhaupt juristisch lösen kann. Sind Alternativen zu einer juristischen Lösung vorhanden? Wenn ja, wie könnten diese aussehen? Muss überhaupt eine juristische Lösung her, da die Grundgesetzartikel im Zusammenhang mit den Landesverfassungen sowieso eine freiere und breitere Auslegung erlauben? Als Grundlage für meine Hausarbeit beziehe ich mich hauptsächlich auf das Buch „Einigkeit und Recht und Werte“ von Oermann/Zachuber, da es gerade in Hinsicht auf die rechtlichen Grundlagen die beste Quelle darstellt. Im Vergleich zu anderer Literatur bietet es eine möglichst objektive Einsicht in dieses Problem und gibt dem Leser genügend Freiraum, seinen eigenen Standpunkt zu bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Hauptteil: „Die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts reformbedürftig oder zukunftsfähig“
- 1. Die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts
- 1.1 Geschichtliche Entwicklung
- 1.2 Analyse des Art. 7 Abs. 3 GG
- 1.2.1 Stellung im Grundrechtskatalog
- 1.2.2 Art. 7 Abs. 3 im Zusammenhang mit Art. 4 GG
- 1.2.3 Teilnahme am Religionsunterricht
- 1.2.4 Konfessionelle Gebundenheit des Religionsunterrichts
- 1.2.5 Bekenntnisfreie Schulen im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 GG
- 1.2.6 Ersatzfach Ethik
- 1.3 Analyse des Art. 141 GG
- 1.3.1 Ausnahmeregelung zu Art. 7 Abs. 3 GG
- 1.3.2 Problemfall: Neue Bundesländer und Religionsunterricht
- 1.3.3 Anwendbarkeit des Art. 141 GG auf die neuen Bundesländer und Brandenburg
- 2. Religionsunterrichtsregelung im Grundgesetz – zeitgemäß oder reformbedürftig
- 2.1 Gesellschaftlich-Politischer Aspekt der LER-Debatte
- 2.2 Lösungsansätze
- 2.2.1 Ansatz innerhalb des bestehenden Grundgesetzes I
- 2.2.2 Ansatz innerhalb des bestehenden Grundgesetzes II
- 2.2.3 Ansatz in der Bedeutung des Christentums für die Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob diese Grundlagen reformbedürftig sind oder zukunftsfähig bleiben. Der Fokus liegt auf der Analyse von Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 141 des Grundgesetzes sowie deren Anwendung, insbesondere im Kontext des LER-Streits in Brandenburg. Es wird geprüft, ob eine rein juristische Lösung des Problems ausreichend ist oder ob alternative Lösungsansätze zu bevorzugen sind.
- Analyse der rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts im Grundgesetz
- Bewertung der zeitgemäßen Relevanz von Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 141 GG
- Untersuchung des Brandenburger LER-Falls als Beispiel für die Herausforderungen des Religionsunterrichts
- Diskussion alternativer Lösungsansätze jenseits rein juristischer Perspektiven
- Bewertung des Einflusses gesellschaftlich-politischer Aspekte auf die Diskussion um den Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts in Deutschland, beginnend mit einem geschichtlichen Überblick. Es analysiert detailliert Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes (GG), der den Religionsunterricht als ordentliches Schulfach festschreibt, und setzt ihn in Beziehung zu Artikel 4 GG (Glaubens- und Gewissensfreiheit). Die Analyse umfasst die konfessionelle Gebundenheit, die Möglichkeit bekenntnisfreier Schulen und die Rolle des Ersatzfaches Ethik. Weiterhin wird Artikel 141 GG ("Bremer Klausel") untersucht, der Ausnahmen von Artikel 7 Absatz 3 GG zulässt und im Kontext der neuen Bundesländer und des Brandenburgischen LER-Streits eine besondere Rolle spielt. Die verschiedenen Aspekte des Artikels werden detailliert untersucht, einschließlich der Anwendbarkeit auf die neuen Bundesländer und die Problematik der unterschiedlichen Auslegungen und deren Auswirkungen.
2. Religionsunterrichtsregelung im Grundgesetz – zeitgemäß oder reformbedürftig: Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach der Zeitgemäßheit der bestehenden Rechtsgrundlagen. Es betrachtet den gesellschaftlich-politischen Kontext der Debatte um den Religionsunterricht, insbesondere im Lichte des Brandenburger LER-Streits. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, darunter solche, die innerhalb des bestehenden Grundgesetzes bleiben, und solche, die die Bedeutung des Christentums für die Gesellschaft stärker berücksichtigen. Die Kapitel analysieren die unterschiedlichen Perspektiven und die Schwierigkeiten, eine einvernehmliche Lösung zu finden, die sowohl den rechtlichen Vorgaben als auch den gesellschaftlichen Realitäten gerecht wird. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Argumentationslinien und den Implikationen für die Zukunft des Religionsunterrichts.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Grundgesetz (GG), Artikel 7 Absatz 3, Artikel 141 GG, Bremer Klausel, LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde), Brandenburg, Konfessionelle Gebundenheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Schulrecht, Verfassungsrecht, Gesellschaftliche Entwicklung, Bildung, Pluralität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: „Die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts reformbedürftig oder zukunftsfähig“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts in Deutschland, insbesondere Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 141 des Grundgesetzes (GG). Im Fokus steht die Frage, ob diese Grundlagen reformbedürftig sind oder zukunftsfähig bleiben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem LER-Streit in Brandenburg.
Welche Artikel des Grundgesetzes werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert Artikel 7 Absatz 3 GG (Recht auf Religionsunterricht) und Artikel 141 GG (sogenannte „Bremer Klausel“, die Ausnahmen von Artikel 7 Absatz 3 zulässt). Die Analyse betrachtet die Stellung dieser Artikel im Grundrechtskatalog, ihre Beziehung zueinander (insbesondere zu Artikel 4 GG - Glaubens- und Gewissensfreiheit) und ihre Anwendung in der Praxis, besonders im Kontext der neuen Bundesländer.
Was ist der LER-Streit und seine Bedeutung für die Arbeit?
Der LER-Streit (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) in Brandenburg dient als Fallbeispiel für die Herausforderungen des Religionsunterrichts und die unterschiedlichen Auslegungen von Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 141 GG. Die Arbeit analysiert die Problematik und die daraus resultierenden juristischen und gesellschaftlichen Fragen.
Welche Aspekte des Religionsunterrichts werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die geschichtliche Entwicklung des Religionsunterrichts, die konfessionelle Gebundenheit, die Möglichkeit bekenntnisfreier Schulen, die Rolle des Ersatzfaches Ethik und die Anwendbarkeit von Artikel 141 GG auf die neuen Bundesländer. Sie analysiert die verschiedenen Perspektiven und Argumentationslinien in der Debatte um den Religionsunterricht.
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Lösungsansätze für die Probleme des Religionsunterrichts, sowohl solche, die im Rahmen des bestehenden Grundgesetzes bleiben, als auch solche, die die Bedeutung des Christentums für die Gesellschaft stärker berücksichtigen. Es werden juristische und gesellschaftlich-politische Aspekte berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit bewertet die Zeitgemäßheit der bestehenden Rechtsgrundlagen des Religionsunterrichts und untersucht, ob eine rein juristische Lösung des Problems ausreicht oder ob alternative Lösungsansätze notwendig sind. Sie analysiert die Implikationen für die Zukunft des Religionsunterrichts in Deutschland.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Religionsunterricht, Grundgesetz (GG), Artikel 7 Absatz 3, Artikel 141 GG, Bremer Klausel, LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde), Brandenburg, Konfessionelle Gebundenheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Schulrecht, Verfassungsrecht, Gesellschaftliche Entwicklung, Bildung, Pluralität.
- Citation du texte
- Klaus Genschmar (Auteur), 2004, Die rechtlichen Grundlagen des Religionsunterrichts - reformbedürftig oder zukunftsfähig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75962