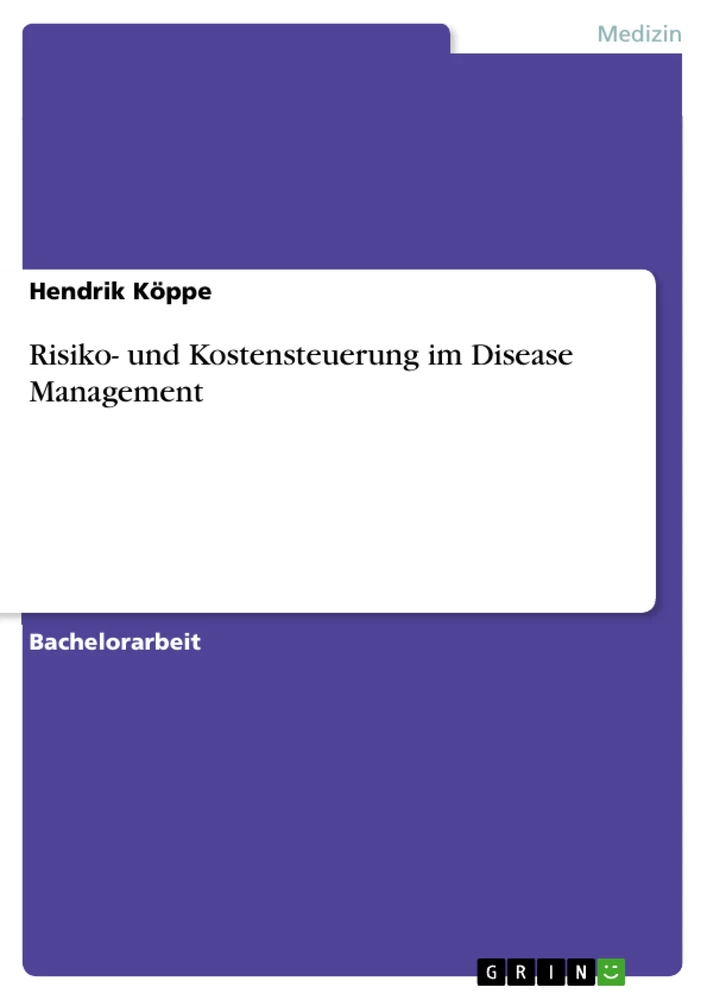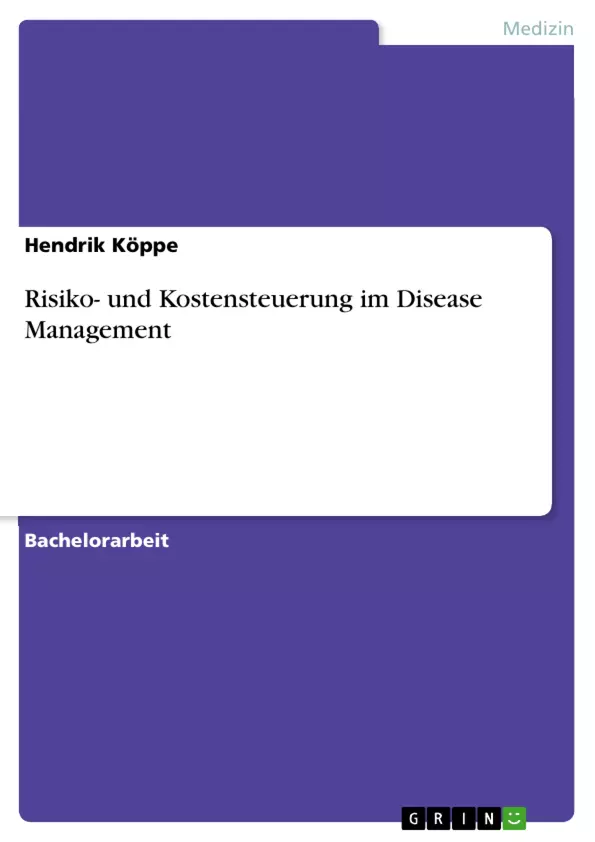„Güter sind knapp und die Gesellschaft muss ihre Ressourcen effizient einsetzen.“
Dies ist eine in der Volkswirtschaft unumstrittene These, welche allgemeingültig für jegliches Wirtschaftshandeln ist. Gesundheit wird als ein Gut höchster Ordnung aufgefasst. Und deshalb ist alles Mögliche möglich zu machen, um sie zu erhalten?
Die aktuellen Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung in Deutschland, wie demographische und wirtschaftliche Entwicklungen und der Fortschritt in der Medizin und Technik begünstigen Kostensteigerungen. Im Gesundheitssystem wird gewirtschaftet, daher gilt auch hier die oben zitierte These. Den Beteiligten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stellen sich in der derzeitigen Situation neue Herausforderungen – die Wirtschaftlichkeitsreserven des Gesundheitssystems aufzudecken und durch Umbildung neue rationalere Wege begehbar zumachen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Integrierte Versorgung und Disease Management
- Definition und Ziele der Integrierten Versorgung
- Gesetzlicher Rahmen der Integrierten Versorgung
- Definition und Ziele des Disease Management
- Merkmale des Disease Management
- Selektion von DM-relevanten Erkrankungen
- Gesetzlicher Rahmen des Disease Managements
- Kostenanalyse vor Abschluss des DM-Vertrags
- Überlegungen zur Ausgestaltung des DM-Vertrags
- Vertragsarten laut Gesetz
- Modellvorhaben
- Strukturverträge
- Integrierte Versorgung
- Fazit
- Weitere inhaltliche Überlegungen
- Risiko-Adjustment
- Erklärungen entscheidender Begriffe
- Risiko
- Finanzielles Risiko
- Risikotypen
- Konzeptionelle Aspekte Pauschaler Vergütung
- Vergütungsformen und Pauschalierung
- Hochpauschalierte Vergütung; Dispositions-spielraum und Risikobeteiligung
- Exkurs Kopfpauschale - Capitation
- Grundlagen der Risikoadjustierung
- Diagnose-basierte Modelle der Risikoadjustierung
- ACG-Modelle
- DCG/HCC-Modelle
- Fazit - Risikoadjustierte Vergütung und Disease Management
- Kostensteuerung nach Vertragsabschluss
- Kreislauf des Disease Managements
- Instrumente der Kostensteuerung im DM
- Guidelines
- Utilization Review und Utilization Management
- Qualitätsmanagement
- Evaluationsverfahren
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management (DM). Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Kosten- und Risikoplanung vor und nach dem Abschluss eines DM-Vertrags zu beleuchten. Die Arbeit analysiert gesetzliche Rahmenbedingungen und verschiedene Modelle der Risikoadjustierung.
- Gesetzliche Rahmenbedingungen des Disease Managements
- Modelle der Risikoadjustierung (z.B. ACG, DCG/HCC)
- Instrumente der Kostensteuerung im DM (z.B. Guidelines, Utilization Review)
- Vertragsgestaltung im Disease Management
- Integrierte Versorgung im Kontext des Disease Managements
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management ein und beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit. Sie skizziert den Kontext und die Relevanz des Themas.
Integrierte Versorgung und Disease Management: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Integrierte Versorgung und Disease Management und beleuchtet deren Ziele und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es werden die Merkmale des DM, die Auswahl relevanter Erkrankungen und die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben detailliert erläutert. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung beider Konzepte und deren gemeinsamem Ziel einer effizienten und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung.
Kostenanalyse vor Abschluss des DM-Vertrags: Dieser Abschnitt analysiert die Überlegungen zur Gestaltung von DM-Verträgen, inklusive verschiedener Vertragsarten (Modellvorhaben, Strukturverträge, Integrierte Versorgung). Ein Schwerpunkt liegt auf der Risikoadjustierung und der Erklärung entscheidender Begriffe wie Risiko und finanzielles Risiko. Verschiedene Modelle der pauschalen Vergütung und deren Vor- und Nachteile werden im Detail diskutiert, inklusive eines Exkurses zur Kopfpauschale. Der Abschnitt schließt mit einer Zusammenfassung der verschiedenen Ansätze der risikoadjustierten Vergütung im Kontext des Disease Managements.
Kostensteuerung nach Vertragsabschluss: Dieses Kapitel beschreibt den Kreislauf des Disease Managements und analysiert verschiedene Instrumente der Kostensteuerung, darunter Guidelines, Utilization Review und Utilization Management sowie Qualitätsmanagement. Die Bedeutung von Evaluationsverfahren zur Überprüfung der Effektivität der Kostensteuerung wird ebenfalls erörtert. Es wird deutlich, wie die im vorherigen Kapitel beschriebenen Risiko- und Kostenmodelle in der Praxis angewendet und überwacht werden.
Schlüsselwörter
Disease Management, Risikoadjustierung, Kostensteuerung, Integrierte Versorgung, Vertragsgestaltung, ACG-Modelle, DCG/HCC-Modelle, Guidelines, Utilization Review, Qualitätsmanagement, Gesetzliche Krankenversicherung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management (DM). Sie beleuchtet die Aspekte der Kosten- und Risikoplanung vor und nach dem Abschluss eines DM-Vertrags, analysiert gesetzliche Rahmenbedingungen und verschiedene Modelle der Risikoadjustierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Gesetzliche Rahmenbedingungen des Disease Managements, Modelle der Risikoadjustierung (ACG, DCG/HCC), Instrumente der Kostensteuerung (Guidelines, Utilization Review), Vertragsgestaltung im DM, und die Integrierte Versorgung im Kontext des DM.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Integrierter Versorgung und Disease Management, Kostenanalyse vor Vertragsabschluss, Kostensteuerung nach Vertragsabschluss und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte und Unterpunkte.
Was wird unter "Integrierte Versorgung und Disease Management" verstanden?
Dieses Kapitel definiert "Integrierte Versorgung" und "Disease Management", erläutert deren Ziele und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es beschreibt die Merkmale des DM, die Auswahl relevanter Erkrankungen und die gesetzlichen Vorgaben. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung beider Konzepte für eine effiziente und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung.
Wie wird die Kostenanalyse vor Vertragsabschluss durchgeführt?
Dieser Abschnitt analysiert die Gestaltung von DM-Verträgen, inklusive verschiedener Vertragsarten (Modellvorhaben, Strukturverträge, Integrierte Versorgung). Ein Schwerpunkt liegt auf der Risikoadjustierung und der Erklärung von Risiko und finanziellem Risiko. Verschiedene Modelle der pauschalen Vergütung werden diskutiert, inklusive eines Exkurses zur Kopfpauschale.
Welche Instrumente der Kostensteuerung werden nach Vertragsabschluss eingesetzt?
Das Kapitel beschreibt den Kreislauf des Disease Managements und analysiert Instrumente der Kostensteuerung wie Guidelines, Utilization Review und Utilization Management sowie Qualitätsmanagement. Die Bedeutung von Evaluationsverfahren zur Überprüfung der Effektivität wird ebenfalls erörtert.
Welche Risikoadjustierungsmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Modelle der Risikoadjustierung, darunter ACG- und DCG/HCC-Modelle. Diese werden im Detail erläutert und im Kontext der pauschalen Vergütung und des Disease Managements eingeordnet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Disease Management, Risikoadjustierung, Kostensteuerung, Integrierte Versorgung, Vertragsgestaltung, ACG-Modelle, DCG/HCC-Modelle, Guidelines, Utilization Review, Qualitätsmanagement und Gesetzliche Krankenversicherung.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Zusammenfassung und der Ausblick fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen im Bereich der Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Inhaltsverzeichnis und die Kapitelzusammenfassungen in der Arbeit bieten detaillierte Informationen zu den einzelnen Aspekten der Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management. Zusätzliche Informationen können über die genannten Schlüsselbegriffe in Fachliteratur und Datenbanken recherchiert werden.
- Citar trabajo
- Hendrik Köppe (Autor), 2004, Risiko- und Kostensteuerung im Disease Management, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76008