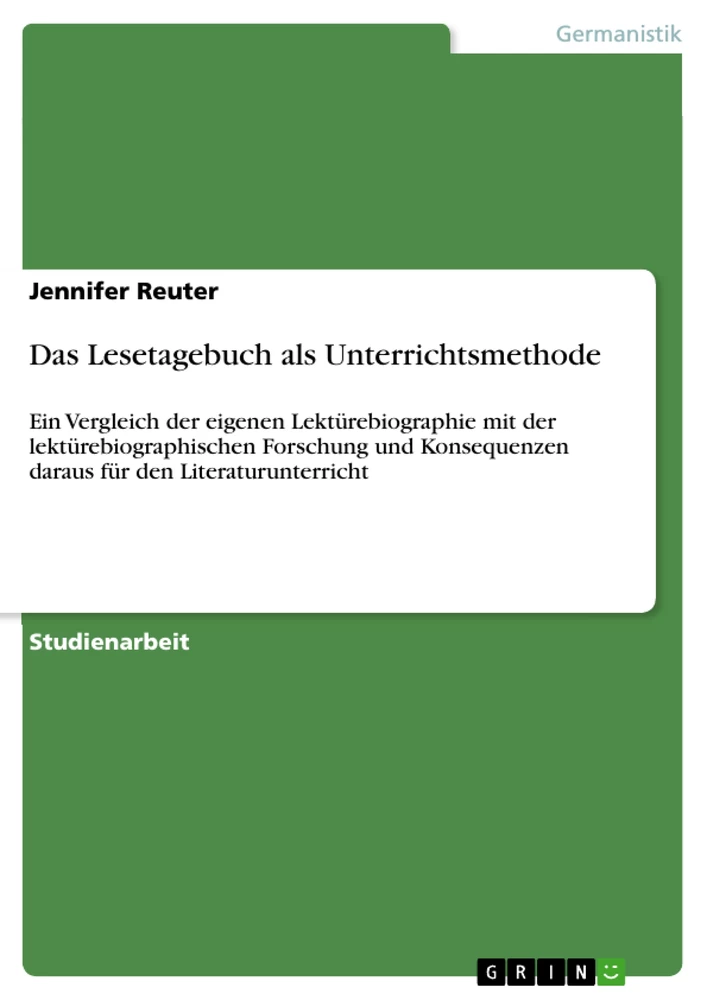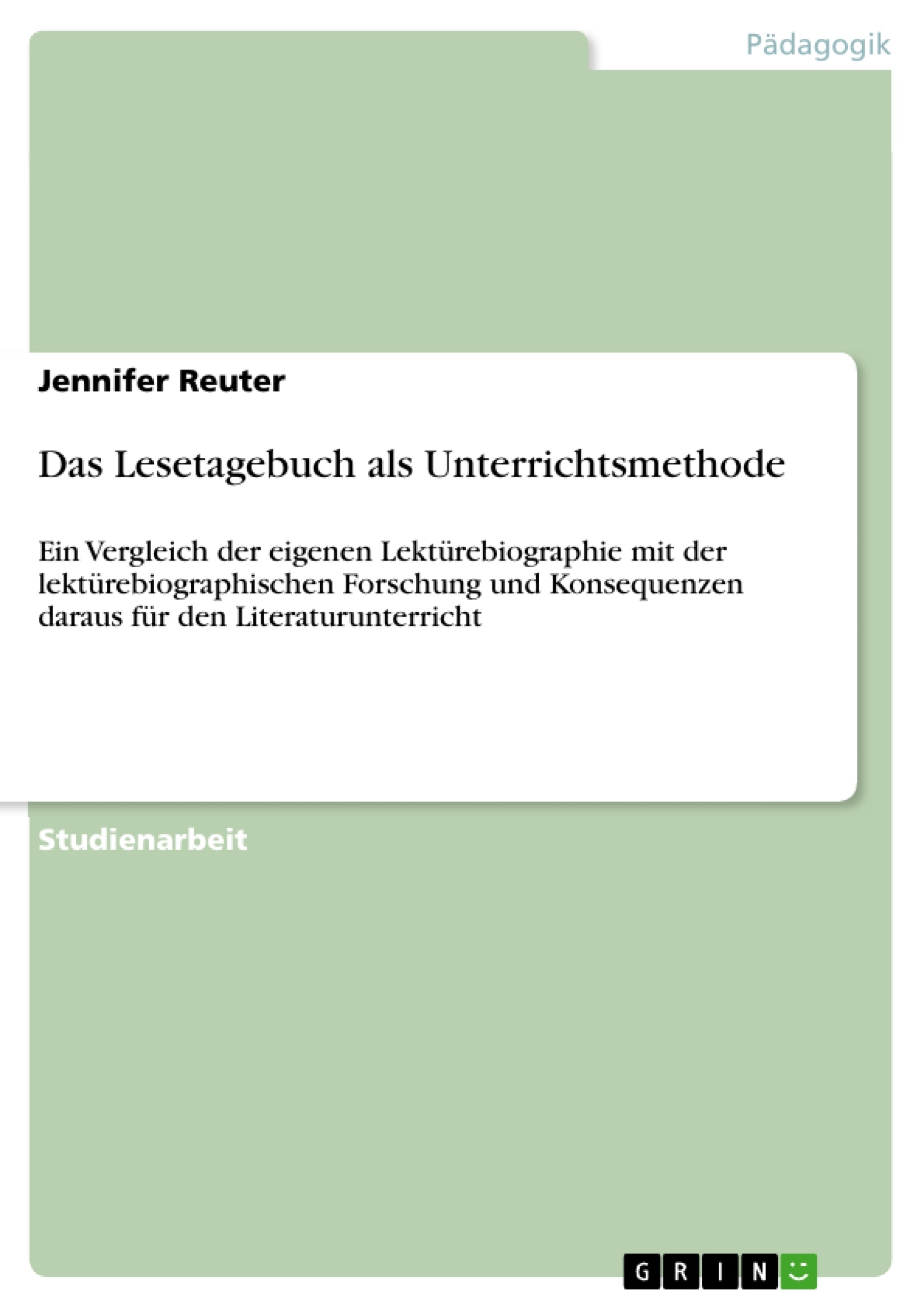Der Deutschunterricht der Grundschule wie auch jener der weiterführenden Schulen hat u.a. die Aufgabe, den Schülern Literatur näher zu bringen und diese zu Lesern zu machen. Der Unterricht hat nicht nur das Ziel, die Kulturtechniken Lesen und Schreiben zu vermitteln, sondern auch den Umgang mit und die Freude an Literatur.
In der heutigen Zeit gibt es viele Erwachsene, die im Freizeitbereich gänzlich auf das Lesen verzichten. Dies kann zahlreiche Gründe haben, wie die fehlenden Lesevorbilder im Elternhaus, ein die Freude am Lesen nehmender Deutschunterricht und andere Interessen. Anhand von Lektürebiographien kann versucht werden, Ursachen von Leseunlust bzw. -lust aufzuspüren, um diesen dann im Deutschunterricht begegnen zu können.
In dieser Hausarbeit werde ich zunächst meine eigene Lektürebiographie erstellen, wobei ich einige Fragen des Interviewleitfadens zur Erstellung von Lektürebiographien von Dagmar Grenz als Anregung genommen habe. Im Anhang befindet sich eine Liste von Büchern, die von mir gelesen wurden. Es muss hinzugefügt werden, dass diese Liste nicht vollständig ist, da einige Bücher sicher in Vergessenheit geraten sind.
An die eigene Lektürebiographie schließt sich ein Vergleich mit der lektürebiographischen Forschung an. Daraus ergeben sich zahlreiche Konsequenzen für den Unterricht, welche ich in Punkt 4 behandeln werde. Dabei interessieren mich vor allem handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtsverfahren, die in meinem Unterricht am Gymnasium kaum eine Rolle spielten. Ich werde mich speziell mit der Methode des Lesetagebuchs auseinandersetzen, welche als Methode des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts eine Fülle von Möglichkeiten des Umgangs mit Literatur bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eigene Lektürebiographie
- Vergleich der eigenen Lektürebiographie mit der lektürebiographischen Forschung
- Konsequenzen für den Unterricht
- Einbeziehung von handlungs- und produktionsorientierten Verfahren in das Unterrichtsgeschehen
- Das Lesetagebuch als Unterrichtsmethode
- Entwicklung des Lesetagebuchs vom Forschungsmittel zur Unterrichtsmethode
- Darstellung der Methode
- Begründung der Methode
- Literaturangaben
- Anhang: Lektüreliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der eigenen Lektürebiographie auf die Gestaltung des Literaturunterrichts. Ziel ist es, durch den Vergleich der persönlichen Leseerfahrungen mit den Ergebnissen lektürebiographischer Forschung, konkrete didaktische Konsequenzen für einen motivierenden und effektiven Literaturunterricht abzuleiten. Besonders im Fokus steht die Methode des Lesetagebuchs als handlungs- und produktionsorientiertes Verfahren.
- Einfluss der familiären Lesekultur auf die Entwicklung der eigenen Lesegewohnheiten
- Vergleich der persönlichen Lektürebiographie mit gängigen lektürebiographischen Forschungsergebnissen
- Konsequenzen für den Literaturunterricht: Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren
- Das Lesetagebuch als Unterrichtsmethode: Entwicklung, Darstellung und Begründung
- Der Einfluss von schulischem Lesestoff auf die Freizeitlektüre
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung des Literaturunterrichts für die Förderung der Lesekompetenz und Lesefreude bei Schülern. Sie verdeutlicht die Relevanz von Lektürebiographien zur Erforschung von Leseunlust und -lust und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der eigenen Lektürebiographie und der daraus resultierenden Konsequenzen für den Unterricht, insbesondere die Anwendung handlungs- und produktionsorientierter Methoden wie des Lesetagebuchs.
Eigene Lektürebiographie: Dieses Kapitel beschreibt die eigene Leseentwicklung im Kontext der familiären Umgebung. Die positive Lesekultur im Elternhaus und die frühkindliche Förderung des Erzählens und Schreibens werden als wichtige Einflussfaktoren hervorgehoben. Es wird detailliert auf die Lieblingsbücher der Kindheit eingegangen, die von Astrid Lindgren und anderen Autoren stammen. Die Kapitel beschreibt weiterhin die Entwicklung der Lesegewohnheiten während der Schulzeit und wie die Freude am Lesen durch schulische Anforderungen beeinflusst wurde. Besonders der Übergang vom positiven Leseerlebnis in der Grundschule zum zunehmenden Druck und der damit verbundenen Abnahme der Lesemotivation in der Mittelstufe wird beleuchtet. Die Bedeutung von Zeitschriften im Jugendalter für die soziale Interaktion und den Austausch mit Freundinnen wird ebenfalls thematisiert.
Vergleich der eigenen Lektürebiographie mit der lektürebiographischen Forschung: Dieses Kapitel fehlt im vorliegenden Text.
Konsequenzen für den Unterricht: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der eigenen Leseerfahrungen auf die didaktische Praxis. Es werden Handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtsverfahren vorgestellt, die im Gegensatz zu den im Gymnasium erlebten Methoden stehen. Besonders die Methode des Lesetagebuchs wird als vielversprechender Ansatz für einen motivierenden Literaturunterricht hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Lektürebiographie, Leseforschung, Literaturunterricht, Leseförderung, Lesemotivation, handlungsorientierter Unterricht, produktionsorientierter Unterricht, Lesetagebuch, Grundschule, Gymnasium, Freizeitlektüre, Schulische Lektüre.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Einfluss der Lektürebiographie auf den Literaturunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der persönlichen Lektürebiographie auf die Gestaltung des Literaturunterrichts. Ziel ist es, durch den Vergleich der eigenen Leseerfahrungen mit Ergebnissen der lektürebiographischen Forschung, konkrete didaktische Konsequenzen für einen motivierenden und effektiven Literaturunterricht abzuleiten. Der Fokus liegt dabei besonders auf der Methode des Lesetagebuchs als handlungs- und produktionsorientiertes Verfahren.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Darstellung der eigenen Lektürebiographie, einen (leider unvollständigen im vorliegenden Auszug) Vergleich dieser mit bestehenden lektürebiographischen Forschungsansätzen, und die daraus abgeleiteten Konsequenzen für den Literaturunterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung, Darstellung und Begründung des Lesetagebuchs als Unterrichtsmethode.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist gegliedert in eine Einleitung, die Darstellung der eigenen Lektürebiographie, einen Vergleich mit lektürebiographischer Forschung (in diesem Auszug fehlt dieser Abschnitt), die Ableitung von Konsequenzen für den Unterricht (mit Fokus auf das Lesetagebuch) und abschließende Literaturangaben sowie einen Anhang mit einer Lektüreliste.
Welche Rolle spielt die eigene Lektürebiographie in der Arbeit?
Die eigene Lektürebiographie bildet die Grundlage der Untersuchung. Sie beschreibt die Entwicklung der Lesegewohnheiten im Kontext der familiären Lesekultur und der schulischen Erfahrungen. Der Einfluss der familiären Lesekultur, die Entwicklung der Lesegewohnheiten während der Schulzeit und die Auswirkungen schulischer Anforderungen auf die Lesemotivation werden detailliert dargestellt. Der Vergleich mit lektürebiographischen Forschungsansätzen soll zeigen, inwiefern die individuellen Erfahrungen repräsentativ für breitere Entwicklungen sind.
Welche didaktischen Konsequenzen werden für den Literaturunterricht gezogen?
Aus der Analyse der eigenen Lektürebiographie werden Konsequenzen für den Literaturunterricht abgeleitet. Es wird argumentiert für handlungs- und produktionsorientierte Verfahren, insbesondere für die Methode des Lesetagebuchs, als Mittel zur Steigerung der Lesemotivation und -kompetenz. Diese Methoden stehen im Kontrast zu den im Gymnasium erlebten Methoden.
Welche Bedeutung hat das Lesetagebuch im Kontext der Arbeit?
Das Lesetagebuch wird als zentrale handlungs- und produktionsorientierte Methode vorgestellt, um einen motivierenden Literaturunterricht zu gestalten. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung des Lesetagebuchs von einem Forschungsmittel zu einer Unterrichtsmethode, stellt die Methode dar und begründet ihren Einsatz.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lektürebiographie, Leseforschung, Literaturunterricht, Leseförderung, Lesemotivation, handlungsorientierter Unterricht, produktionsorientierter Unterricht, Lesetagebuch, Grundschule, Gymnasium, Freizeitlektüre, Schulische Lektüre.
Welche Aspekte der familiären Lesekultur werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der positiven familiären Lesekultur auf die Entwicklung der eigenen Lesegewohnheiten. Die frühkindliche Förderung des Erzählens und Schreibens wird als wichtiger Einflussfaktor hervorgehoben.
Wie wird der Einfluss des schulischen Lesestoffs auf die Freizeitlektüre beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet, wie der schulische Lesestoff die Freizeitlektüre beeinflusst hat. Besonders der Übergang vom positiven Leseerlebnis in der Grundschule zum zunehmenden Druck und der damit verbundenen Abnahme der Lesemotivation in der Mittelstufe wird thematisiert.
- Arbeit zitieren
- Jennifer Reuter (Autor:in), 2005, Das Lesetagebuch als Unterrichtsmethode, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76035