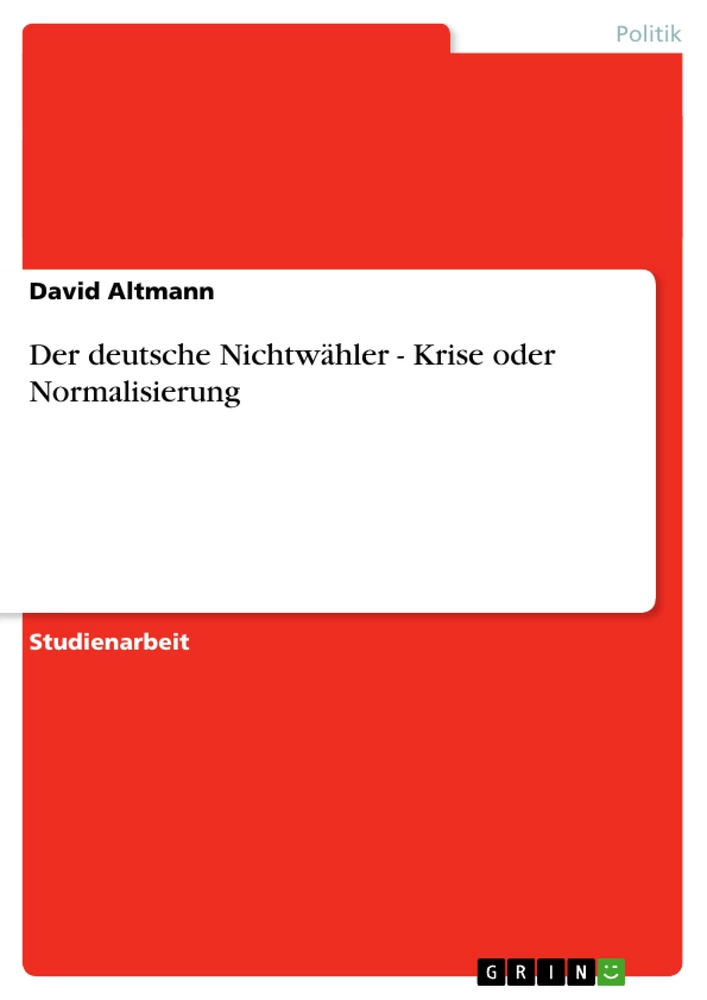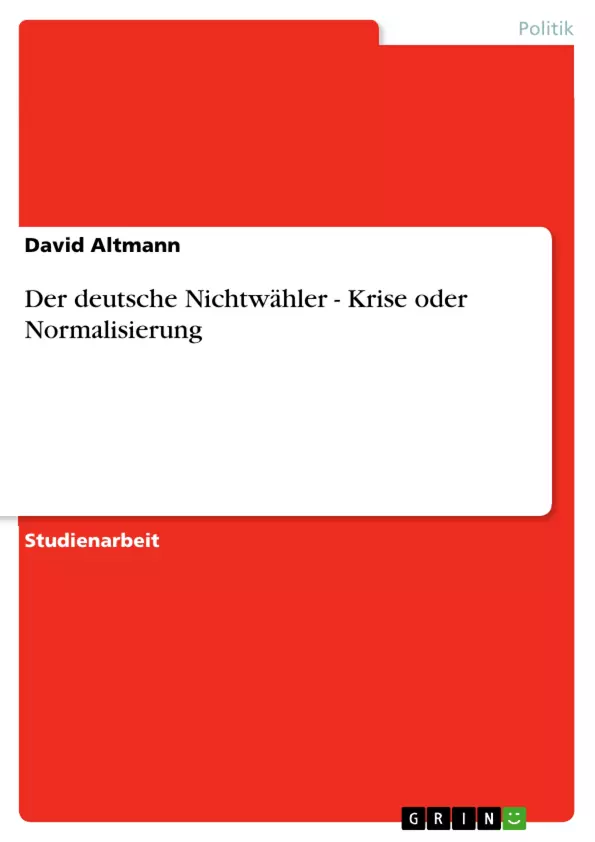"Warst Du heute schon beim Wählen?". "Nö, interessiert mich eh′ nicht."
So oder so ähnlich ergeht es so manchem Politikinteressierten, wenn er es ‚wagt′, sich ein Bild über das generelle Interesse an der Politik und die damit verbundene Wahlbeteiligung zu verschaffen oder aber einfach nur aus reinem Interesse fragt. Dass die Wahlbeteiligung auch in der Bundesrepublik Deutschland konstant rückläufig ist, dürfte wohl jedem halbwegs Interessierten spätestens seit der Bundestagswahl 1990 bekannt sein. Jeder fünfte deutsche Bundesbürger bleibt mittlerweile den Wahlen fern . Angesichts der Tatsache, dass sich eigentlich alle wissenschaftlichen Bearbeiter dieses Themas darüber einig sind, dass das generelle politische Interesse und die Bereitschaft, politisch aktiv zu werden in den letzten 15 Jahren weiter angewachsen ist, ist dieser Beteiligungsrückgang doch überraschend . Grund genug also für Wissenschaftler dieses Thema in diversen Zeitschriften und wissenschaftlichen Arbeiten zu analysieren. Gerade bereits erwähnte Bundestagswahl von 1990 scheint einen wahren Anreiz dargestellt zu haben, nach den Ursachen der Wahlenthaltung zu forschen. Liegt es nun an der generellen Abneigung gegenüber Politikern und Parteien, ist es eine "Normalisierung" im Vergleich zum gesamteuropäischen Bereich, in dem Deutschland trotz alledem immer noch über dem Durchschnitt liegt bei seiner Wahlbeteiligung, mit der Prognose, dass die Wahlbeteiligung in Deutschland die Talsohle somit noch nicht erreicht hat oder kann man von einer generellen "Politikverdrossenheit" der Deutschen sprechen? 1992 wurde das Wort "Politikverdrossenheit" sogar zum Wort des Jahres gewählt . Woran liegt es nun also, dass der bundesdeutsche Bürger den Parteien seine Stimme vorenthält?
Sinn und Zweck dieser Arbeit soll es nun also sein, eine Antwort auf diese Frage zu geben und zwar anhand eines Überblicks über die bereits vorhandene Meinung und Forschungslage der Wissenschaft zu diesem Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einteilung der Nichtwähler
- der verhinderte Nichtwähler
- der konjunkturelle Nichtwähler
- der überzeugte Nichtwähler
- verschiedene Erklärungsansätze für Nichtwahl
- sozialstrukturelle Gründe
- Alter
- Geschlecht
- Konfessionszugehörigkeit und Kirchenbindung
- sozioökonomischer Status: Beruf und Bildung
- sozialer Integrationsgrad
- Elternhaus und Erziehung
- sozialpsychologische Gründe
- politisches Interesse
- Parteiidentifikation und Parteibindung
- Einstellung zur Wahlpflicht
- Beurteilung der Spitzenkandidaten und Parteien während des Wahlkampfes
- Attraktivität der (Wahlkampf-)Themen
- soziogeographischer Faktor
- Wertewandel
- zunehmender Medieneinfluss
- sozialstrukturelle Gründe
- Unterschied Ost - West
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Nichtwählens in Deutschland. Sie analysiert die Gründe für die sinkende Wahlbeteiligung und versucht, die Ursachen für die Wahlenthaltung zu erforschen. Die Arbeit gibt einen Überblick über die aktuelle Forschungslage zum Thema und betrachtet verschiedene Erklärungsansätze für Nichtwahl.
- Einteilung der Nichtwähler in verschiedene Kategorien
- Analyse sozialstruktureller Gründe für Nichtwahl
- Untersuchung sozialpsychologischer Faktoren
- Bedeutung des soziogeographischen Faktors
- Einbezug des Wertewandels und des zunehmenden Medieneinflusses
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort stellt die Relevanz des Themas Nichtwahl in Deutschland dar und führt in die Thematik ein. Es zeigt die Brisanz der sinkenden Wahlbeteiligung auf und beleuchtet den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Im zweiten Kapitel wird eine Einteilung der Nichtwähler vorgenommen. Es werden verschiedene Kategorien von Nichtwählern unterschieden, die sich durch ihre Gründe und Motive für die Wahlenthaltung unterscheiden. Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Erklärungsansätze für Nichtwahl. Es werden sowohl sozialstrukturelle als auch sozialpsychologische Gründe betrachtet. Die Analyse umfasst Faktoren wie Alter, Geschlecht, Konfessionszugehörigkeit, sozioökonomischer Status, sozialer Integrationsgrad, Elternhaus und Erziehung, politisches Interesse, Parteiidentifikation und Parteibindung, Einstellung zur Wahlpflicht, Beurteilung der Spitzenkandidaten und Parteien während des Wahlkampfes sowie die Attraktivität der (Wahlkampf-)Themen. Zusätzlich werden der soziogeographische Faktor, der Wertewandel und der zunehmende Medieneinfluss als weitere Einflussfaktoren auf das Nichtwahlverhalten betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Phänomens des Nichtwählens in Deutschland. Dabei stehen die verschiedenen Gründe und Motive für die Wahlenthaltung im Vordergrund. Im Fokus der Arbeit stehen die folgenden Schlüsselbegriffe: Nichtwahl, Wahlbeteiligung, Wahlverhalten, sozialstrukturelle Faktoren, sozialpsychologische Faktoren, soziogeographischer Faktor, Wertewandel, Medieneinfluss, politisches Interesse, Parteiidentifikation, Parteibindung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kategorien von Nichtwählern werden in der Forschung unterschieden?
Wissenschaftler unterscheiden meist zwischen dem "verhinderten" Nichtwähler (z. B. durch Krankheit), dem "konjunkturellen" Nichtwähler (entscheidet je nach Attraktivität der Wahl) und dem "überzeugten" Nichtwähler (bewusste politische Verweigerung).
Was sind die wichtigsten sozialstrukturellen Gründe für Nichtwahl?
Zu den zentralen Faktoren zählen das Alter (jüngere Menschen wählen seltener), der Bildungsstand, der sozioökonomische Status sowie der Grad der sozialen Integration und die kirchliche Bindung.
Was versteht man unter dem Begriff "Politikverdrossenheit"?
Politikverdrossenheit beschreibt eine allgemeine Abneigung oder Gleichgültigkeit gegenüber dem politischen System, den Parteien und Politikern. Sie wird oft als Hauptgrund für sinkende Wahlbeteiligungen angeführt.
Wie beeinflussen die Medien das Wahlverhalten?
Der zunehmende Medieneinfluss kann zur Personalisierung des Wahlkampfs führen. Wenn Themen oder Kandidaten medial als wenig attraktiv wahrgenommen werden, kann dies die Wahlbeteiligung negativ beeinflussen.
Gibt es Unterschiede im Nichtwählerverhalten zwischen Ost- und Westdeutschland?
Ja, die Forschung zeigt oft differenzierte Muster in den neuen Bundesländern, die teilweise auf unterschiedliche Sozialisationserfahrungen und eine geringere langfristige Parteibindung zurückzuführen sind.
Warum ist politisches Interesse kein Garant für eine hohe Wahlbeteiligung?
Obwohl das politische Interesse in der Bevölkerung teilweise gewachsen ist, sinkt die Wahlbeteiligung. Dies deutet darauf hin, dass Bürger andere Formen der Partizipation wählen oder von den bestehenden parlamentarischen Angeboten enttäuscht sind.
- Citar trabajo
- Dipl. Kulturwirt Univ. David Altmann (Autor), 2001, Der deutsche Nichtwähler - Krise oder Normalisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7603