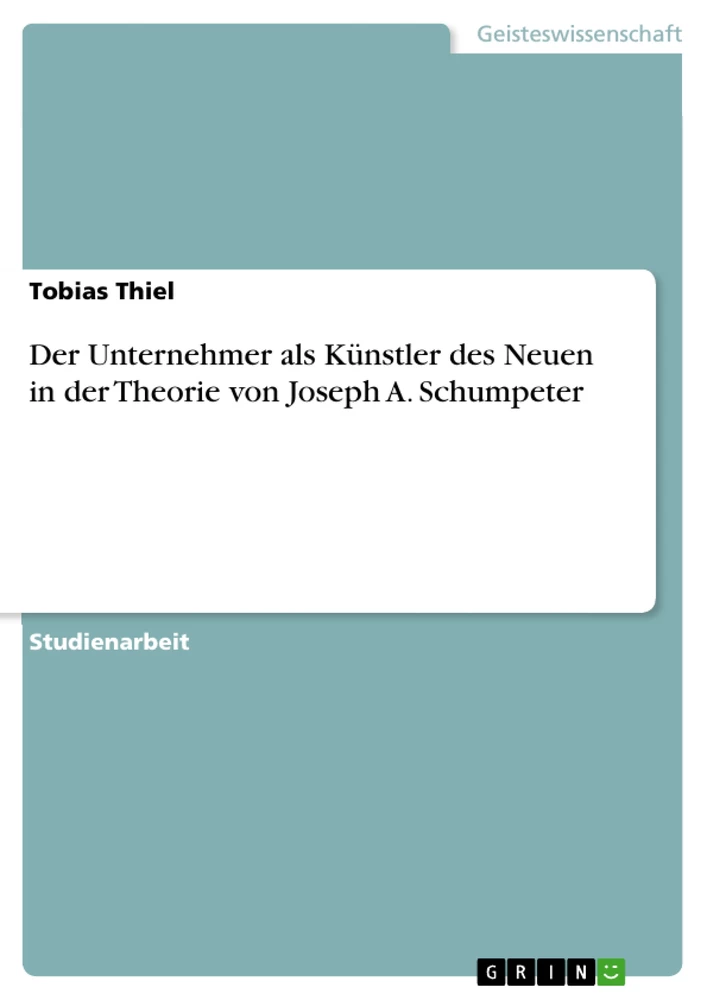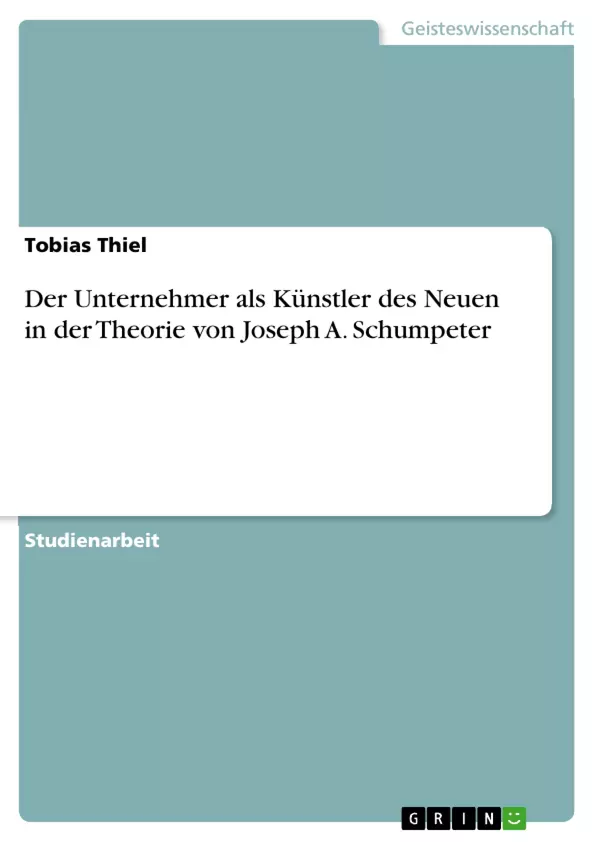Joseph Alois Schumpeter in die Geschichte des ökonomischen Denkens richtig einzuordnen, fällt nicht leicht, da sich Schumpeters Werk selbst als Erkenntnisprozess darstellt, das mannigfachen Veränderungen unterworfen war. Zudem sind die Umstände zu berücksichtigen, unter denen Schumpeter seine Gedanken entworfen hat. In diesem Zusammenhang spielt im deutschsprachigen Raum der damaligen Zeit insbesondere der Methodenstreit zwischen der Österreichischen Grenznutzenschule einerseits und der Historischen Schule andererseits eine wichtige Rolle. Schumpeter selbst wird in vielen ökonomischen Werken der österreichischen Schule zugeordnet. Obwohl es unstrittig ist, dass er in den Traditionen dieser Schule ausgebildet wurde und in ihren Denkmustern seine wissenschaftliche Laufbahn begonnen hat, unterschlägt eine derartige Festlegung den oben genannten Erkenntnisprozess in Schumpeters Denken. Dieser Prozess kann dabei in fünf Phasen unterteilt werden. Dabei stammt das Werk, das im Zentrum dieser Arbeit stehen wird, also die „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, aus der zweiten Phase, in welcher Schumpeter eine theoretische Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung anstrebte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung und Hinführung zum Thema
- I.1. Die wissenschaftstheoretische und methodologische Einordnung von Schumpeters Nationalökonomie
- I.2. Der Kreislauf der Wirtschaft
- II. Der Begriff des Neuen in den Überlegungen von Joseph Alois Schumpeter
- II.1. Der Typus des Unternehmers
- II.2. Schöpferische Zerstörung
- III. Exkurs: der Begriff der „produktiven Zerstörung“ bei Horst Bredekamp
- IV. Fazit - die Bedeutung von Schumpeters Ökonomie des Neuen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Joseph Alois Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere seinen Begriff des Neuen und die Rolle des Unternehmers im kapitalistischen System. Sie beleuchtet Schumpeters methodologische Einordnung in die ökonomische Theoriegeschichte und analysiert seine Kritik am Kreislaufmodell der Wirtschaft. Die Arbeit fokussiert sich auf die Darstellung von Schumpeters Verständnis von Innovation und „schöpferischer Zerstörung“.
- Methodologische Einordnung von Schumpeters Nationalökonomie
- Der Kreislauf der Wirtschaft und Schumpeters Kritik
- Der Unternehmer als Gestalter des Neuen
- Der Begriff der „schöpferischen Zerstörung“
- Bedeutung von Schumpeters Theorie für das 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung und Hinführung zum Thema: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen bei der Einordnung von Schumpeters Werk in die Geschichte des ökonomischen Denkens. Sie hebt den Methodenstreit zwischen der Österreichischen Grenznutzenschule und der Historischen Schule hervor und beschreibt Schumpeters Entwicklung in fünf Phasen. Besonderes Augenmerk liegt auf Schumpeters frühen und späten Werken, „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ und „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“, sowie der Spannung zwischen neoklassischen und historistischen Ansätzen in seinem Denken.
I.1. Die wissenschaftstheoretische und methodologische Einordnung von Schumpeters Nationalökonomie: Dieses Kapitel analysiert die methodologische Position Schumpeters im Kontext des Methodenstreits zwischen der Österreichischen Schule und der Historischen Schule. Es zeigt, dass Schumpeter zwar in der Tradition der Österreichischen Schule verwurzelt war, aber bestrebt war, beide Ansätze zu vereinen. Sein Werk wird als ein fortwährender Erkenntnisprozess dargestellt, der sich in fünf Phasen unterteilen lässt. Die Arbeit konzentriert sich auf die zweite Phase, in der Schumpeter eine theoretische Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung anstrebte.
I.2. Der Kreislauf der Wirtschaft: Dieses Kapitel behandelt Schumpeters Kritik am traditionellen Kreislaufmodell der Wirtschaft. Er argumentiert, dass dieses Modell wirtschaftliche Entwicklung nicht erklären kann, da es lediglich bestehende Abläufe beschreibt. Schumpeter kontrastiert den „praktischen Wirt“ mit seinem Konzept des Unternehmers, der durch Innovation den Kreislauf durchbricht. Der Fokus liegt auf der Darstellung der statischen Natur des Kreislaufmodells und der Notwendigkeit eines dynamischeren Modells, welches Innovation und Unternehmergewinn berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Joseph Alois Schumpeter, ökonomische Entwicklung, Unternehmer, Innovation, schöpferische Zerstörung, Kapitalismus, Kreislauf der Wirtschaft, Österreichische Schule, Historische Schule, Methodenstreit, neoklassische Theorie, Historismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der ökonomischen Theorie von Joseph Alois Schumpeter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ökonomische Theorie von Joseph Alois Schumpeter, insbesondere seine Konzepte von Innovation, dem Unternehmertum und der „schöpferischen Zerstörung“. Sie untersucht seine methodologische Einordnung in die ökonomische Theoriegeschichte und seine Kritik am traditionellen Kreislaufmodell der Wirtschaft. Ein Fokus liegt auf der Bedeutung seiner Theorien für das 21. Jahrhundert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die methodologische Einordnung von Schumpeters Werk im Kontext des Methodenstreits zwischen der Österreichischen und der Historischen Schule; Schumpeters Kritik am Kreislaufmodell der Wirtschaft; die Rolle des Unternehmers als Gestalter des Neuen; der Begriff der „schöpferischen Zerstörung“; und die Bedeutung von Schumpeters Theorie für das 21. Jahrhundert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Herausforderungen bei der Einordnung von Schumpeters Werk. Die Kapitel behandeln die methodologische Einordnung von Schumpeters Nationalökonomie, seine Kritik am Kreislaufmodell der Wirtschaft, den Begriff des „Neuen“ und einen Exkurs zu Horst Bredekamps Verständnis der „produktiven Zerstörung“. Das Fazit bewertet die Bedeutung von Schumpeters Theorie für das 21. Jahrhundert.
Was ist Schumpeters Kritik am Kreislaufmodell der Wirtschaft?
Schumpeter kritisiert das traditionelle Kreislaufmodell, weil es wirtschaftliche Entwicklung nicht erklären kann, da es nur bestehende Abläufe beschreibt. Er argumentiert, dass Innovationen durch Unternehmer den Kreislauf durchbrechen und dynamisches Wachstum ermöglichen. Das statische Kreislaufmodell wird mit Schumpeters dynamischem Modell kontrastiert, welches Innovation und Unternehmergewinn berücksichtigt.
Welche Rolle spielt der Unternehmer in Schumpeters Theorie?
Der Unternehmer ist in Schumpeters Theorie der zentrale Akteur, der durch Innovation den wirtschaftlichen Kreislauf durchbricht und Entwicklung vorantreibt. Er ist der Gestalter des „Neuen“ und der treibende Kraft der „schöpferischen Zerstörung“. Schumpeter unterscheidet den „praktischen Wirt“ vom innovativen Unternehmer.
Was bedeutet „schöpferische Zerstörung“ in Schumpeters Kontext?
Die „schöpferische Zerstörung“ beschreibt den Prozess, bei dem Innovationen bestehende Strukturen und Unternehmen zerstören, aber gleichzeitig neue, effizientere und produktivere Strukturen hervorbringen. Dieser Prozess ist nach Schumpeter ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Fortschritts.
Wie wird Schumpeters Werk methodologisch eingeordnet?
Schumpeters methodologische Position wird im Kontext des Methodenstreits zwischen der Österreichischen und der Historischen Schule analysiert. Die Arbeit zeigt, dass Schumpeter, obwohl in der Tradition der Österreichischen Schule verwurzelt, bestrebt war, beide Ansätze zu vereinen. Sein Werk wird als ein fortwährender Erkenntnisprozess dargestellt, der in fünf Phasen unterteilt werden kann.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Joseph Alois Schumpeter, ökonomische Entwicklung, Unternehmer, Innovation, schöpferische Zerstörung, Kapitalismus, Kreislauf der Wirtschaft, Österreichische Schule, Historische Schule, Methodenstreit, neoklassische Theorie, Historismus.
- Citar trabajo
- Tobias Thiel (Autor), 2006, Der Unternehmer als Künstler des Neuen in der Theorie von Joseph A. Schumpeter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76071