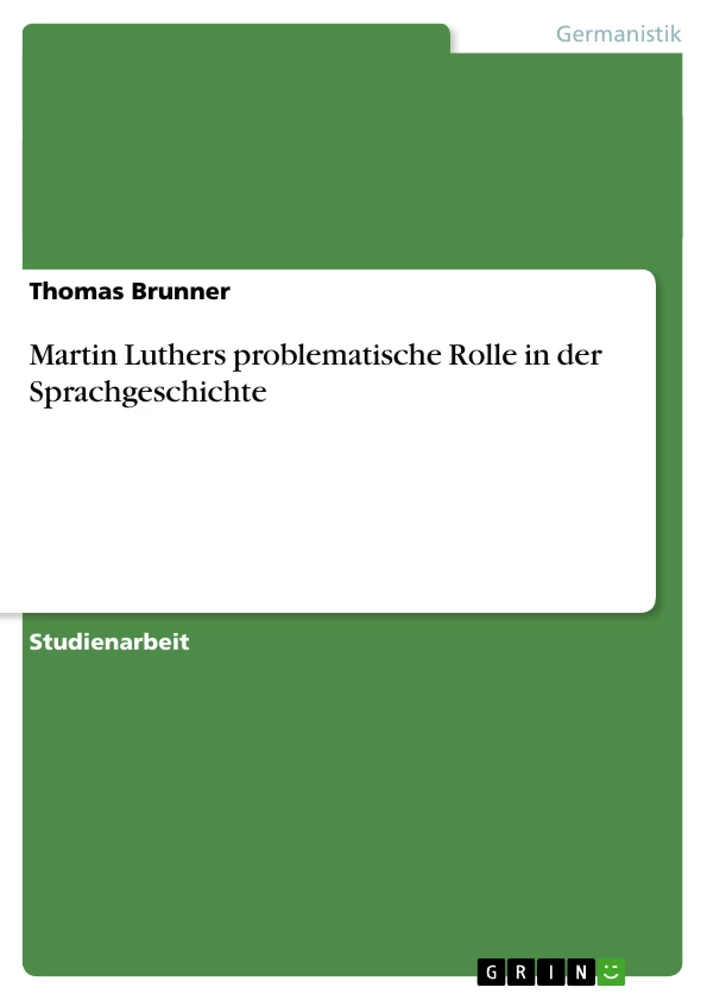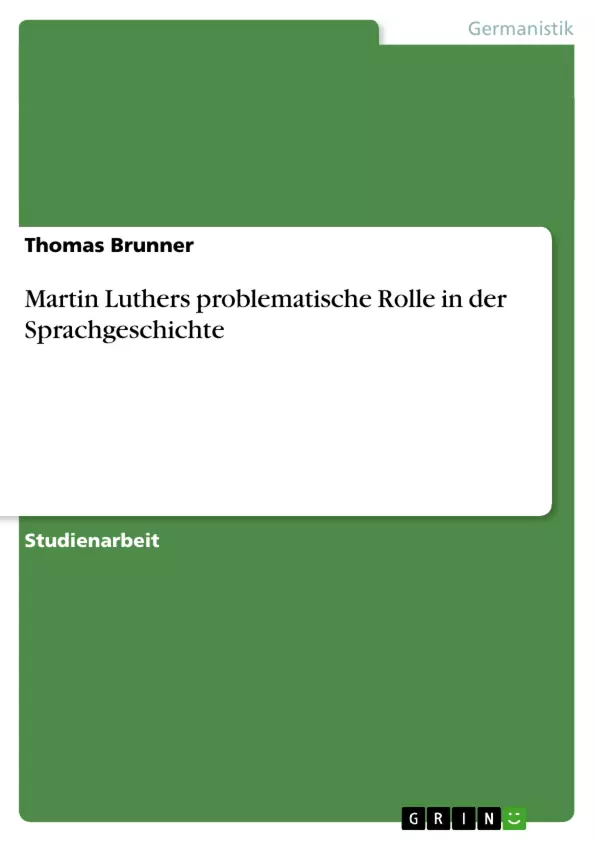Bei der Betrachtung von Dokumenten des 16. Jahrhunderts sticht die Willkür der Schriftsetzung ins Auge, sodass von einer sprachlichen Einheitlichkeit in der Zeit Luthers nicht die Rede sein kann. Luther war, wie von Jakob Grimm angenommen, nicht der „Erfinder“ der neuhochdeutschen Sprache. Ebenso ist Friedrich Kluges Aussage „Luthers Sprache sei seit 1580 zur Norm für unser Schriftdeutsch geworden“ unhaltbar. Mit welcher Berechtigung kommen dann Aussagen wie die von Grimm und Kluge zustande? Tatsache ist, dass die Wirkung der Schriften Luthers in dessen Zeit, vor allem die Bibelübersetzung, immens war. Luthers Bibelübersetzung überwand erstmals die damals herrschende sprachliche Uneinheitlichkeit im deutschen Sprachraum durch die Anfertigung einer für alle Sprachregionen befriedigenden deutschen Übersetzung. Mit Hilfe der Erfindung des Buchdruckes wurde Luthers Übersetzung im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitet. Infolgedessen wurde die Übersetzung der Bibel von mehr Menschen rezipiert als jedes andere Schriftwerk zuvor.
Vor Luther gab es bereits 14 hochdeutsche und vier niederdeutsche gedruckte Bibelausgaben. Als Vorlage dienten vor allem die griechische Septuaginta und die lateinische Vulgata. Luther hingegen übersetzte die hebräischen und griechischen Urtexte und verwendete für seine Bibelübersetzung das ostmitteldeutsche Idiom seiner Heimat, in dem nord- und süddeutsche Dialekte verschmolzen waren. Zwischen 1534 und 1626 wurden allein in Wittenberg knapp einhundert Bibelausgaben hergestellt, die insgesamt circa 200000 Exemplare umfassten. Wenn Luther auch nicht der „Erfinder“ der neuhochdeutschen Sprache war, so überdauerte sein Schaffen doch Hunderte von Jahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachwandel im 16. Jahrhundert
- Der nationale Aspekt
- Der soziologische Aspekt
- Der regionale Aspekt
- Luthers Sprache
- Einordnung des lutherischen Sprachraumes und die wettinische Kanzlei
- Die Entwicklung der lutherischen Sprache
- Inhaltliche Überarbeitung der Vorgänger
- Luthers Orthographie
- Lexikalische Neuerungen bei Luther
- Überalterung der Luthersprache
- Glossen zu Luthers Bibel
- Konkurrenz durch andere Übersetzer
- Luthers individuelle Leistung bei der Bibelübersetzung
- Theologischer Hintergrund
- Luthers Prinzipien bei der Übersetzung
- Luthers „besondere“ Übersetzungstechnik
- Luthers Wirkung auf die folgenden Generationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Wirkung Martin Luthers auf die deutsche Sprache. Sie untersucht die sprachlichen Neuerungen Luthers, die er im 16. Jahrhundert bei seiner Bibelübersetzung einführte, und analysiert die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Entwicklung der neuhochdeutschen Sprache.
- Luthers sprachliches Umfeld und die Besonderheiten der Sprache im 16. Jahrhundert
- Die Bedeutung des Buchdrucks für die Entwicklung der deutschen Sprache
- Die linguistischen Neuerungen Luthers in seiner Bibelübersetzung
- Die langfristige Wirkung von Luthers Bibelübersetzung auf die deutsche Sprache
- Die Entwicklung von Standardisierungsprozessen in der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von Luthers Wirken für die Entwicklung der neuhochdeutschen Sprache dar und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie räumt mit gängigen Mythen über Luther als "Erfinder" der neuhochdeutschen Sprache auf und betont die Bedeutung seiner Bibelübersetzung für die Verbreitung einer einheitlicheren Sprache im deutschsprachigen Raum.
- Sprachwandel im 16. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel der deutschen Sprache im 16. Jahrhundert im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es wird die Bedeutung von Latein als lingua franca in dieser Zeit hervorgehoben und die Entstehung eines bürgerlichen Selbstverständnisses, das die Entwicklung der deutschen Sprache forcierte, analysiert.
- Luthers Sprache: Das Kapitel analysiert Luthers Sprachgebrauch und seine Einordnung in das sprachliche Umfeld seiner Zeit. Es beleuchtet die Herausforderungen, die die Übersetzung des Bibeltextes aus dem Hebräischen und Griechischen in eine einheitliche deutsche Sprache mit sich brachte und die Rolle Luthers bei der Überwindung der bestehenden sprachlichen Uneinheitlichkeit im deutschsprachigen Raum.
- Luthers Orthographie: Dieses Kapitel befasst sich mit Luthers orthografischen Neuerungen und deren Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Rechtschreibung.
- Lexikalische Neuerungen bei Luther: Dieses Kapitel beleuchtet die neuen Wörter und Redewendungen, die Luther in seine Bibelübersetzung einbrachte und die sich dauerhaft in der deutschen Sprache etablierten.
- Überalterung der Luthersprache: Dieses Kapitel untersucht die langfristigen Auswirkungen von Luthers Sprachgebrauch auf die deutsche Sprache und analysiert, wie sich seine sprachlichen Neuerungen mit der Zeit entwickelten und teilweise an Bedeutung verloren.
- Luthers individuelle Leistung bei der Bibelübersetzung: Dieses Kapitel analysiert Luthers Übersetzungstechnik und dessen theologische Motivationen bei der Bibelübersetzung. Es zeigt, wie Luthers Arbeit die Sprache der deutschen Bibel prägte und die deutsche Sprache bis heute beeinflusst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprachwandel, Bibelübersetzung, Standardisierung, deutsche Sprachgeschichte, Sprachgeschichte des 16. Jahrhunderts, Luthersprache, Sprachnormen, plurizentrische Sprachen, Buchdruck, Orthographie, Lexik, Übersetzungstechnik, und linguistische Einflussfaktoren.
- Citar trabajo
- Thomas Brunner (Autor), 2007, Martin Luthers problematische Rolle in der Sprachgeschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76147