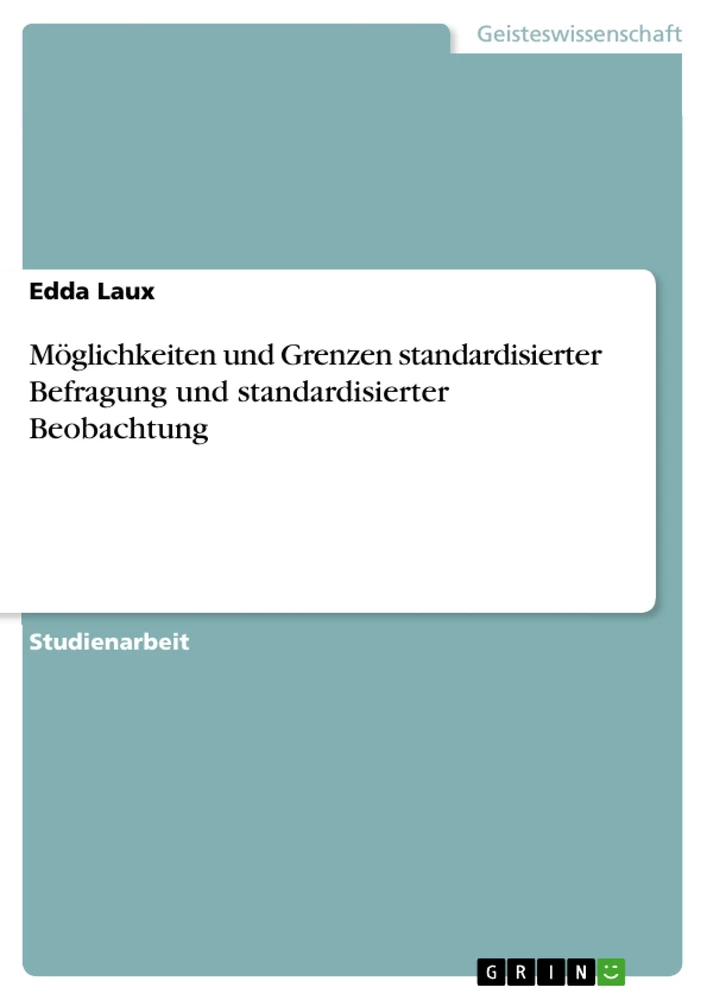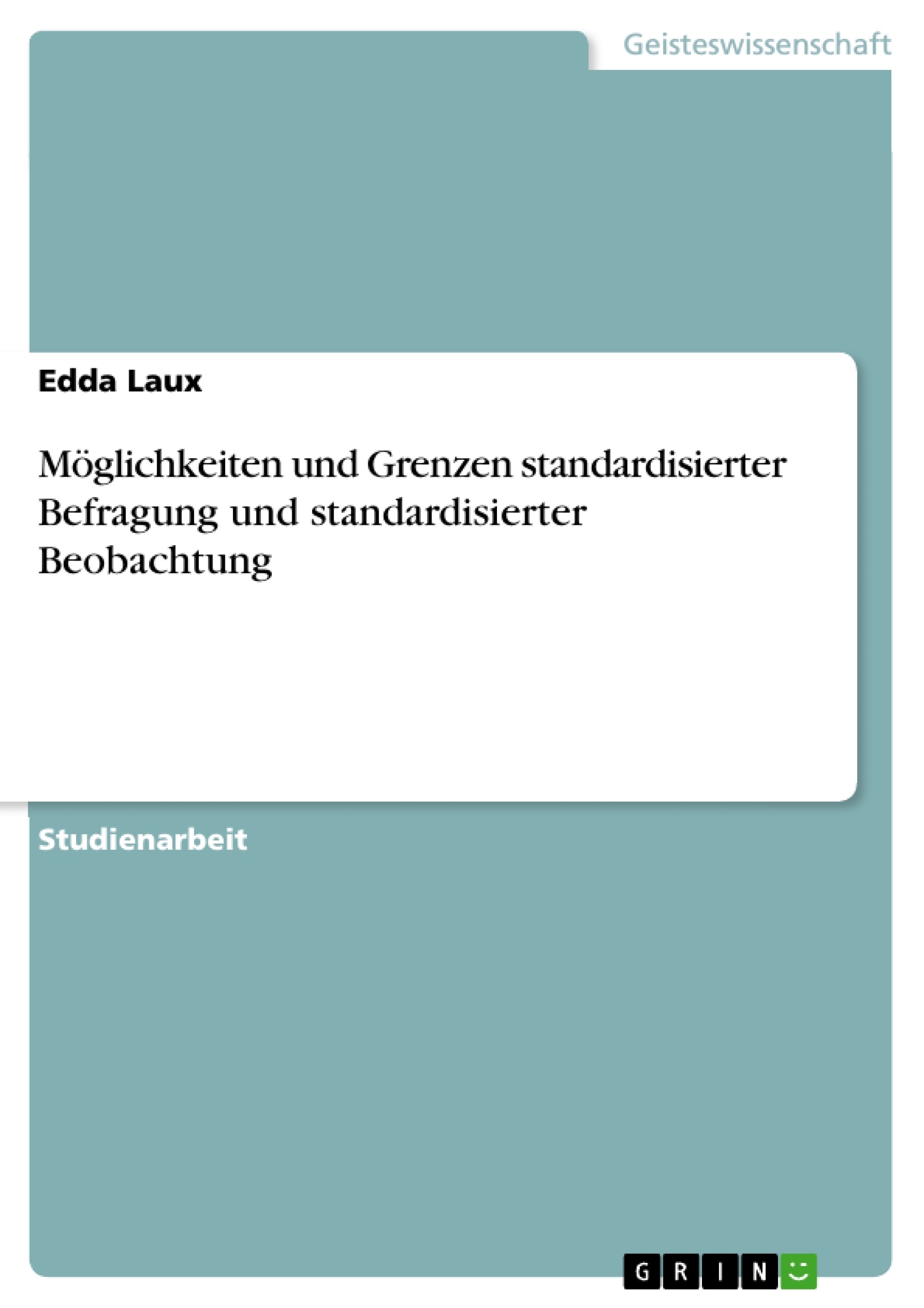Aus der Einleitung:
Standardisierte Methoden zählen zu den quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung. Sie sollen im Gegensatz zu nicht oder sehr wenig standardisierten Methoden, welche zu den qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung gezählt werden, den Grad der Objektivität erhöhen. Sie erheben den Anspruch, zum Beispiel an das standardisierte Interview, dass höchstmögliche Objektivität, damit Reliabilität und schließlich auch Validität erreicht werden soll. Wobei hier „den Kriterien der Objektivität und Reliabilität wohl stärker Rechnung“ getragen wird.
Mit den Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung von Methoden werde ich mich in der vorliegenden Hausarbeit näher beschäftigen.
Im Folgenden wird diese anhand einer Auswahl standardisierter Datenerhebungsformen, der Befragung und der Beobachtung, erläutert.
Zu Beginn steht die Vorstellung und anschließenden Diskussion von drei möglichen, beziehungsweise häufig verwendeten Formen der standardisierten Befragung. Anschließen werde ich die kritische Betrachtung der standardisierten Beobachtung.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG
- DIE FACE-TO-FACE BEFRAGUNG
- DIE TELEFONBEFRAGUNG
- KRITISCHE BETRACHTUNG VON MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN STANDARDISIERTER BEFRAGUNG
- FORMEN DER SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN BEOBACHTUNG
- DIE STRUKTURIERTE BEOBACHTUNG
- KRITISCHE BETRACHTUNG VON MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER STANDARDISIERTEN BEOBACHTUNG
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung von Methoden in der empirischen Sozialforschung. Der Fokus liegt dabei auf standardisierten Befragungen und Beobachtungen, die als quantitative Methoden zur Erhöhung der Objektivität dienen. Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile verschiedener standardisierter Datenerhebungsformen und diskutiert die potenziellen Herausforderungen bei ihrer Anwendung.
- Analyse der Möglichkeiten und Grenzen von Standardisierung in der empirischen Sozialforschung
- Diskussion verschiedener Formen der standardisierten Befragung (schriftlich, face-to-face, telefonisch)
- Bewertung der Vor- und Nachteile jeder Befragungsform
- Untersuchung der standardisierten Beobachtung als quantitative Methode
- Identifizierung von Herausforderungen und potenziellen Limitationen in der Anwendung standardisierter Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Standardisierung von Methoden in der empirischen Sozialforschung ein. Es werden die Ziele der Arbeit erläutert und die Standardisierung von Methoden als ein Mittel zur Objektivitätssteigerung im Vergleich zu qualitativen Verfahren dargestellt.
- Formen standardisierter Befragung: Dieses Kapitel stellt drei gängige Formen der standardisierten Befragung vor: schriftliche Befragung, face-to-face Interview und computergestützte Telefonbefragung (CATI). Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden diskutiert, beispielsweise die Kosten, die Ausfallquoten und der Einfluss von Interviewereffekten.
- Formen der sozialwissenschaftlichen Beobachtung: Dieses Kapitel widmet sich der standardisierten Beobachtung als einer weiteren quantitativen Methode. Es werden verschiedene Formen der Beobachtung vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der strukturierten Beobachtung liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der standardisierten Befragung und Beobachtung in der empirischen Sozialforschung. Dabei werden wichtige Konzepte wie Objektivität, Reliabilität, Validität, Interviewereffekt und Ausfallquoten behandelt. Es werden verschiedene Formen der Befragung (schriftlich, face-to-face, telefonisch) und der Beobachtung (strukturiert) analysiert. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen dieser standardisierten Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile standardisierter Befragungen?
Sie erhöhen die Objektivität, Reliabilität und Validität der Daten. Zudem ermöglichen sie die Erhebung großer Fallzahlen bei vergleichsweise geringen Kosten.
Welche Formen der standardisierten Befragung gibt es?
Die gängigsten Formen sind die schriftliche Befragung (Fragebogen), das Face-to-Face-Interview und die telefonische Befragung (oft computergestützt als CATI).
Was ist ein Interviewereffekt?
Ein Interviewereffekt tritt auf, wenn die Anwesenheit oder das Verhalten des Interviewers die Antworten der befragten Person unbewusst beeinflusst.
Was versteht man unter strukturierter Beobachtung?
Dabei wird das Verhalten von Personen nach einem vorher festgelegten Schema beobachtet und protokolliert, um subjektive Deutungen des Beobachters zu minimieren.
Wo liegen die Grenzen der Standardisierung?
Standardisierte Methoden können komplexe individuelle Hintergründe oft nicht erfassen und bieten wenig Raum für unerwartete Antworten oder tiefergehende Erklärungen.
- Citation du texte
- Edda Laux (Auteur), 2002, Möglichkeiten und Grenzen standardisierter Befragung und standardisierter Beobachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76178