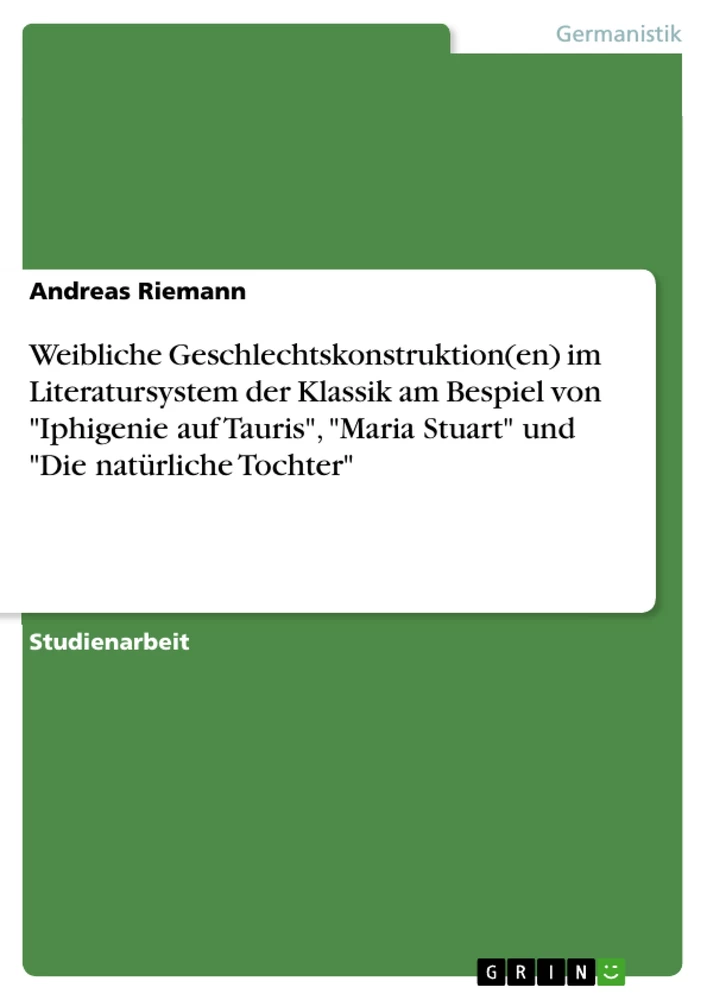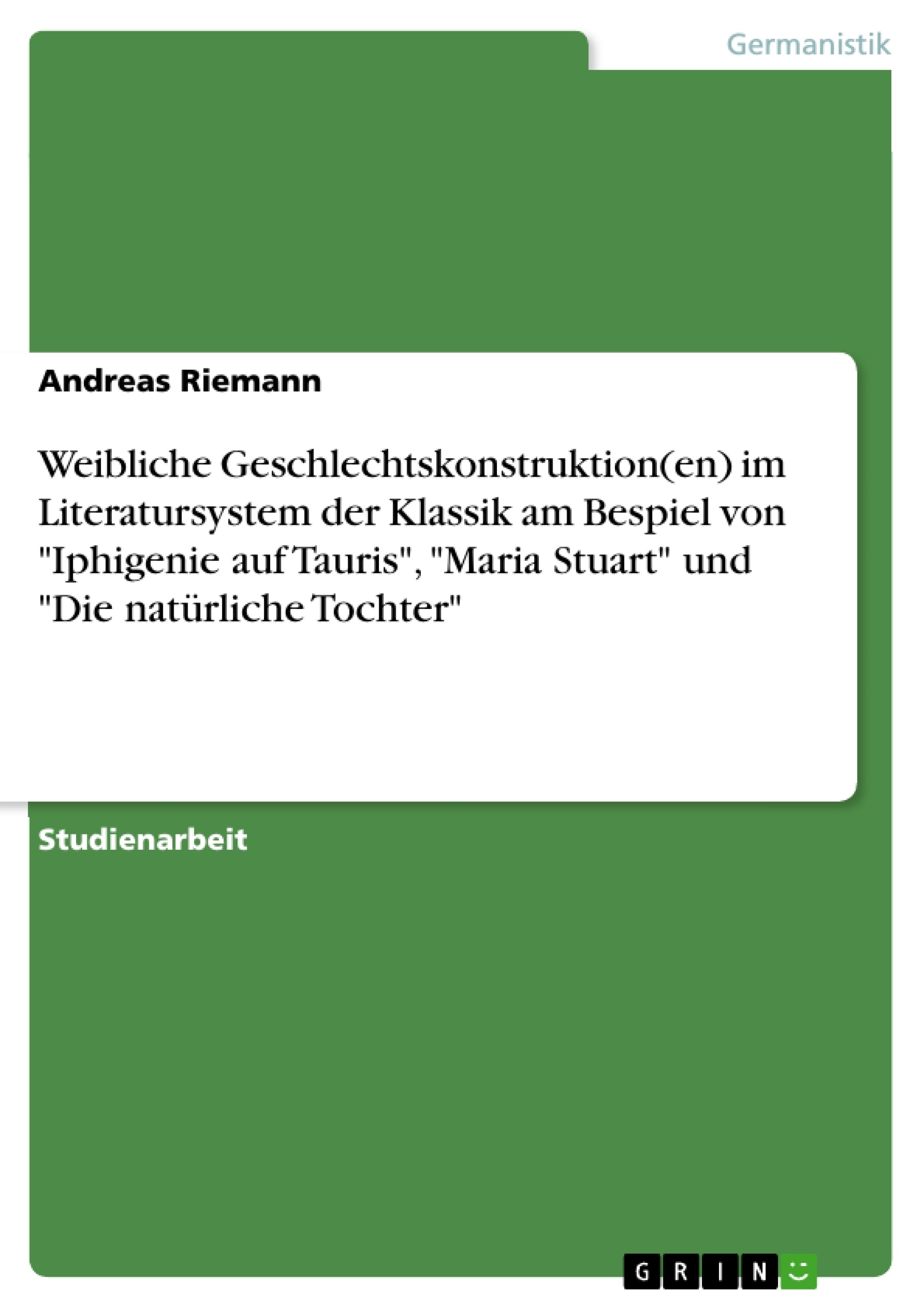Viele Interpreten „klassischer“ Dramentexte , die weibliche Herrschaftsausübung themati-sieren, neigen in den meisten Fällen zu Fehldeutungen. Ausgehend von originär männli-chen Machtansprüchen und -kategorien transformieren sie maskuline Herrschaftstinteres-sen auf den Bereich der von den Texte inszenierten weiblichen Vormachtstellung. Am Beispiel von Goethes IAT stellt Wolfdietrich Rasch fest: „Es ist erstaunlich, in welchem Maße bei der Interpretation der ,Iphigenie‘ [dabei] elementare Grundsätze vernachlässigt werden.“ Versteht man also diesen Text als Drama der (weiblichen) „Autonomie“ und Selbstbestimmung, emanzipiert sich das ,Weibliche‘ zwingend vom dominant ,Männlichen‘ und wird dabei gleichrangiges Äquivalent. In der nun folgenden Darstellung möchte ich diese These widerlegen, insofern ich die ,Frau‘ in den Texten DNT, IAT und MS vielmehr als Störung männlicher Machtinteressen sehe, die als Katalysator mangelnder männlicher Herrschaftskompetenz funktionalisiert wird.
Bei den Ausführungen nehme ich im Besonderen Bezug auf Michael Titzmanns Aufsätze zum Literatursystem der Goethezeit, wobei die „Regeln“ zur Bildungs-/Initiationsgeschichte bzgl. der hier zu untersuchenden dramatischen Erzähltexte modifi-ziert und im Hinblick auf den speziell ,weiblichen‘ Untersuchungsgegenstand erst noch „destilliert“ werden müssen. Im Kontrast dazu sollen diesen Regel-Thesen bisherige Inter-pretationsversuche gegenüber gestellt werden. Neben diesem weiblichen Regel-System , das allein auf die textinternen semiotischen Systeme rekurriert und nicht auf einem speziel-len Gender-Ansatz, sollen vor allem Entwicklungen der ,Frauenkonstruktion(en)‘ heraus-gearbeitet werden.
Daran schließt sich ein weiterer Untersuchungsaspekt an: (Wie) Reagieren die Texte auf die veränderten politisch-gesellschaftlichen Strukturen (z.B. in Frankreich; Französische Revolution)? Um eine mögliche Veränderung nachzuvollziehen, wurden die Texte deshalb so ausgewählt, dass zwei (IAT; MS) vor und einer (DNT) nach den französischen Ereignis-sen verfasst worden sind . Aus Gründen der vorgegebenen Seitenzahlen kann jeweils nur ein Text exemplarisch repräsentativ für die anderen als „Beweis“ verwendet werden, mög-liche Systemänderungen und Regularitäten zu belegen. Ausnahmen davon werden in den Anmerkungen erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Frau als Störung männlicher Machtinteressen
- II. Dichotome Geschlechterkonstruktion
- II.1 Normkonventionen für das,Weibliche'
- II.2 Normverletzung des,Weiblichen“ und Sanktionen
- III. Sexuelle Applikationen des,Weiblichen
- III.1 Promiskuität….
- IV.,,Dürfen Frauen regieren?“.
- IV.1 Defizitäre Herrschaftsstrukturen weiblicher Potentatinnen am Beispiel Königin Elisabeths...
- IV.2 Weibliche Herrschaftslegitimation(en) ....
- V. Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung ....
- V.1 Inszenierung weiblicher Autonomie am Beispiel Iphigenie..........\li>
- V.2,Formen und Ursachen der Fremdbestimmung
- VI. Entwicklung weiblicher Personenkonstruktion(en) im Literatursystem der Klassik
- VII. Das, Weibliche' als Katalysator mangelnder, männlicher Herrschaftskompetenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konstruktion des „Weiblichen“ im Literatursystem der Klassik anhand der Dramen „Iphigenie auf Tauris“, „Maria Stuart“ und „Die natürliche Tochter“. Ziel ist es, zu analysieren, wie die Frau als Störung männlicher Machtinteressen dargestellt wird und welche Folgen dies für die Figuren und das Gesamtsystem hat.
- Die Konstruktion des „Weiblichen“ in der Klassik
- Die Frau als Störung männlicher Machtinteressen
- Normkonventionen und Sanktionen für das „Weibliche“
- Weibliche Autonomie vs. Fremdbestimmung
- Die Rolle der Frau als Katalysator männlicher Herrschaftsprobleme
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Die Frau als Störung männlicher Machtinteressen: Dieses Kapitel beleuchtet, wie die Frau in klassischen Dramen oft als Störung männlicher Machtinteressen dargestellt wird. Es wird argumentiert, dass die Frau nicht als autonomes Subjekt, sondern als Katalysator männlicher Herrschaftsprobleme gesehen wird.
- Kapitel II: Dichotome Geschlechterkonstruktion: Dieses Kapitel untersucht die strenge Trennung zwischen „Mann“ und „Frau“ im Literatursystem der Klassik. Es zeigt auf, wie das „Weibliche“ mit negativen Eigenschaften und das „Männliche“ mit positiven Merkmalen verbunden wird.
- Kapitel III: Sexuelle Applikationen des,Weiblichen: Das Kapitel analysiert die sexualisierten Konnotationen des „Weiblichen“ im Kontext der klassischen Dramen. Es wird die Rolle der Promiskuität und des Ehebruchs als Sanktionen für die Verletzung weiblicher Normen untersucht.
- Kapitel IV: „Dürfen Frauen regieren?“: Dieses Kapitel betrachtet die Frage nach der weiblichen Herrschaftslegitimation. Es analysiert, wie weibliche Herrscherinnen dargestellt werden und welche Defizite ihnen zugeschrieben werden.
- Kapitel V: Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung: Das Kapitel fokussiert auf die Spannung zwischen weiblicher Autonomie und Fremdbestimmung. Es analysiert, wie weibliche Figuren ihre Autonomie inszenieren und welche Mechanismen zu ihrer Fremdbestimmung führen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Geschlechterkonstruktion, weibliche Autonomie, männliche Machtinteressen, Normkonventionen, Sanktionen, Promiskuität, Ehebruch, weibliche Herrschaftslegitimation, und das Literatursystem der Klassik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Dramen werden in dieser Arbeit zur Geschlechterkonstruktion analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Goethes "Iphigenie auf Tauris" und "Die natürliche Tochter" sowie Schillers "Maria Stuart".
Wie wird die Rolle der Frau in den klassischen Dramen interpretiert?
Die Frau wird primär als Störung männlicher Machtinteressen gesehen und als Katalysator für mangelnde männliche Herrschaftskompetenz funktionalisiert.
Was bedeutet "dichotome Geschlechterkonstruktion" im Kontext der Klassik?
Es beschreibt die strenge Trennung zwischen männlichen (positiv besetzten) und weiblichen (negativ besetzten) Eigenschaften im Literatursystem.
Welche Konsequenzen hat die Verletzung weiblicher Normen in diesen Texten?
Normverletzungen werden oft durch sexuelle Applikationen wie den Vorwurf der Promiskuität oder durch gesellschaftliche Sanktionen geahndet.
Wird der Einfluss der Französischen Revolution in der Arbeit berücksichtigt?
Ja, die Arbeit untersucht, wie die Texte auf veränderte politisch-gesellschaftliche Strukturen reagieren, indem Werke vor und nach der Revolution verglichen werden.
- Citation du texte
- Andreas Riemann (Auteur), 2006, Weibliche Geschlechtskonstruktion(en) im Literatursystem der Klassik am Bespiel von "Iphigenie auf Tauris", "Maria Stuart" und "Die natürliche Tochter", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76202