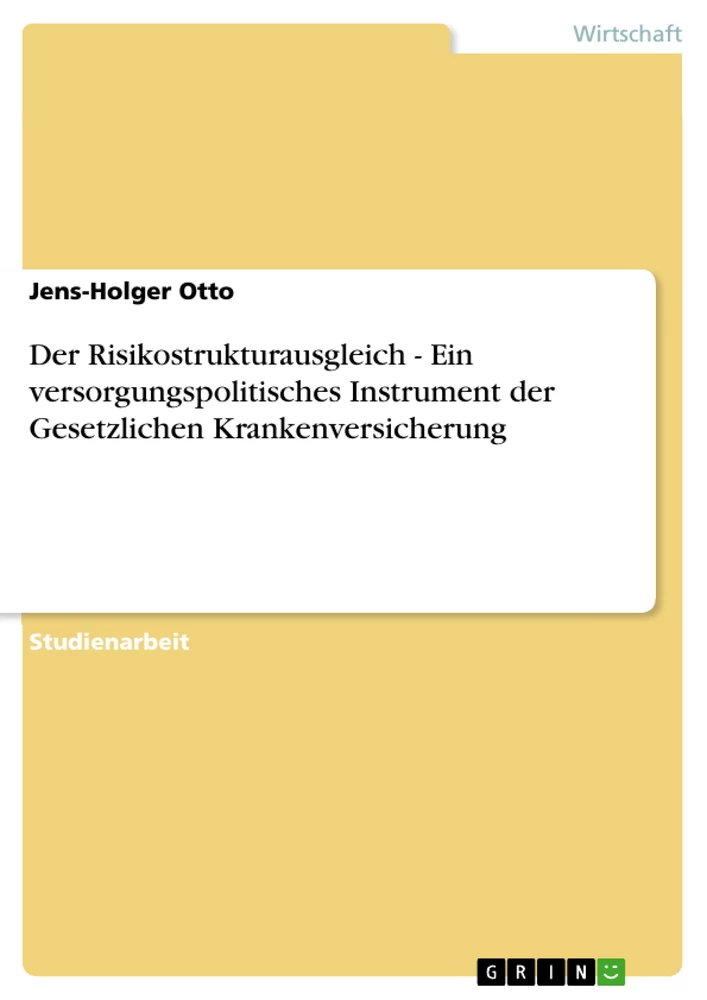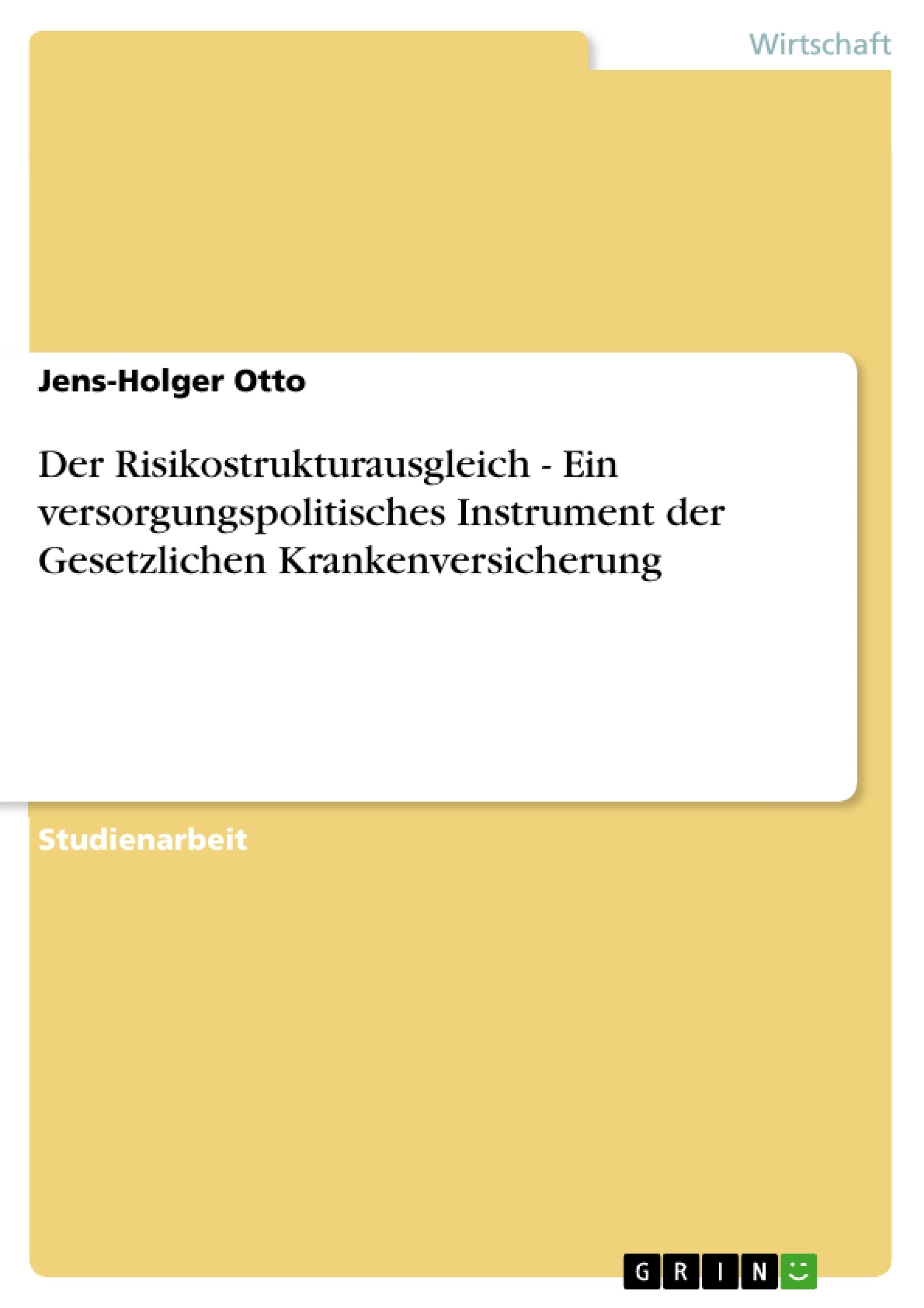Mit Wirkung zum 01. Januar 1994 führte der Gesetzgeber mit dem Gesundheitsstrukturgesetz den Risikostrukturausgleich (RSA) ein. Dieser bildet zusammen mit dem Recht der freien Krankenkassenwahl das Kernstück der Organisationsreform der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Der Gesetzgeber verfolgt dabei die Intension, einerseits mehr Solidarität und Beitragsgerechtigkeit zu schaffen, indem historisch gewachsene regionale, berufsspezifische und betriebliche Grenzen und Strukturen bisheriger solidarischer Umverteilungsprozesse aufgelöst wurden. Andererseits sollte der RSA mit seinem Ordnungsrahmen den Wettbewerb der Krankenkassen auf Felder kreativer Gestaltung des Leistungsgeschehen lenken und Risikoselektion unattraktiv machen.
Doch bereits kurz nach Einsetzen des Wettbewerbs unter den Krankenkassen waren spürbare Wechselströme hin zu beitragssatzgünstigen Krankenkassen zu beobachten. Vorwürfe kamen von Vertretern hochpreisiger Kassen auf, dass diese Beitragssatzdivergenzen nicht auf Grund ineffizienter Ressourcenverwendung bei der Leistungserstellung bestehen, sondern das trotz RSA die „Billigkassen“ gezielt gute Risiken attrahieren, um so wiederum daraus Beitragssatzvorteile zu generieren.
Zur Über-, Unter- und Fehlversorgung hat der SVRKAiG mit seinem Gutachten 2000/2001 ausgeführt, dass sich über unterschiedliche Krankheiten hinweg konvergente Muster von Über-, Unter- und Fehlversorgung erkennen lassen, die offenkundig auf eine begrenzte Zahl von überholten Paradigmen und Versorgungsgewohnheiten zurückzuführen sind. Es besteht ein deutliches Missverhältnis zwischen Überversorgung im kurativen Bereich einerseits und einer Unterversorgung im Bereich der Prävention und Rehabilitation chronisch Kranker andererseits.
Basierend auf diesen Erkenntnissen initiierte der Gesetzgeber 2001 eine Reform des Risikostrukturausgleiches mit Wirkung zum 01.01.2002, womit die oben beschriebenen Fehlsteuerungen gemindert und langfristig beseitigt werden.
Mit dieser Arbeit wird dargelegt, dass der Risikostrukturausgleich nicht nur ein Finanzierungssystem der Gesetzlichen Krankenversicherung ist. Dieses soll letztendlich nur den Boden bereiten. Vielmehr sollen die Bedürfnisse der Versicherten nach mehr Wirtschaftlichkeit und Qualität in der Leistungserbringung in den Mittelpunkt rücken. Insbesondere ist hier die Versorgung der chronisch Kranken anzuführen. Der Risikostrukturausgleich wird so zu einem versorgungspolitischen Instrument in der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Funktion und Wirkung des Risikostrukturausgleiches
- Hintergrund und Zielsetzung
- Das technische Verfahren
- Reflektion der Zielsetzung
- Disease-Management-Programme als Reformkonsequenz
- Zielsetzung und Definition
- Einbindung der Disease-Management-Programme in den RSA
- Chancen und Risiken
- Reformausblick
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Risikostrukturausgleich (RSA) als ein Instrument der deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Sie untersucht die ursprüngliche Zielsetzung des RSA, die in der Schaffung von mehr Solidarität und Beitragsgerechtigkeit sowie in der Lenkung des Wettbewerbs der Krankenkassen lag. Die Arbeit betrachtet insbesondere die problematische Versorgungssituation chronisch Kranker und beleuchtet die Auswirkungen des RSA auf die Versorgung dieser Patientengruppe.
- Der Risikostrukturausgleich als Instrument zur Steigerung der Solidarität und Beitragsgerechtigkeit
- Der RSA und seine Auswirkungen auf den Wettbewerb der Krankenkassen
- Die Herausforderungen der Versorgung chronisch Kranker im Kontext des RSA
- Die Integration von Disease-Management-Programmen in den RSA
- Die Reform des Risikostrukturausgleiches
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung beleuchtet die Entstehung und den Hintergrund des Risikostrukturausgleiches im Kontext der deutschen Gesundheitsreform. Sie analysiert die ursprünglichen Zielsetzungen des RSA und die Herausforderungen, die sich im Wettbewerb der Krankenkassen ergeben haben.
Kapitel 2 befasst sich mit der Funktionsweise und der Wirkung des Risikostrukturausgleiches. Es analysiert das technische Verfahren, das zur Verteilung der Mittel im RSA angewandt wird, und reflektiert die Zielsetzung im Lichte der Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung.
Kapitel 3 untersucht die Integration von Disease-Management-Programmen in den Risikostrukturausgleich. Es analysiert die Zielsetzung und die Definition der Disease-Management-Programme, ihre Einbindung in den RSA und die damit verbundenen Chancen und Risiken.
Kapitel 4 gibt einen Ausblick auf die anstehende Reform des Risikostrukturausgleiches, die den Wechsel von sozioökonomischen zu morbiditätsorientierten Merkmalen bei der Klassifizierung der Versicherten beinhaltet.
Schlüsselwörter
Risikostrukturausgleich, Gesetzliche Krankenversicherung, Solidarität, Beitragsgerechtigkeit, Wettbewerb, chronisch Kranke, Disease-Management-Programme, Versorgung, Reform.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Risikostrukturausgleich (RSA)?
Ein Finanzierungssystem in der gesetzlichen Krankenversicherung, das Beitragsunterschiede zwischen Kassen aufgrund unterschiedlicher Versichertenstrukturen (Alter, Geschlecht, Krankheit) ausgleicht.
Warum wurde der RSA 1994 eingeführt?
Um Solidarität und Beitragsgerechtigkeit zu schaffen und den Wettbewerb der Krankenkassen weg von der Risikoselektion hin zur Qualität der Versorgung zu lenken.
Was sind Disease-Management-Programme (DMP)?
Strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke, die durch den RSA gefördert werden, um Fehl- und Unterversorgung in diesem Bereich abzubauen.
Was bedeutet "Risikoselektion"?
Der Versuch von Krankenkassen, gezielt "gute Risiken" (junge, gesunde Mitglieder) anzuwerben, um niedrige Beitragssätze anbieten zu können; der RSA soll dies unattraktiv machen.
Wie hat sich der RSA durch die Reform 2002 verändert?
Die Reform zielte darauf ab, Fehlsteuerungen zu beseitigen und insbesondere die Versorgung chronisch Kranker durch die Einbindung morbiditätsorientierter Merkmale zu verbessern.
- Citar trabajo
- Dipl. Kfm. (FH) Jens-Holger Otto (Autor), 2006, Der Risikostrukturausgleich - Ein versorgungspolitisches Instrument der Gesetzlichen Krankenversicherung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76223