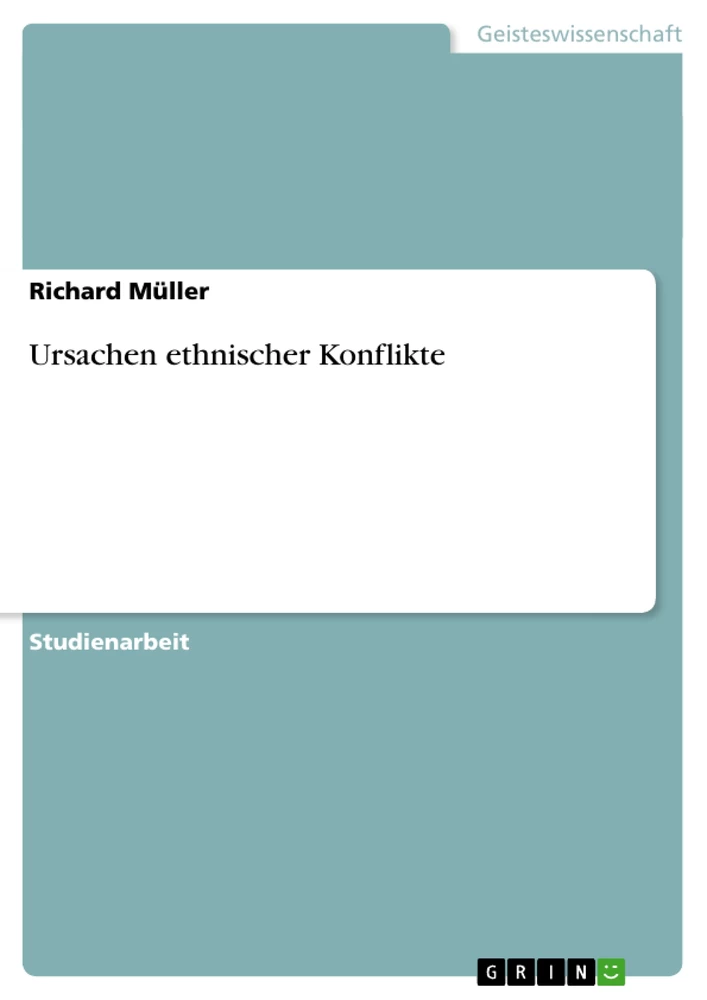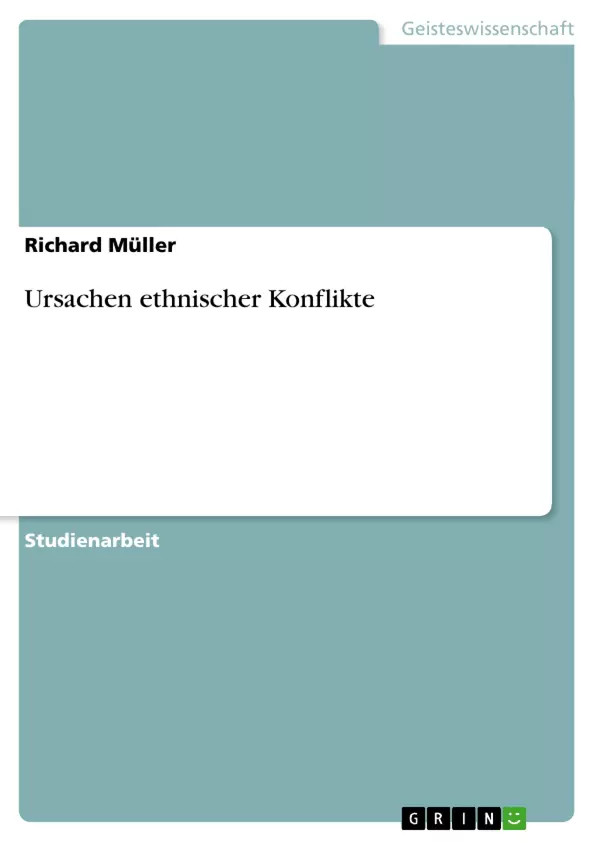Ob Völkermord in Ruanda oder Burundi, der Kampf der Timoresen um Unabhängigkeit, die Verfolgung chinesischstämmiger Indonesier nach dem Ende der Suharto-Diktatur, Gewalt und Vertreibung auf dem Balkan, die Hinwendung deutsch-türkischer Jugendlicher zum Islam oder der Krieg zwischen der PKK und der türkischen Armee – viele gesellschaftliche Prozesse und Auseinandersetzungen, die oft genug mit extremer Gewalt und Brutalität verbunden sind, werden als ‚ethnisch’ qualifiziert (Sökefeld 2001)1.
Viele PolitikerInnen und JournalistInnen haben eine einfache und simple Erklärung für die Ursachen von Bürgerkriegen. Während die zwischenstaatlichen, sog. Stellvertreterkriege Konflikte des Kalten Krieges vor allem auf ideologische Faktoren zurückgeführt wurden, neigen JournalistInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen seit den 90er Jahren oft dazu, Bürgerkriege auf monokausale Ursachen wie kulturelle Faktoren (Wiedererwachen alter ethnischer Spannungen) oder ökonomische Faktoren (private Bereicherung) zurückzuführen. So behauptete z. B US-Präsident George Bush Senior, dass der Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien zwischen Bosniern, Serben, Kroaten und Muslimen seine Ursachen in „age-old animosities“ hatte (Brown 2001: 3).
Es ist offensichtlich, dass die ethnische Begründung und Etikettierung dieser Bürgerkriege und der innergemeinschaftlichen Gewalt häufig benutzt wird, um die fundamentaleren ökonomischen und sozio-politischen Faktoren, welche vielfach für den Ausbruch von Bürgerkriegen verantwortlich sind, in den Hintergrund zu drängen. So wenig aber Charakterisierungen wie „Klassenkonflikte“ oder „Stellvertreterkriege“ geeignet waren, die komplexen Ursachen von Gewaltkonflikten auf den Begriff zu bringen, so wenig tragen Bezeichnungen wie „ethnischnationalistisch“, „ethnisch-religiös, „ethno-demographisch“ oder gar „ethnoökologisch“ zur Aufklärung über die Entstehungsgründe gegenwärtiger Gewaltkonflikte bei.
Im Gegenteil, sie verschleiern, was es aufzudecken gilt. Dass sich Konfliktparteien entlang ethnischer oder religiöser Bande formieren, ist nicht der Ausgangspunkt, sondern das Resultat konflikterzeugender sozialer Entwicklungen und Transformationsprozesse. Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Ursachen kriegerischer Konflikte besitzen die genannten Begriffe nur wenig Erklärungskraft (Siegelberg 1994: 33).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Einführung ins Thema
- 2. Die Forschungstheorien
- II. Hauptteil
- 1. Definitionen der wichtigsten Begriffe
- 1.1 Ethnische Identität
- 1.2 Ethnische Gruppen
- 1.3 Ethnischer Konflikt
- 2. Ursachen ethnischer Konflikte
- 2.1 Externe Faktoren
- 2.1.1 Koloniales Erbe
- 2.1.2 Globalisierung und Liberalisierung
- 2.1.3 Modernisierung
- 2.2 Interne Faktoren
- 2.2.1 Schwacher Staat
- 2.2.2 Kollektive Angst
- 2.2.3 Diskriminierung
- 2.2.4 Repression
- 2.2.5 Demokratisierung
- 2.2.6 Politisierung von Ethnizität
- 2.2.7 Kampf um Ressourcen
- 2.2.8 Emotionen und verfälschte Geschichte
- 3. Fallbeispiel: Der Bürgerkrieg im Sudan (1955 - 1989)
- 3.1 Historischer Hintergrund des Konflikts
- 3.1.1 Vorkoloniale Phase
- 3.1.2 19. Jahrhundert: kolonialherrschaftliche Phase
- 3.1.3 Unabhängigkeitsbewegung (1953-1955)
- 3.1.4 Die Zeit von 1972 bis 1983
- 3.1.5 Neueste Entwicklungen
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen ethnischer Konflikte und analysiert, wie ethnische Identität als Mobilisierungsgrundlage dient und welche Rolle Ethnizität in Konflikten spielt. Der Text verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der Ursachen und Auswirkungen ethnischer Konflikte zu vermitteln.
- Definition und Bedeutung von ethnischer Identität, ethnischen Gruppen und ethnischen Konflikten
- Analyse der verschiedenen Faktoren, die zu ethnischen Konflikten beitragen, sowohl externe Faktoren wie koloniales Erbe und Globalisierung als auch interne Faktoren wie Staatsversagen und Diskriminierung
- Das Fallbeispiel des Bürgerkriegs im Sudan als Illustration der komplexen Dynamiken ethnischer Konflikte
- Diskussion der Rolle von Ethnizität in Konflikten
- Vermittlung eines kritischen Blicks auf die Ursachen und Folgen ethnischer Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Forschungsfrage dar und stellt den Kontext ethnischer Konflikte in der heutigen Zeit vor. Die Arbeit kritisiert einseitige Erklärungsmodelle und betont die komplexen Zusammenhänge, die zu ethnischen Konflikten führen.
Der Hauptteil beginnt mit einer Definition der wichtigsten Begriffe: ethnische Identität, ethnische Gruppen und ethnischer Konflikt. Anschließend werden die Ursachen ethnischer Konflikte in zwei Kategorien unterteilt: externe und interne Faktoren. Im Fallbeispiel des Bürgerkriegs im Sudan werden die historischen und gegenwärtigen Entwicklungen des Konflikts analysiert und die komplexen Faktoren aufgezeigt, die zu dieser Eskalation geführt haben.
Schlüsselwörter
Ethnische Konflikte, ethnische Identität, Ethnizität, Kolonialismus, Globalisierung, Modernisierung, Staatsversagen, Diskriminierung, Ressourcenkonflikte, Bürgerkriege, Sudan, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wahren Ursachen für ethnische Konflikte?
Oft sind es nicht „uralte Feindschaften“, sondern ökonomische Ungleichheit, Staatsversagen, der Kampf um Ressourcen und politische Diskriminierung.
Welche Rolle spielt das koloniale Erbe bei heutigen Konflikten?
Willkürliche Grenzziehungen und die Bevorzugung bestimmter Gruppen durch Kolonialmächte haben oft die Basis für spätere ethnische Spannungen gelegt.
Warum wird Ethnizität oft politisiert?
Politische Führer nutzen ethnische Identität häufig als Mobilisierungsmittel, um Machtansprüche zu sichern oder von wirtschaftlichen Problemen abzulenken.
Was zeigt das Fallbeispiel Sudan über ethnische Konflikte?
Der Sudan-Konflikt illustriert die komplexe Mischung aus historischer Marginalisierung, religiösen Unterschieden und dem Kampf um Öl- und Wasserressourcen.
Ist ein schwacher Staat ein Risikofaktor für Bürgerkriege?
Ja, wenn ein Staat Sicherheit und Grundversorgung nicht für alle Gruppen garantieren kann, suchen Menschen Schutz in ihrer ethnischen Gemeinschaft, was Konflikte befeuert.
- Arbeit zitieren
- lic. phil. I Richard Müller (Autor:in), 2003, Ursachen ethnischer Konflikte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76260