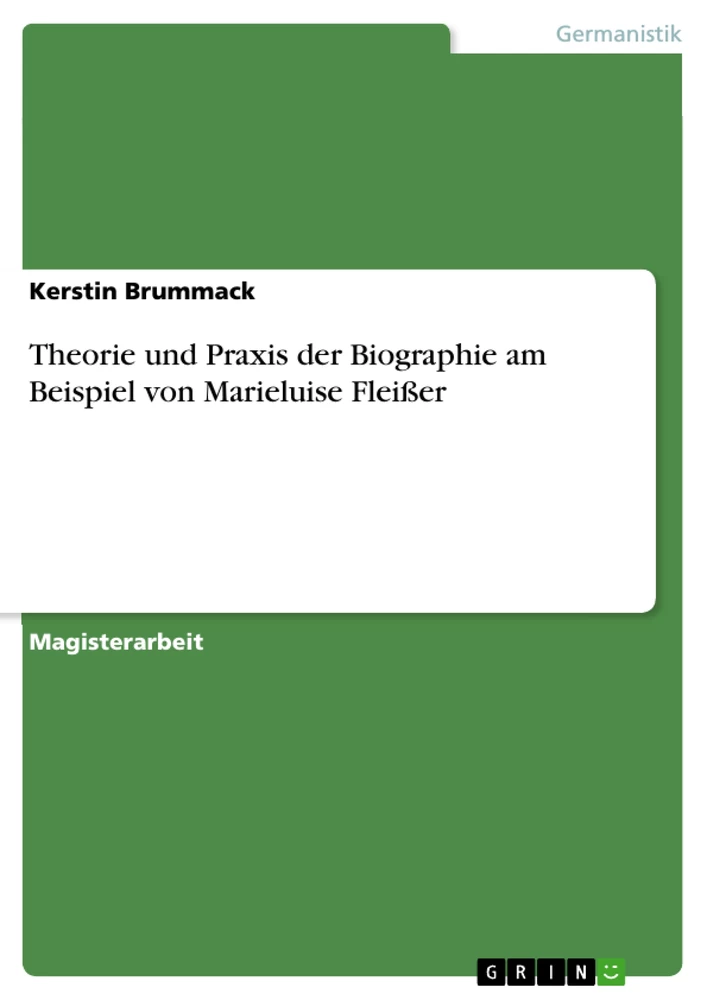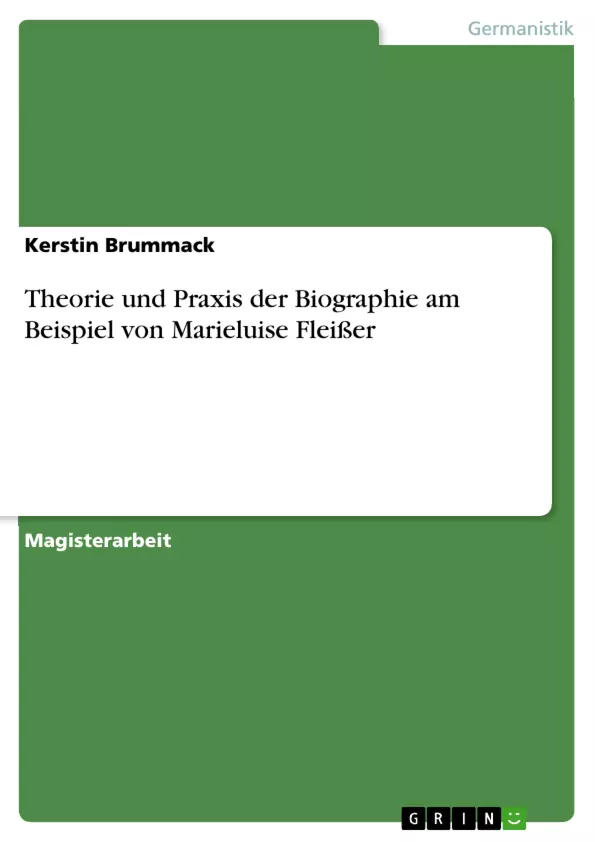Zentrum und Spezifik literaturwissenschaftlicher Biographik ist die Realisierung des Brückenschlags zwischen Lebensbeschreibung und Werkanalyse. Die Gliederung dieser Arbeit orientiert sich an der historischen Entwicklung der Biographie im deutschsprachigen Raum seit dem 18. Jh.
Die Ausgangsfrage ist, welche theoretischen Konzepte von Autorschaft und welche Identitäts- sowie Geschichtsmodelle die Herausbildung der modernen Biographie bedingten, ihr zur Popularität verhalfen oder sie ausschlossen vom akademischen Forschen. Die Analyse von Biographien über Marieluise Fleißer (ca. ein Drittel der Arbeit) erfordert eine besondere Aufmerksamkeit für die Rolle der Kategorie "Geschlecht" in biographischen Darstellungen. Darum werden die Ausführungen zur Herausbildung der modernen Biographie verknüpft mit Überlegungen zu den für diesen Zeitraum relevanten Geschlechts- und Autorschaftskonzeptionen. Wie prägt das sich im 18. Jh. herauskristallisierende Individualitätsmodell die Darstellungsmuster von Biographien und welche spezifischen Auswirkungen hat es bis heute auf die Biographien von Autorinnen?
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen Autormodellen, ästhetischer Wertung von literarischen Texten und der Positionierung von Autorinnen im literarischen Kanon. In Auseinandersetzung mit der traditionellen Erfassung "weiblicher" Autorschaft wird versucht, einen Ansatz zu erarbeiten, der zum einen der kritischen Analyse von traditioneller Frauen-Biographik dienen kann, der zum anderen die literarische Produktivität von Frauen darstellbar machen lässt. Erkenntnisse aus Dekonstruktion, Diskursanalyse und den Gender Studies bilden das Fundament dieser Arbeit. Die Biographie wird hier in der Debatte um den "Tod" und die "Rückkehr des Autors" verortet und daran anknüpfend gefragt, ob mit der Wiederkehr des Autors auch die "Revitalisierung der Autorin" und die Wiederbelebung der Biographie einhergeht. Marieluise Fleißer wurde als Beispiel gewählt, weil die komplexe Beziehung zwischen Literatur und Leben in ihrem Fall verstärkt auf ein einfaches Entsprechungsverhältnis mit selbsttherapeutischer Funktion reduziert wird.
An 3 Biograpien wird gezeigt, wie traditionelle Deutungsmuster das Verknüpfen von Fleißers Leben und Werk in Biographien prägen. Zusätzlich soll mit dem besonderen Fokus auf ihr Drama "Der Tiefseefisch" detailliert dargestellt werden, wie die Biographen den "Brückenschlag zwischen Lebensbeschreibung und Werkanalyse" realisierten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Makel und Möglichkeiten
- Die Ambiguität der Biographie
- Konzept
- PARADIGMENWECHSEL IN GESCHLECHTS- UND AUTORKONZEPTION SEIT DEM 18. JAHRHUNDERT
- Öffentlichkeit und privater Raum
- Gesellschaftliche Heterogenisierung
- Die Relevanz der Kategorie „Geschlecht“
- Johann Gottfried Herder
- Die Frau als Mutter und Muse
- Literarischer Kanon und Geschlechterhierarchie
- Biographie - Konstruktion vs. Repräsentation von Identität
- Biographische Annäherung an die Autorin
- Erhebung der „Fakten“ in drei Schritten
- Vierter Schritt: Die Bewegung der „Fakten“
- Biographie und Wissenschaft
- Biographie als Lieferant der Geschichtsschreibung
- Verhältnis von Geschichte und Biographie zu Mythos und Legende
- Die Wirklichkeit der „Fakten“ - Zur Relativität von Bedeutung
- 19. JAHRHUNDERT - BIOGRAPHIE ALS RETTUNGSANKER
- Die Kategorie der Größe
- Biographie und Bildungsroman
- Diltheys Biographie-Konzept contra Scherers Positivismus?
- Biographismus – Vorschläge einer Differenzierung
- 20. JAHRHUNDERT – BIOGRAPHIE ALS GRENZRAUM KONKURRIERENDER ANSPRÜCHE
- Wertung und Wahrheit - Autorisierungsprozesse
- Biographik nach 1920
- Biographik der „Historischen Belletristik“ und des George-Kreises
- Kritik an der zeitgenössischen Biographik
- Biographik nach 1945 – Stagnation und Distanz bis ca. 1970
- Fortsetzung des alten historischen Paradigmas
- Werkimmanente Methode und New Criticism
- Biographik nach 1970
- Sozial- und Alltagsgeschichte
- Frauenforschung und Gender Studies
- Verabschiedung und Wiederkehr des Autors – Rückkehr der Biographie?
- „Die Geburt des Lesers“
- Kümmert’s, wer spricht?
- Die Interferenz von Leben und Werk
- DIE VIELEN LEBEN DER MARIELUISE FLEIBER?
- Untersuchungsaspekte
- Sissi Tax (1984) – Feministischer Versuch?
- Biographische Konstruktion verhinderter Kreativität
- Reduzierung des Stücks – Reduzierung der Autorin
- Die Relevanz der Textinterpretation
- Moray McGowan – Leben und „Gesamtwerk“
- Welches Werk?
- Biographische Konstruktion von Naivität und Theorielosigkeit
- Fleißers Werk -,,Welt ohne Mütterlichkeit“?
- Der Tiefseefisch – Literarische Stilisierung als Fälschung der Wirklichkeit?
- Die Relevanz von Strukturanalysen
- Günter Lutz – Im Leben gescheitert, im Schreiben gelebt?
- Der schmale Grat des Biographen
- Der Tiefseefisch - Flucht vor der Wirklichkeit?
- BIOGRAPHISCHE (RE-)KONSTRUKTIONEN – AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung und die theoretischen Herausforderungen des biografischen Genres in der Literaturwissenschaft, insbesondere im Kontext der Geschlechterforschung. Sie beleuchtet die Ambivalenz der Biographie als wissenschaftliches und literarisches Genre, die sich zwischen Konstruktionen von Identität und der Repräsentation von Wirklichkeit bewegt.
- Die Bedeutung des biografischen Genres im wissenschaftlichen Diskurs
- Die Wechselwirkung zwischen biografischen Darstellungen und dem gesellschaftlichen Wandel
- Die Rolle der Geschlechterforschung in der Analyse von Biographien
- Die Herausforderungen der Biographik in Bezug auf Authentizität und Objektivität
- Die Bedeutung der Textinterpretation für die Rekonstruktion von Lebensgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die ambivalente Stellung der Biographie in der Literaturwissenschaft. Es beleuchtet die Kritikpunkte, die dem Genre entgegengebracht werden, sowie die neuen wissenschaftlichen Impulse, die dem Genre neue Bedeutung verleihen. Kapitel 2 untersucht den Paradigmenwechsel in der Geschlechter- und Autorkonzeption seit dem 18. Jahrhundert und zeigt die Veränderungen im Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit sowie die wachsende Bedeutung der Kategorie „Geschlecht“ für die literarische Produktion auf. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Biographie im 19. Jahrhundert, insbesondere mit dem Konzept der „Größe“ und der Beziehung zwischen Biographie und Bildungsroman.
Kapitel 4 analysiert die Situation der Biographie im 20. Jahrhundert, das als eine Zeit des Grenzraums zwischen konkurrierenden Ansprüchen bezeichnet wird. Dieses Kapitel beleuchtet die Veränderungen in der Biographik nach 1920, 1945 und 1970 sowie die Debatten um die Rolle des Autors und des Lesers in der Biografie. Das fünfte Kapitel widmet sich dem Fall der Schriftstellerin Marieluise Fleißer und analysiert unterschiedliche biographische Versuche, ihre Lebensgeschichte zu rekonstruieren.
Schlüsselwörter
Biographie, Literaturwissenschaft, Geschlechterforschung, Autorkonzeption, Identitätskonstruktion, Textinterpretation, Authentizität, Objektivität, Paradigmenwechsel, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Marieluise Fleißer
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel literaturwissenschaftlicher Biographik?
Ziel ist der Brückenschlag zwischen der Lebensbeschreibung einer Person und der Analyse ihres literarischen Werks.
Welche Rolle spielt das Geschlecht in Biographien?
Die Kategorie Geschlecht prägt Darstellungsmuster massiv. Bei Autorinnen wie Marieluise Fleißer werden Leben und Werk oft auf ein einfaches Entsprechungsverhältnis mit selbsttherapeutischer Funktion reduziert.
Was bedeutet die Debatte um den „Tod des Autors“?
Es ist eine theoretische Strömung, die den Fokus allein auf den Text legt. Die Arbeit untersucht die spätere „Wiederkehr des Autors“ und die damit verbundene Revitalisierung der Biographie.
Wie wird Marieluise Fleißer in Biographien dargestellt?
Die Arbeit analysiert drei Biographien und zeigt, wie traditionelle Deutungsmuster (z. B. Naivität oder verhinderte Kreativität) die Wahrnehmung ihrer Person und ihres Werks beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Konstruktion und Repräsentation von Identität?
Biographie ist selten eine objektive Abbildung (Repräsentation) der Wirklichkeit, sondern oft eine sprachliche Konstruktion, die durch den Zeitgeist und die Perspektive des Biographen geprägt ist.
Welche Bedeutung hat das Drama „Der Tiefseefisch“ für die Forschung?
Anhand dieses Stücks wird detailliert untersucht, wie Biographen die Verbindung zwischen Fleißers realen Lebenserfahrungen und ihrer literarischen Fiktionalisierung herstellen.
- Citation du texte
- Magistra Artium (M.A.) Kerstin Brummack (Auteur), 2003, Theorie und Praxis der Biographie am Beispiel von Marieluise Fleißer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76377