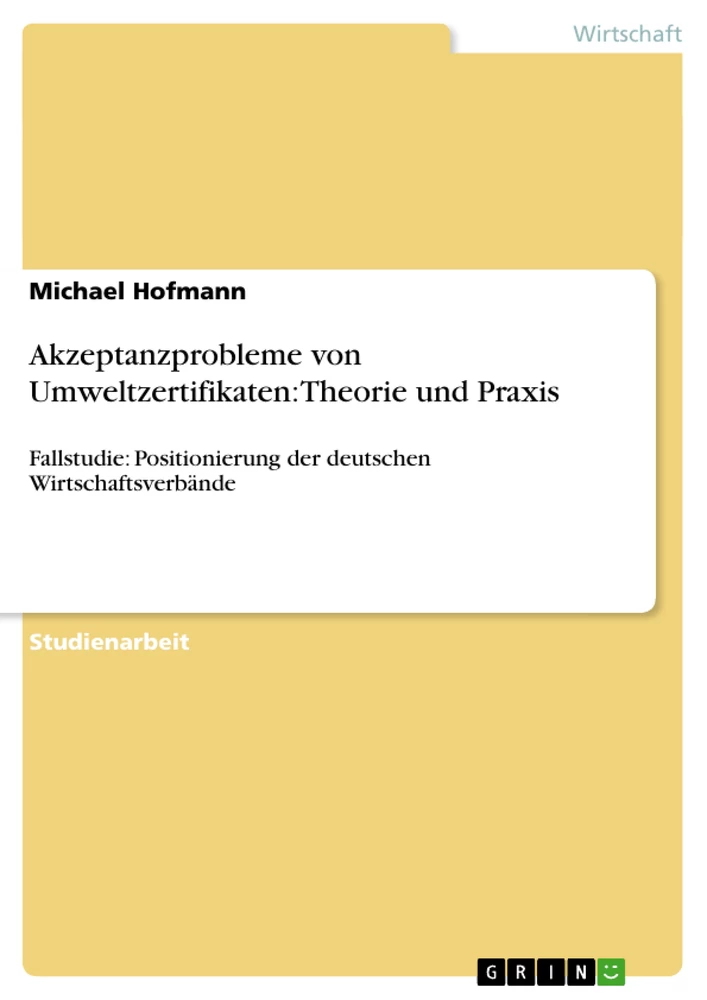Die Vertragsstaaten der Europäischen Union führen ab 2005 den Handel mit Emissionszertifikaten ein. Gemäß der Richtlinie 2003/87/EG vom 13. Oktober 2003 wurden die einzelnen Staaten dazu verpflichtet, der EU-Kommission bis 31. März 2004 einen Nationalen Allokationsplan (NAP) vorzulegen. Dieser sollte den allgemein gehaltenen Rahmen der Richtlinie spezifizieren. Neben der Anzahl der Zertifikate, die die einzelnen Staaten den jeweiligen Unternehmen zuzuteilen gedenken, musste auch die Allokationsmethodik konkretisiert werden.
Direkt betroffen von diesem System des Emissionshandels sind besonders alle energieintensiven Industriezweige in den jeweiligen Mitgliedsstaaten. Seitens der organisierten Verbandsmacht dieser Industriezweige kam es auf allen Stufen des politischen und administrativen Entscheidungsprozesses zu Versuchen der Einflussnahme und Interessenartikulation. Bestrebungen, auf den Entscheidungsprozess Einfluss zu nehmen und auf die eigenen Belange und potentielle negative Beeinträchtigungen aufmerksam zu machen, fanden sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene statt.
Nun ist es nichts grundlegend Neues, wenn bei geplanten Richtlinienvorhaben der Europäischen Union, organisierte Verbandsinteressen versuchen, den Regelungsinhalt gemäß ihren Vorstellungen zu beeinflussen oder auf negative Folgen aufmerksam zu machen. Im Falle des Systems des Emissionshandels schien sich aber zu bewahrheiten, was in der wissenschaftlichen Literatur konstatiert wird. Dass nämlich, obwohl es sich bei den Umweltzertifikaten um ein „theoretisch bestechendes Konzept handelt, dieses kaum Eingang in die praktischen Umweltpolitik gefunden habe“ (Bonus/Niebaum 1998: 225). Insbesondere sieht sich das Umweltzertifikat mit einer Reihe von „Akzeptanzbarrieren“ (Gawel 1998: 113) konfrontiert, die vor allem von Seiten der handelnden Akteure der einzelnen Wirtschaftssubjekte artikuliert werden.
In dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die in der Wissenschaft formulierten Akzeptanzbarrieren mit denen deckungsgleich sind, die seitens der Wirtschaftssubjekte im Laufe der politischen Entscheidungsfindung tatsächlich betont worden sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Private Wirtschaftssubjekte aus Sicht der Politischen Ökonomie
- 3. Akzeptanzprobleme von Zertifikaten
- 3.1. Planungsunsicherheiten als Akzeptanzproblem
- 3.2. Entwertung bereits getätigter Investitionen als Akzeptanzproblem
- 3.3. Komparativ negative Einkommenseffekte als Akzeptanzproblem
- 4. Positionierung der Wirtschaft zum Zertifikatshandel
- 4.1. Positionierung der Wirtschaftsverbände
- 4.1.1. Problem der nichtsubstituierbaren Produktionsverfahren
- 4.1.2. Ablehnung einer Emissionsobergrenze
- 4.1.3. Befürchtete Wettbewerbsnachteile
- 4.1.4. Technische Schwierigkeiten und Planungsunsicherheiten
- 4.1.5. Ablehnung eventueller Doppelbelastungen
- 4.2. Die Wuppertal-Studie
- 4.1. Positionierung der Wirtschaftsverbände
- 5. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten, insbesondere die Diskrepanz zwischen theoretischen Konzepten und praktischer Umsetzung, anhand der Positionierung deutscher Wirtschaftsverbände. Es wird analysiert, inwieweit die wissenschaftlich beschriebenen Akzeptanzbarrieren mit den von der Wirtschaft artikulierten Einwänden übereinstimmen.
- Analyse der Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten aus theoretischer und praktischer Perspektive.
- Untersuchung der Positionierung der deutschen Wirtschaftsverbände zum Emissionshandel.
- Vergleich der wissenschaftlich formulierten Akzeptanzbarrieren mit den in der politischen Entscheidungsfindung betonten Einwänden.
- Betrachtung der Rolle der Politischen Ökonomie im Kontext der Interessenvertretung der Wirtschaft.
- Bewertung der Implikationen des Zertifikathandels auf Wirtschaftsakteure.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Emissionshandels innerhalb der Europäischen Union ein und beschreibt den Kontext der Arbeit. Sie hebt die Diskrepanz zwischen der theoretischen Attraktivität von Umweltzertifikaten und ihrer geringen praktischen Anwendung hervor, wobei die Akzeptanzbarrieren seitens der Wirtschaft im Fokus stehen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die wissenschaftlich beschriebenen Akzeptanzbarrieren mit den von Wirtschaftsakteuren geäußerten Einwänden zu vergleichen. Der methodische Ansatz und die Gliederung der Arbeit werden ebenfalls skizziert.
2. Private Wirtschaftssubjekte aus Sicht der Politischen Ökonomie: Dieses Kapitel analysiert das Verhalten privater Wirtschaftssubjekte im Kontext des Emissionshandels aus der Perspektive der Politischen Ökonomie. Es geht von der Nutzenmaximierung der Akteure und deren systematischer Reaktion auf Anreize aus. Der hohe Organisationsgrad der Wirtschaftssubjekte und deren relative Interessenshomogenität ermöglichen eine effektive Interessenvertretung. Die Arbeit zeigt auf, dass Umweltschutzmaßnahmen für Wirtschaftssubjekte in der Regel mit Kosten verbunden sind, die nur unter bestimmten Bedingungen vollständig an die Konsumenten weitergegeben werden können. Der Vergleich zwischen Umweltauflagen und Zertifikathandel wird diskutiert, wobei die Präferenz der Produzenten für Umweltauflagen aufgrund der Vermeidung zusätzlicher Kosten und der Möglichkeit, den Marktzutritt von Konkurrenten zu erschweren, hervorgehoben wird. Der Einfluss der Allokationsmethodik auf die Position der Wirtschaftssubjekte wird ebenfalls beleuchtet.
3. Akzeptanzprobleme von Zertifikaten: Dieses Kapitel beschreibt die in der Literatur identifizierten Akzeptanzbarrieren für Umweltzertifikate. Es wird eine Dreiteilung der Probleme vorgenommen: ethische Akzeptanzhindernisse (Ablehnung marktwirtschaftlicher Instrumente im Umweltschutz), ökologische Wirksamkeit bzw. Korrektheit des Instruments und die Ablehnung durch Wirtschaftssubjekte. Der Fokus liegt auf den Gründen, warum die Einführung von Zertifikatssystemen Schwierigkeiten bereitet.
4. Positionierung der Wirtschaft zum Zertifikatshandel: Dieses Kapitel analysiert die Positionierung der Wirtschaftsverbände zum europaweiten Emissionshandel und zum nationalen Allokationsplan Deutschlands. Es werden die verschiedenen Argumente der Verbände gegen den Emissionshandel dargestellt, wie z.B. das Problem nichtsubstituierbarer Produktionsverfahren, die Ablehnung einer Emissionsobergrenze, die Befürchtung von Wettbewerbsnachteilen, technische Schwierigkeiten und Planungsunsicherheiten sowie die Ablehnung eventueller Doppelbelastungen. Die Wuppertal-Studie wird ebenfalls in Bezug auf die Positionierung der Wirtschaft zum Zertifikatshandel betrachtet.
Schlüsselwörter
Umweltzertifikate, Emissionshandel, Akzeptanzbarrieren, Politische Ökonomie, Wirtschaftsverbände, Interessenvertretung, Nationale Allokationspläne, Planungsunsicherheiten, Wettbewerbsnachteile, Grandfathering.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten, insbesondere die Diskrepanz zwischen theoretischen Konzepten und praktischer Umsetzung. Der Fokus liegt auf der Positionierung deutscher Wirtschaftsverbände und dem Vergleich wissenschaftlich beschriebener Akzeptanzbarrieren mit den von der Wirtschaft artikulierten Einwänden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten aus theoretischer und praktischer Perspektive, untersucht die Positionierung deutscher Wirtschaftsverbände zum Emissionshandel, vergleicht wissenschaftlich formulierte Akzeptanzbarrieren mit den in der politischen Entscheidungsfindung betonten Einwänden, betrachtet die Rolle der Politischen Ökonomie im Kontext der Interessenvertretung der Wirtschaft und bewertet die Implikationen des Zertifikathandels auf Wirtschaftsakteure.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Private Wirtschaftssubjekte aus Sicht der Politischen Ökonomie, Akzeptanzprobleme von Zertifikaten, Positionierung der Wirtschaft zum Zertifikatshandel und Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Akzeptanz von Umweltzertifikaten, von der theoretischen Grundlage bis zur praktischen Umsetzung und den Einwänden der Wirtschaft.
Wie werden die Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten dargestellt?
Die Akzeptanzprobleme werden in drei Kategorien unterteilt: ethische Akzeptanzhindernisse, ökologische Wirksamkeit/Korrektheit des Instruments und die Ablehnung durch Wirtschaftssubjekte. Konkrete Probleme, wie Planungsunsicherheiten, Entwertung bereits getätigter Investitionen und negative Einkommenseffekte werden detailliert beschrieben.
Welche Position beziehen die Wirtschaftsverbände zum Zertifikatshandel?
Die Wirtschaftsverbände äußern verschiedene Einwände gegen den Emissionshandel, darunter Probleme mit nichtsubstituierbaren Produktionsverfahren, Ablehnung einer Emissionsobergrenze, Befürchtung von Wettbewerbsnachteilen, technische Schwierigkeiten und Planungsunsicherheiten sowie die Ablehnung eventueller Doppelbelastungen. Die Wuppertal-Studie wird ebenfalls im Kontext der Positionierung der Wirtschaft betrachtet.
Welche Rolle spielt die Politische Ökonomie?
Die Politische Ökonomie liefert den Rahmen für die Analyse des Verhaltens privater Wirtschaftssubjekte. Es wird die Nutzenmaximierung der Akteure und deren systematische Reaktion auf Anreize betrachtet. Der hohe Organisationsgrad und die relative Interessenshomogenität der Wirtschaftssubjekte ermöglichen eine effektive Interessenvertretung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Der genaue Inhalt der Schlussfolgerungen ist in der bereitgestellten Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit genannt. Dies muss aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Umweltzertifikate, Emissionshandel, Akzeptanzbarrieren, Politische Ökonomie, Wirtschaftsverbände, Interessenvertretung, Nationale Allokationspläne, Planungsunsicherheiten, Wettbewerbsnachteile, Grandfathering.
- Quote paper
- Michael Hofmann (Author), 2004, Akzeptanzprobleme von Umweltzertifikaten: Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76414