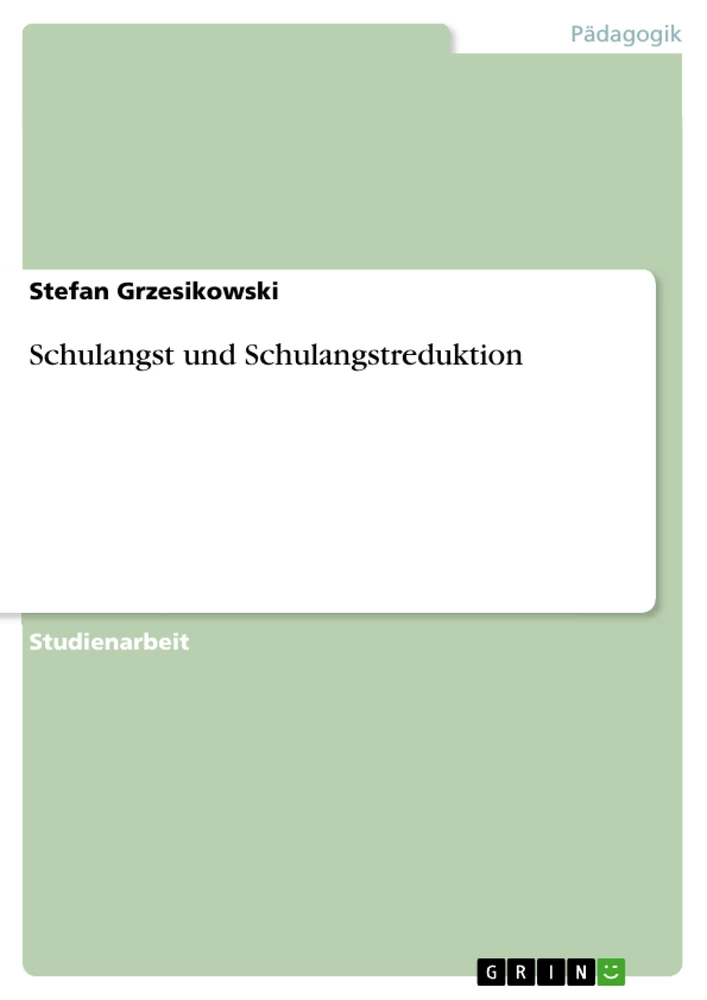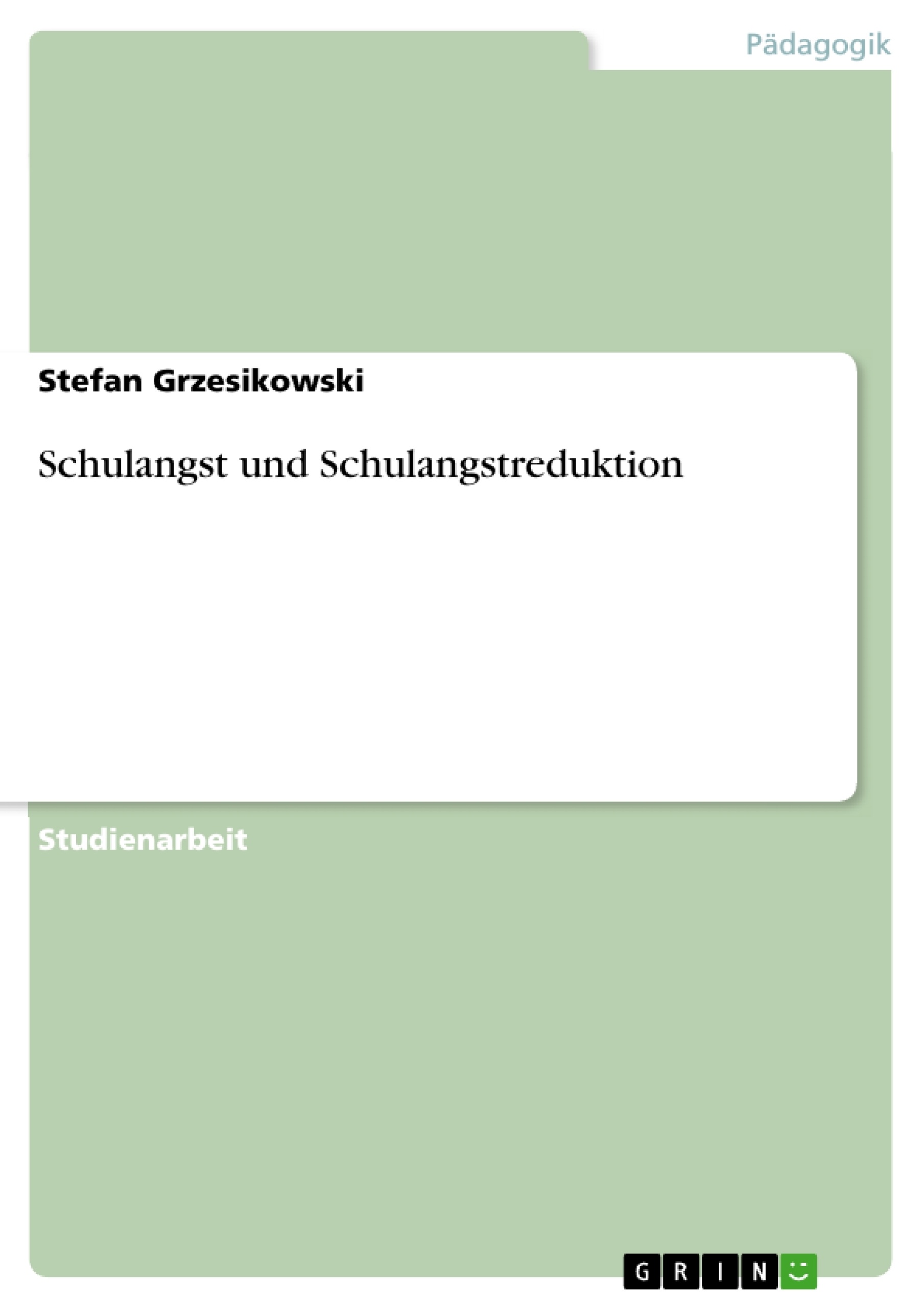Angst ist in unterschiedlichen Abstufungen allgegenwärtig und auch normal, was mit ihrer ursprünglichen biologischen Funktion zusammenhängt. Trotz dieser durchaus positiven Funktion kann Angst auch eine Beeinträchtigung in vielen Lebensbereichen sein, wenn sie nicht in angemessenem Maße auftritt oder gar eine Angststörung vorliegt. An einer klinisch relevanten Angststörung leiden der Bundes-Gesundheitssurvey von 1998 zufolge immerhin 14,2 Prozent der 18- bis 65jährigen Befragten im Zeitraum eines Jahres. Die Lebenszeitprävalenz konnte in dieser Studie nicht erhoben werden, doch man geht davon aus, dass sie nicht sehr von der 12-Monatsprävalenz abweicht. Trotz zum Teil großer Unterschiede zwischen den einzelnen Angststörungen kann man mit Ausnahme der Generalisierten Angststörung, bei der das höchste mittlere Ersterkrankungsalter bei 35 Jahren liegt, festhalten, dass sich bei etwa 85 Prozent der Betroffenen einer Angststörung die Krankheit bereits in der Adoleszenz manifestiert.
Die Kinder und Jugendlichen dieses Entwicklungsalters verbringen einen Großteil ihrer Zeit in der Schule, wodurch ihr naturgemäß eine Betroffenheit zukommt. Zudem ist die Frage, inwieweit die Schule als sozialer Raum und als Raum, in dem Leistungen abgefragt und bewertet werden nicht auch als Auslöser bzw. Mitverursacher solcher Störungen zu sehen ist. Doch nicht erst, wenn eine pathologische Störung vorliegt, muss sich die Schule bzw. die jeweilige Lehrkraft für die Ängste seiner Schüler interessieren. Auch nicht behandlungsbedürftige Ängste haben einen in dieser Arbeit noch zu klärenden Einfluss auf den Schüler, auf sein Verhalten, Leistungsvermögen, Wohlbefinden usw., sollten also im täglichen Umgang des Lehrers mit dem Schüler mitbedacht werden.
Ziel der Arbeit ist es, das Phänomen Schulangst in seinen Facetten darzustellen und so hoffentlich zu klären, um dann nachfolgend zum Umgang damit in der Praxis zu kommen. Als angehender Lehrer ist es natürlich besonders wichtig für mich, wie ich Schulangst erkennen kann und wie ich ihr begegne. Diese Arbeit folgt dabei weitestgehend den kognitiven Ansätzen der Psychologie. Dies meint, dass andere klassische Schulen der Psychologie, wie die Psychoanalyse oder der Behaviorismus, welche sich ebenfalls ausgiebig mit dem Phänomen Angst beschäftigten, größtenteils ausgeklammert werden sollen. Diese Konzentration auf einen Ansatz soll Verwirrungen vermeiden und eine stringente Arbeit ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Bemerkungen
- 2. Schulangst
- 2.1. Angst allgemein
- 2.2. Schulangst in Abgrenzung zu Schulphobie
- 2.3. Soziale Angst und Leistungsangst als Komponenten der Schulangst
- 2.3.1. Vorüberlegungen
- 2.3.2. Leistungsangst
- 2.3.3. Sozialangst
- 2.4. Schulangst
- 3. Maßnahmen gegen Schulangst
- 3.1. Diagnostik von Schulangst
- 3.2. Intervention und Prävention
- 3.3. Konsequenzen für die Lehrtätigkeit
- 4. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen Schulangst. Ziel ist es, Schulangst in ihren verschiedenen Facetten darzustellen und den Umgang damit in der Praxis zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Erkennung und Bewältigung von Schulangst aus der Perspektive eines angehenden Lehrers, wobei kognitive Ansätze der Psychologie im Vordergrund stehen.
- Definition und Abgrenzung von Angst, Schulangst und Schulphobie
- Soziale und Leistungsangst als Komponenten der Schulangst
- Kognitive Bewertungsprozesse bei Angstentstehung
- Diagnostik und Intervention bei Schulangst
- Konsequenzen für die Lehrtätigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Bemerkungen: Die Einleitung stellt die allgegenwärtige Natur von Angst und deren biologische Funktion heraus. Sie betont jedoch auch die negative Auswirkung von Angststörungen, insbesondere im Hinblick auf ihre hohe Prävalenz in der Adoleszenz. Der Text hebt die Relevanz von Schulangst im Kontext der schulischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hervor und argumentiert für die Notwendigkeit, sich mit Schülerängsten, auch jenseits pathologischer Störungen, auseinanderzusetzen. Das Hauptziel der Arbeit wird als die Darstellung des Phänomens Schulangst und die Ableitung praxisrelevanter Handlungsempfehlungen definiert. Der methodologische Ansatz, der auf kognitiven Theorien basiert, wird begründet.
2. Schulangst: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von Angst, ausgehend von Schwarzer und Krohne, die Angst als ein unangenehmes Gefühl bei subjektiv wahrgenommener Bedrohung definieren. Der kognitive Ansatz nach Lazarus und seiner kognitiv-transaktionalen Theorie von Stress und Emotionen wird erläutert. Es werden die drei Ebenen der Reaktion auf Angst (kognitiv, emotional, körperlich) sowie die Erlebenskomponenten Aufgeregtheit und Besorgnis nach Krohne differenziert. Die Unterscheidung zwischen Zustandsangst (state) und Ängstlichkeit (trait) nach Spielberger wird eingehend behandelt, wobei die Merkmale und Unterschiede beider Formen detailliert beschrieben werden.
Schlüsselwörter
Schulangst, Angst, Schulphobie, Soziale Angst, Leistungsangst, Kognitive Bewertung, Stress, Emotion, Lazarus, Krohne, Spielberger, Diagnostik, Intervention, Prävention, Lehrtätigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Schulangst"
Was ist der Inhalt des Textes "Schulangst"?
Der Text "Schulangst" bietet eine umfassende Übersicht zum Thema Schulangst. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Schulangst in ihren verschiedenen Facetten und dem Umgang damit aus der Perspektive eines angehenden Lehrers, wobei kognitive Ansätze der Psychologie im Vordergrund stehen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Definition und Abgrenzung von Angst, Schulangst und Schulphobie. Er analysiert soziale und leistungsbezogene Angst als Komponenten der Schulangst und beleuchtet die kognitiven Bewertungsprozesse bei der Entstehung von Angst. Weiterhin werden Diagnostik und Intervention bei Schulangst sowie die Konsequenzen für die Lehrtätigkeit thematisiert.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist strukturiert in Einleitung, ein Kapitel zu Schulangst (mit Unterkapiteln zu Angst allgemein, Abgrenzung zu Schulphobie, sozialen und leistungsbezogenen Ängsten), ein Kapitel zu Maßnahmen gegen Schulangst (Diagnostik, Intervention und Prävention sowie Konsequenzen für die Lehrtätigkeit) und einem Schlusskapitel. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Theorien werden im Text verwendet?
Der Text stützt sich auf kognitive Theorien, insbesondere die kognitive-transaktionale Stress- und Emotionstheorie von Lazarus und die Definition von Angst nach Schwarzer und Krohne. Die Unterscheidung zwischen Zustandsangst (state) und Ängstlichkeit (trait) nach Spielberger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Schulangst, Angst, Schulphobie, Soziale Angst, Leistungsangst, Kognitive Bewertung, Stress, Emotion, Lazarus, Krohne, Spielberger, Diagnostik, Intervention, Prävention, Lehrtätigkeit.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich vor allem an angehende Lehrer, die sich mit dem Thema Schulangst auseinandersetzen möchten. Er bietet praxisrelevante Handlungsempfehlungen und vermittelt ein tiefes Verständnis der kognitiven Aspekte von Angst und deren Bewältigung.
Welche praktischen Auswirkungen hat das Wissen aus diesem Text?
Das Wissen aus diesem Text ermöglicht Lehrkräften eine bessere Erkennung und Bewältigung von Schulangst bei Schülern. Es liefert Werkzeuge für die Diagnostik und Intervention und zeigt auf, wie die Lehrtätigkeit angepasst werden kann, um Schüler mit Schulangst zu unterstützen.
- Citation du texte
- Stefan Grzesikowski (Auteur), 2007, Schulangst und Schulangstreduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76418