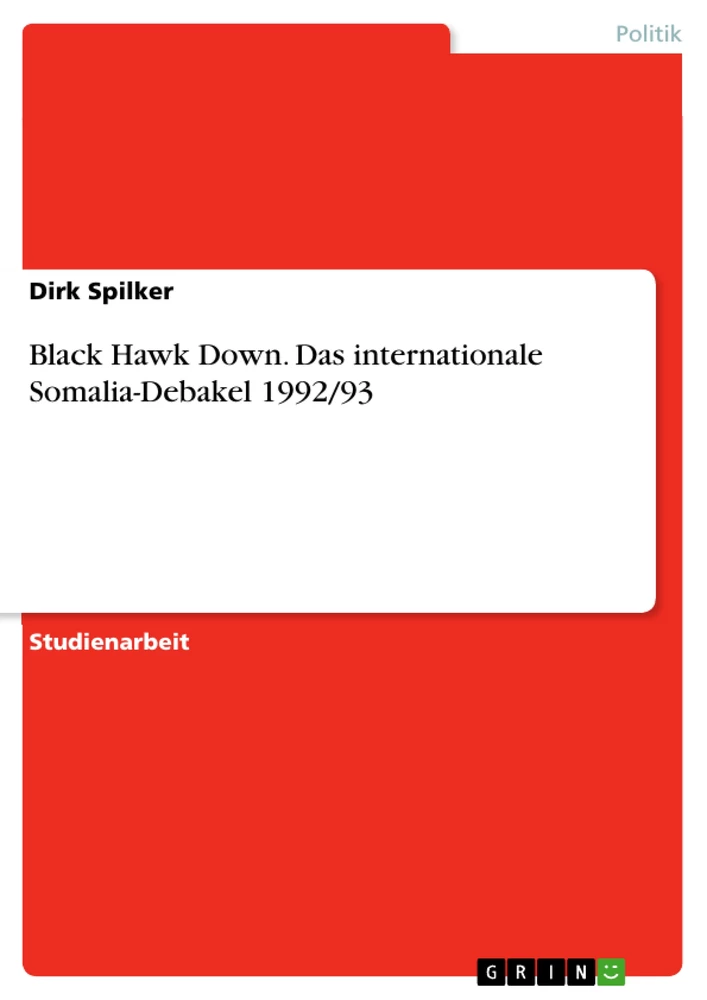Die vorliegende Arbeit untersucht die internationalen und lokalen Akteurs- und Interessenkonstellationen im Vorfeld und während der drei Interventionen der „Internationalen Gemeinschaft" in Somalia zu Beginn der 1990er Jahre. Sie verfolgt einen akteurszentrierten Ansatz unter Berücksichtigung der temporären Handlungslogiken der relevanten Akteure vor dem Hintergrund der innenpolitischen Lage Somalias sowie der neuen geopolitischen Konstellation nach dem Ende des "Kalten Krieges".
Zunächst erfolgt ein Überblick über die somalische Clanstruktur, dem entscheidenden Faktor für die historischen und aktuellen Konfliktlinien, sowie eine Hinführung zum Ogaden-Krieg 1977/78, der für die Region im Allgemeinen und Somalia im Speziellen eine zentrale Wendemarke war. Darauf aufbauend, analysiert die Arbeit die neuen innen- und außenpolitischen Interessenkonstellationen nach dem Ende des Ogaden-Krieges. Dabei wird dargestellt, wie bestehende innersomalische Clan-Rivalitäten begünstigt durch regionale und geopolitische Entwicklungen verstärkt ausbrachen und in den 1980ern zu einem offenen Bürgerkrieg führten.
Vor diesem Hintergrund erfolgt die Analyse der Interventionen UNOSOM I, UNITAF und UNOSOM II in Somalia. Dabei wird gezeigt, welche Rationale der zentralen lokalen und internationalen Akteure einen Einfluss auf den Politikwechsel und das verstärkte Eingreifen der USA hatten, das den Beginn einer neuen Generation der Peace-keeping Operationen bedeutete und den entscheidenden Rahmen für UNITAF und UNOSOM II bildete.
Es wird nachgezeichnet, wie sich die US-geführten UNITAF und UNOSOM II bedingt durch eine Verknüpfung von mangelnder Berücksichtigung lokaler Dynamiken und eigenen – teilweise persönli-chen – Handlungslogiken in eine fehdenartige Auseinandersetzung mit dem Kriegsherrn Mohammed Farah Aideed hineinziehen ließen und wie die UN damit faktisch zu einer Kriegspartei wurden. Die Arbeit zeigt, wie das externe Eingreifen in eine kaum zu erfassende lokale Konfliktkonstellation in Verbindung mit dem geschickten Vorgehen lokaler Akteure dazu führte, dass UNOSOM II an Ansehen in der somalischen Bevölkerung verlor, zunehmend als Feind angesehen wurde und schließlich scheitern musste.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Das Clansystem und Siad Barre
- Das Clansystem als entscheidender Bezugsrahmen
- Siad Barre und der Ogaden-Krieg: Der Weg zur Ausgangslage 1978
- Wendemarke für Siad Barre: Vom Ogaden-Krieg 1978 bis zum offenen Ausbruch des Bürgerkrieges 1988
- Anmerkungen zur geostrategischen Bedeutung der Region im Kalten Krieg
- Engagement und Rationale externer Akteure nach 1978
- Intern-externe Opposition gegen Barre
- Vom Ausbruch des Bürgerkriegs 1988 bis zum Sturz Siad Barres 1991
- Das (absehbare) Ende des Kalten Krieges am Horn von Afrika
- Das Friedensabkommen von 1988 und seine Folgen für Somalia
- Von der Machtübernahme der Rebellen zu „Restore Hope“
- Die Rolle der UNO bis Ende 1992 und das Scheitern von UNOSOM I
- Politikwechsel der USA und neue Stufe der Weltinnenpolitik
- Rationale der Bush-Administration
- Die „neue“ geostrategische Bedeutung der Region
- Peace-enforcement im Rahmen von „Restore Hope“
- Die UN-Blauhelme als Kriegspartei: UNOSOM II
- UNOSOM II und der Krieg mit Aideed
- Anmerkungen zu Rolle der USA
- Wendemarke: Die Schlacht um das Olympic-Hotel und der „CNN-Effekt“
- Einschätzung der Intervention der Staatengemeinschaft: Ziele, Fehler und Folgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die internationalen und lokalen Akteurs- und Interessenkonstellationen im Vorfeld und während der Interventionen der „Internationalen Gemeinschaft“ in Somalia in den frühen 1990er Jahren. Der Fokus liegt auf einem akteurszentrierten Ansatz, der die Handlungslogiken der beteiligten Akteure vor dem Hintergrund der somalischen Innenpolitik und der neuen geopolitischen Lage nach dem Ende des Kalten Krieges berücksichtigt.
- Das somalische Clansystem und seine Bedeutung für Konflikte
- Der Ogaden-Krieg und seine Folgen für die somalische Politik
- Die Interventionen von UNOSOM I, UNITAF und UNOSOM II in Somalia
- Die Rolle der USA und die Veränderungen in der Friedenspolitik
- Analyse des Scheiterns der internationalen Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Das Clansystem und Siad Barre: Diese Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Analyse, indem sie das komplexe somalische Clansystem als zentralen Bezugsrahmen für das Verständnis der Konflikte darstellt. Sie beschreibt die Struktur des Clansystems, die Bedeutung der Clanfamilien Samaale und Sab, und die Rolle der einflussreichsten Clans wie Darud und Hawiye. Weiterhin wird die Regierungszeit von Siad Barre eingeführt, der trotz des Anspruchs auf Tribalismusbekämpfung, die Clanstrukturen durch Ausspielen der Clans gegeneinander eher verstärkte. Der Abschnitt führt in die somalische Geschichte ein und betont die Bedeutung des Clansystems für das politische und soziale Leben.
Wendemarke für Siad Barre: Vom Ogaden-Krieg 1978 bis zum offenen Ausbruch des Bürgerkrieges 1988: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Ogaden-Krieges (1977/78) auf Siad Barres Herrschaft und Somalia. Die verheerende Niederlage gegen Äthiopien, unterstützt von der Sowjetunion und Kuba, schwächte Barre erheblich und verschärfte die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes. Die Flucht von 1,5 Millionen Menschen in Flüchtlingslager und die Schädigung des wirtschaftlichen Kreislaufs durch humanitäre Hilfe werden als zentrale Folgen hervorgehoben. Der Abschnitt verbindet den militärischen Misserfolg mit internen Spannungen und dem beginnenden Zerfall des Staates.
Vom Ausbruch des Bürgerkriegs 1988 bis zum Sturz Siad Barres 1991: Dieses Kapitel beleuchtet den eskalierenden Bürgerkrieg in Somalia ab 1988, der durch die bereits bestehenden Clanrivalitäten, verschärft durch die Folgen des Ogaden-Krieges, ausgelöst wurde. Die Arbeit thematisiert das Ende des Kalten Krieges am Horn von Afrika und die sich verändernde geopolitische Lage als Hintergrund für die Ereignisse. Das Friedensabkommen von 1988 und dessen Auswirkungen auf die politische Instabilität werden analysiert, und der Sturz Siad Barres im Jahr 1991 wird als Wendepunkt im somalischen Konflikt dargestellt. Der Abschnitt fokussiert die wachsende interne und externe Opposition gegen Barre und dessen letztliches Scheitern.
Von der Machtübernahme der Rebellen zu „Restore Hope“: Hier wird die Situation nach dem Sturz Barres und die anfängliche Rolle der UNO (UNOSOM I) im Kontext des sich verschärfenden Chaos in Somalia untersucht. Das Kapitel beschreibt das Scheitern von UNOSOM I und den anschließenden Politikwechsel der USA unter Präsident Bush, der zu einer militärischen Intervention ("Restore Hope") führte. Der Abschnitt analysiert die Gründe für diesen Politikwechsel, insbesondere die "neue" geostrategische Bedeutung der Region und die Überlegungen der Bush-Administration.
Die UN-Blauhelme als Kriegspartei: UNOSOM II: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die UNOSOM II-Mission und deren Eskalation in einen offenen Konflikt mit dem Kriegsherrn Mohammed Farah Aideed. Die mangelnde Berücksichtigung lokaler Dynamiken und die Handlungslogiken der internationalen Akteure führten dazu, dass die UN faktisch zu einer Kriegspartei wurde. Die Schlacht um das Olympic-Hotel und der "CNN-Effekt" werden als Wendepunkte im Verlauf des Konflikts und dem Ansehensverlust der UN in der somalischen Bevölkerung beschrieben.
Schlüsselwörter
Somalia, Clansystem, Ogaden-Krieg, Siad Barre, Bürgerkrieg, Internationale Intervention, UNOSOM I, UNITAF, UNOSOM II, USA, Peacekeeping, Peace-Enforcement, Mohammed Farah Aideed, „Restore Hope“, geopolitische Konstellation, Kalter Krieg, lokale Dynamiken, Handlungslogiken, Scheitern der Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Somalia – Interventionen der internationalen Gemeinschaft in den 1990er Jahren
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die internationalen und lokalen Akteurs- und Interessenkonstellationen vor und während der Interventionen der „Internationalen Gemeinschaft“ in Somalia in den frühen 1990er Jahren. Der Fokus liegt auf einem akteurszentrierten Ansatz, der die Handlungslogiken der beteiligten Akteure vor dem Hintergrund der somalischen Innenpolitik und der neuen geopolitischen Lage nach dem Ende des Kalten Krieges berücksichtigt.
Welche Rolle spielt das somalische Clansystem?
Das komplexe somalische Clansystem wird als zentraler Bezugsrahmen für das Verständnis der Konflikte dargestellt. Die Arbeit beschreibt die Struktur des Clansystems, die Bedeutung einflussreicher Clanfamilien und -verbände, und wie Siad Barre das System durch Ausspielen der Clans gegeneinander verstärkte, anstatt es zu überwinden.
Wie wird der Ogaden-Krieg behandelt?
Der Ogaden-Krieg (1977/78) und seine verheerenden Folgen für Siad Barre und Somalia werden ausführlich analysiert. Die Niederlage gegen Äthiopien, unterstützt von der Sowjetunion und Kuba, schwächte Barre erheblich und verschärfte die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes. Die Flucht von Millionen Menschen und die wirtschaftlichen Folgen werden hervorgehoben.
Welche Phasen des somalischen Bürgerkriegs werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet den eskalierenden Bürgerkrieg ab 1988, ausgelöst durch Clanrivalitäten und die Folgen des Ogaden-Krieges. Sie thematisiert das Ende des Kalten Krieges und das Friedensabkommen von 1988 und dessen Auswirkungen. Der Sturz Siad Barres 1991 wird als Wendepunkt dargestellt.
Welche Rolle spielen die UN-Missionen (UNOSOM I und II)?
Die Arbeit untersucht die Rolle der UNO (UNOSOM I) im Kontext des sich verschärfenden Chaos nach dem Sturz Barres, inklusive des Scheiterns von UNOSOM I. Ausführlich wird UNOSOM II und dessen Eskalation in einen offenen Konflikt mit Mohammed Farah Aideed behandelt, wobei die UN faktisch zu einer Kriegspartei wurden. Die Schlacht um das Olympic-Hotel und der "CNN-Effekt" werden als Wendepunkte beschrieben.
Welche Rolle spielen die USA?
Die Arbeit analysiert den Politikwechsel der USA unter Präsident Bush, der zu einer militärischen Intervention ("Restore Hope") führte. Die "neue" geostrategische Bedeutung der Region und die Überlegungen der Bush-Administration werden untersucht, sowie die Rolle der USA in UNOSOM II und deren Folgen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit bezüglich des Scheiterns der Intervention?
Die Arbeit analysiert die Ziele, Fehler und Folgen der internationalen Intervention in Somalia. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Handlungslogiken der beteiligten Akteure und der mangelnden Berücksichtigung lokaler Dynamiken als zentrale Gründe für das Scheitern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Somalia, Clansystem, Ogaden-Krieg, Siad Barre, Bürgerkrieg, Internationale Intervention, UNOSOM I, UNITAF, UNOSOM II, USA, Peacekeeping, Peace-Enforcement, Mohammed Farah Aideed, „Restore Hope“, geopolitische Konstellation, Kalter Krieg, lokale Dynamiken, Handlungslogiken, Scheitern der Intervention.
- Citar trabajo
- Dirk Spilker (Autor), 2006, Black Hawk Down. Das internationale Somalia-Debakel 1992/93, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76451