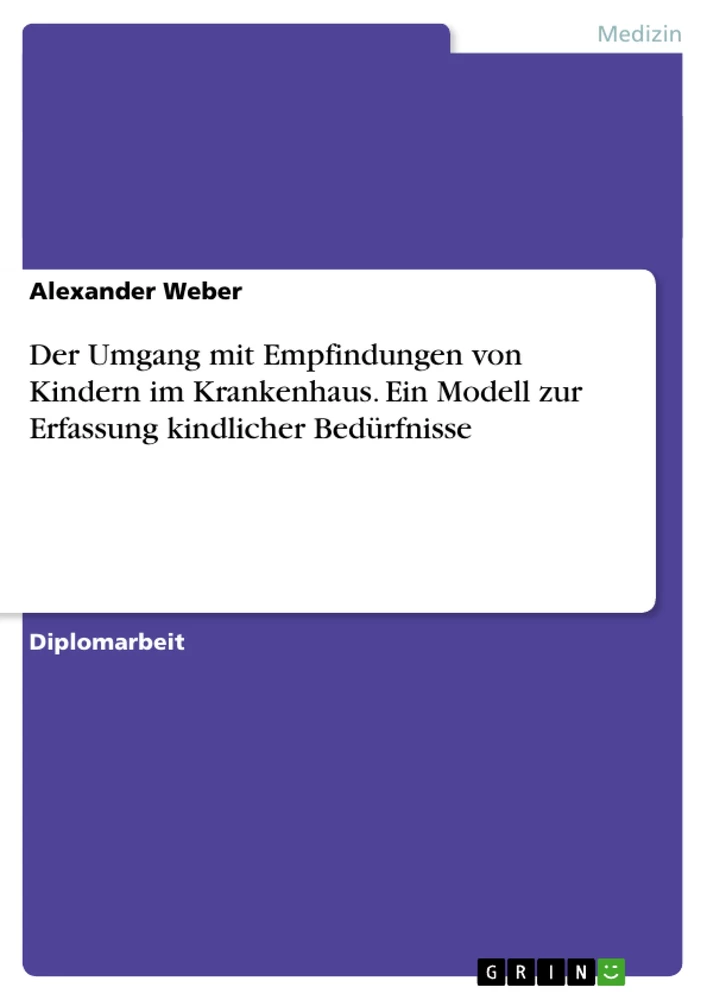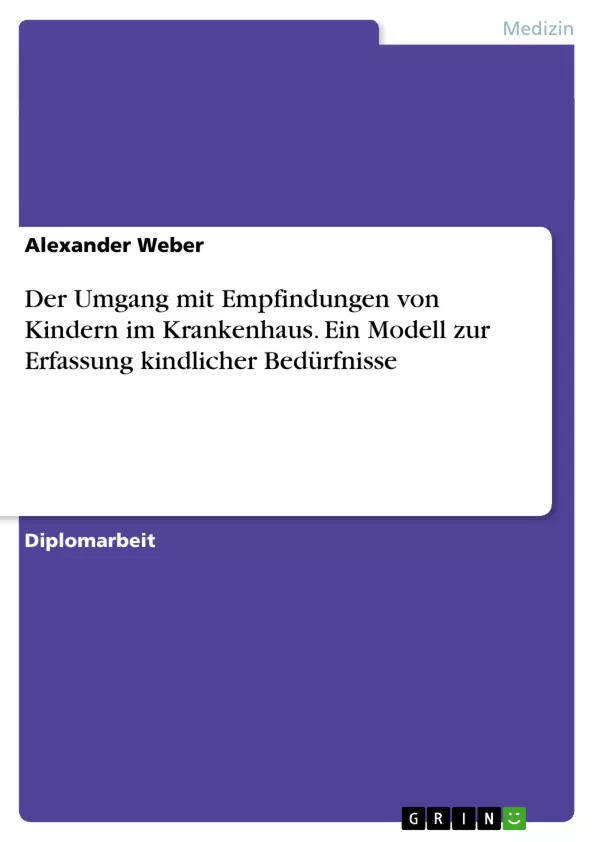Seit Januar 2000 sind Leistungserbringer des Gesundheitssektors dazu verpflichtet, Qualitätssicherung zu betreiben. Kern dieser Bemühungen sind Aufrechterhaltung von Pflegequalität und Vermeidung von Fehlern (Vgl. Perschke-Hartmann 2001, S. 42). Im Rahmen des internen Pflegemanagementsystems bitten Qualitätsmanager beispielsweise Patienten Stellung zu nehmen, wie sie ihren stationären Aufenthalt bewerten. Ergebnisse dieser Zufriedenheitsabfragen, in der Regel per Fragebogen erfasst, verschaffen einen Blick von außen auf die angebotenen stationären Leistungen. Darüber hinaus, können sie Einfluss auf die Gestaltung von Handbüchern nehmen und sind Bestandteil von Zertifizierungsverfahren mit denen sich das Unternehmen nach außen präsentiert (Vgl. Keitel, P. 2002, S. 39). Daher etabliert sich mehr und mehr der Einsatz von Fragebögen in Krankenhäusern.
Ergebnisse aus diesen Patientenbefragungen können für eine Einrichtung sehr wichtig sein, so sie Mängel aufzeigen, die es zu beseitigen gilt. Dies setzt aber voraus, dass solche Befragungen auch hilfreiche Daten liefern. Oft sind aber PatientInnen nicht in der Lage, ihren Krankenhausaufenthalt objektiv zu bewerten. Ob die aktuell durchgeführten Befragungen diesen Anforderungen entsprechen, ist nicht hinreichend geklärt: Systematisch angelegte Patientenbefragungen, quantitativen oder qualitativen Ursprungs, gibt es in Deutschland erst seit den 1990er Jahren (Vgl. Hinz, A. 2006, S. 179). Daher existieren über Nutzen und Effektivität kaum theoretischen Untersuchungen (Vgl. Aust, B. 1994, zitiert in Hinz).
Unter der Annahme, dass Qualitätssicherung grundsätzlich sinnvoll ist, und PatientInnen einen Nutzen aus dieser ziehen, stellt der Autor sich die Frage, wie sie auf Kinderstationen sinnvoll betrieben werden kann.
Mithilfe von teilnehmender Beobachtung und fokussiertem Interview wird nach einer Möglichkeit gesucht, Aspekte des Krankenhausalltages zu erfassen, die zum einen verbesserungswürdig sind und zum anderen für die Zielgruppe stationär aufgenommener Kinder relevant sind.
Inhaltsverzeichnis
- Konzeption der Arbeit
- Problemstellung
- Zielstellung
- Wissenschaftliche Fragenstellungen
- Untersuchungsdesign
- Vorbereitung zur Forschungsphase
- Instrumente der Datenerhebung
- Die offene teilnehmende Beobachtung
- Das fokussierte Interview
- Untersuchungspopulation und Stichprobenauswahl
- Durchführung der Untersuchung
- Grenzen der Untersuchung
- Das Auswertungsverfahren nach Mayring
- Ergebnisse der Untersuchung
- Recherche und Bewertung der Literatur
- Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Rahmen
- Der Begriff der Zufriedenheit und gängige Abfragemethoden
- Reaktionen von PatientInnen auf Zufriedenheitsabfragen
- Der Begriff der Empfindung
- Kindliche Bedürfnisse
- Bedürfnis nach Sicherheit
- Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe
- Zuwendung durch Erwachsene
- Stabilität
- elterliche Fürsorge
- Bedürfnis nach Wertschätzung
- Bedürfnis nach Selbstverwirklichung
- Bewegung
- Umgang mit kindlichen Bedürfnissen
- Kommunikation im Umgang mit Bedürfnissen
- Geschichtlicher Rückblick
- Das Verständnis von Sorge und Pflege nach P. Benner
- Fazit zum theoretischen Rahmen
- Darstellung der Beobachtungen
- Die Beobachtungen dargestellt nach den Lebensaktivitäten von N. Roper
- Darstellung der Beobachtungen
- Lebensaktivität „Für eine sichere Umgebung sorgen“
- Angst vor pflegerischen/ärztlichen Maßnahmen
- Angst vor Schmerz
- Fazit
- Alterstypische kindliche Ängste
- Fazit
- Lebensaktivität „Sich beschäftigen, spielen und lernen“
- Das Spielzimmer
- Fazit
- Spielen mit anderen Kindern
- Fazit
- Sich beschäftigen
- Fazit
- Sich bewegen
- Fazit
- Lernen
- Fazit
- Lebensaktivität „Schlafen“
- Die Unterbringung von Kindern mit Eltern
- Fazit
- Mitaufnahme von Eltern
- Fazit
- Schlafqualität
- Fazit
- Lebensaktivität „Kommunizieren“
- Kommunikation im Umgang mit Bedürfnissen
- Fazit
- Zusammenfassende Beurteilung der Beobachtungen
- Erfassen von Empfindungen
- Umgang mit kindlichen Bedürfnissen
- Empfehlungen
- Schlussbemerkungen und Ausblick
- Thesen zur Diplomarbeit
- Erfassung von kindlichen Bedürfnissen im Krankenhausalltag
- Entwicklung eines Modells zur Erfassung kindlicher Bedürfnisse
- Analyse des Einflusses von kindlichen Bedürfnissen auf die Zufriedenheit im Krankenhaus
- Empfehlungen zur Verbesserung der Qualitätssicherung in der Kinderkrankenpflege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie Qualitätssicherung in Kinderkrankenhäusern sinnvoll betrieben werden kann, um die Bedürfnisse stationär aufgenommener Kinder besser zu erfassen und zu berücksichtigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Problemstellung, in der der Autor den Bedarf an einer effektiven Qualitätssicherung im Krankenhauswesen, speziell für Kinderstationen, darlegt. Die Zielsetzung und wissenschaftliche Fragenstellungen der Arbeit werden erläutert. Anschließend wird das Untersuchungsdesign vorgestellt, welches auf teilnehmende Beobachtung und fokussierte Interviews mit Kindern auf einer Kinderstation setzt.
Der theoretische Rahmen der Arbeit umfasst eine Definition der Zufriedenheit und gängige Abfragemethoden. Darüber hinaus werden Reaktionen von PatientInnen auf Zufriedenheitsabfragen und der Begriff der Empfindung erörtert. Ein wichtiger Abschnitt widmet sich den kindlichen Bedürfnissen, die in verschiedene Kategorien unterteilt werden, wie das Bedürfnis nach Sicherheit, Zugehörigkeit, Wertschätzung und Selbstverwirklichung.
Die Darstellung der Beobachtungen, die im Rahmen der Untersuchung gewonnen wurden, erfolgt anhand der Lebensaktivitäten von N. Roper. Dabei werden die Beobachtungen aus unterschiedlichen Bereichen des Krankenhausalltags, wie dem Umgang mit Angst, dem Spiel und Lernen, dem Schlafen und der Kommunikation, detailliert beschrieben.
In der zusammenfassenden Beurteilung der Beobachtungen werden die Ergebnisse der Untersuchung hinsichtlich der Erfassung von Empfindungen und des Umgangs mit kindlichen Bedürfnissen bewertet. Die Arbeit schließt mit Empfehlungen zur Verbesserung der Qualitätssicherung in der Kinderkrankenpflege und einem Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Kindliche Bedürfnisse, Qualitätssicherung, Krankenhausalltag, teilnehmende Beobachtung, fokussiertes Interview, Zufriedenheitsabfragen, Lebensaktivitäten, Kommunikation, Angst, Spiel, Lernen, Schlaf.
- Arbeit zitieren
- Alexander Weber (Autor:in), 2007, Der Umgang mit Empfindungen von Kindern im Krankenhaus. Ein Modell zur Erfassung kindlicher Bedürfnisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76547