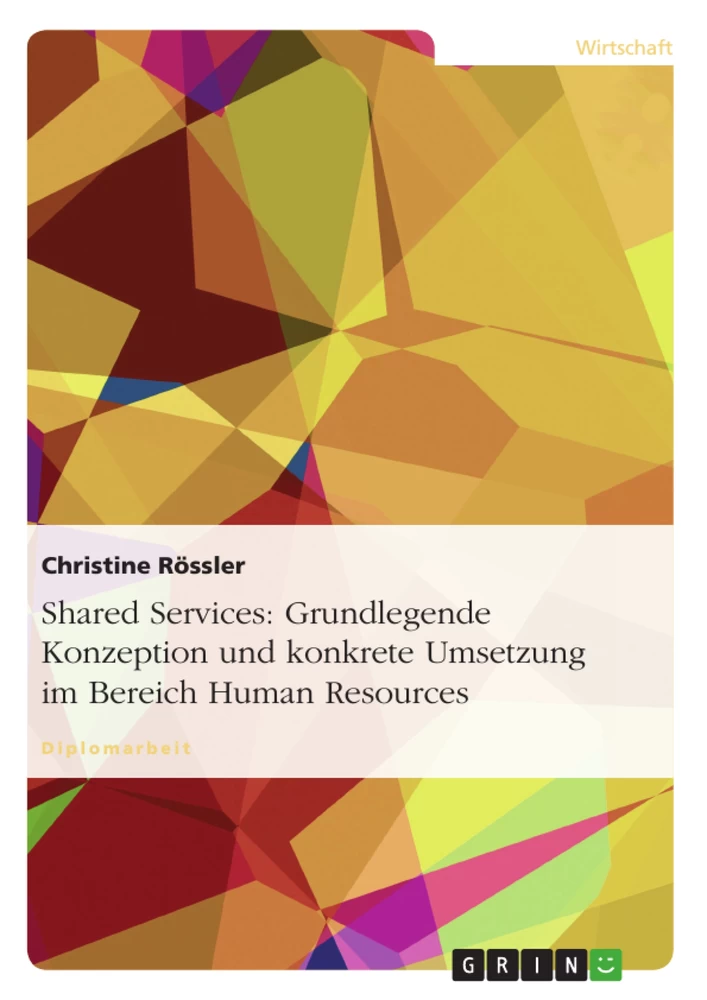1. Problemstellung und Zielsetzung
Ist die klassische Organisation einer Personalabteilung noch rentabel und zeitgemäß? Diese Frage wird auch in deutschen Unternehmen zunehmend gestellt.
Die Globalisierung und die daraus resultierende Verschärfung des Wettbewerbs setzen die Unternehmen unter einen hohen Kostendruck. In Folge dessen und aufgrund einer verstärkten Shareholder Value-Orientierung stellen viele Unternehmen ihren Personalbereich auf den Prüfstand, um dessen Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens festzustellen. Dieser entspricht meist nicht den Erwartungen und so werden vorhandene Strukturen und Abläufe in Frage gestellt und neue Ansätze gesucht, die zu einer Erhöhung der Wertschöpfung beitragen. Positive Wertbeiträge im Personalbereich können dabei entweder durch eine Senkung der Kosten bei gleich bleibender Qualität und Quantität der Leistungen erreicht werden oder durch eine Steigerung derselben bei unveränderter Kostenstruktur. Vor diesem Hintergrund greifen viele Unternehmen auf ein Konzept zurück, das in den USA bereits seit längerem angewandt wird und nun auch in Europa wachsende Beachtung und Verbreitung findet, dem Shared Services Ansatz. Eine Studie der Unternehmensberatung Kienbaum aus dem letzten Jahr zeigt, dass bereits 41 Prozent der Großunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum das Shared Services Konzept im Personalbereich einsetzen. Ziel dieser Arbeit ist nun eine fundierte Analyse dieses Ansatzes aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wobei der Fokus auf der konkreten Umsetzung im Bereich Human Resources liegt. Auf steuer- sowie arbeitsrechtliche Aspekte dieses Themas wird nicht eingegangen.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. In diesem, dem ersten Kapitel wurden bisher die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit dargelegt. Der nun beschriebene Aufbau der Arbeit bildet den Abschluss des Kapitels.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Shared Services Ansatzes gelegt. Daher wird in Punkt 2.1 zunächst der Begriff geklärt und die Entstehung des Ansatzes beschrieben. Punkt 2.3 stellt die Kernelemente von Shared Service Centern dar. Abschließend wird dann im Punkt 2.3 eine Abgrenzung von Shared Services zu den ähnlichen Organisationskonzepten Zentralisierung und Outsourcing durchgeführt.
Das dritte Kapitel umfasst die Darstellung des Shared Services Konzeptes. Nachdem in Punkt 3.1 die Voraussetzungen dargelegt werden, befasst sich der folgende Punkt mit der Strategie, die mit dem Konzept verfolgt wird. Hier werden zunächst die Ziele aufgezeigt, die zugleich auch die Chancen des Ansatzes sind, um danach die strategierelevanten Aspekte bei der Realisierung des Konzeptes darzustellen. Punkt 3.3 beschreibt die inhaltliche sowie die monetäre Steuerung eines Shared Service Centers. Punkt 3.4 geht auf die Evaluation der Leistungen des Shared Service Centers nach seiner Einführung ein, bevor in Punkt 3.5 die Erfolgsfaktoren vorgestellt werden. Das Kapitel schließt mit der Darstellung der Risiken und Grenzen des Shared Services Ansatzes.
Im vierten Kapitel wird die Umsetzung des Shared Services Konzeptes im Bereich Human Resources beschrieben. Hierbei werden zunächst Einsatz und Verbreitung von Shared Service Centern in diesem Bereich aufgezeigt, bevor dann anschließend die Potenziale und Problemfelder geschildert werden. Punkt 4.3 stellt ein Fünfphasenmodell als eine mögliche Art des Vorgehens bei der Einführung eines Shared Service Centers im Personalbereich vor. Der folgende Punkt erläutert die inhaltliche und monetäre Steuerung des Human Resources Shared Service Centers. Der letzte Punkt des Kapitels widmet sich ausführlich dem Change Management, welches ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Einführung von Shared Services darstellt.
Kapitel fünf zeigt am Beispiel der BASF AG, wie das Shared Services Konzept im Bereich Human Resources in der Praxis konkret umgesetzt werden kann.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich zunächst mit Nearshoring und Offshoring von Shared Services im Personalbereich. Punkt 6.2 verdeutlicht, dass Shared Services im Personalbereich eine gute Alternative zum externen Outsourcing darstellen.
Das siebte Kapitel bildet den Abschluss der Arbeit und gibt einen Ausblick auf die Zukunft von Shared Services.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung und Zielsetzung
- 2. Shared Services – begriffliche Grundlagen, Charakteristika und Abgrenzungen
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Entstehung des Shared Services Ansatzes
- 2.3 Charakteristika von Shared Service Centern
- 2.4 Abgrenzung von Shared Services zur Zentralisierung und zum Outsourcing
- 2.4.1 Abgrenzung zur Zentralisierung
- 2.4.2 Abgrenzung zum Outsourcing
- 2.4.2.1 Begriffsklärung
- 2.4.2.2 Abgrenzung von Shared Services zu den Outsourcing-kategorien
- 3. Darstellung des Shared Services Konzeptes
- 3.1 Voraussetzungen
- 3.2 Strategie
- 3.2.1 Ziele
- 3.2.2 Strategierelevante Aspekte bei der Realisierung des Shared Services Ansatzes
- 3.3 Steuerung
- 3.3.1 Inhaltliche Steuerung eines Shared Service Centers
- 3.3.2 Monetäre Steuerung eines Shared Service Centers
- 3.4 Evaluation
- 3.5 Erfolgsfaktoren
- 3.6 Risiken und Grenzen des Shared Services Ansatzes
- 4. Umsetzung des Shared Services Konzeptes im Bereich Human Resources
- 4.1 Einsatz und Verbreitung des HR Shared Service Centers
- 4.2 Potenziale und Problemfelder der Anwendung des Shared Services Konzeptes im HR Bereich
- 4.3 Vorgehensweise bei der Einführung eines HR Shared Service Centers
- 4.4 Steuerung eines HR Shared Service Centers
- 4.5 Change Management
- 5. Human Resources Shared Service Center in der Praxis am Beispiel der BASF AG
- 6. Nearshoring, Offshoring und externes Outsourcing
- 6.1 Nearshoring und Offshoring von HR Shared Services
- 6.2 HR Shared Services als Alternative zum externen Outsourcing
- 7. Die Zukunft von Shared Services
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Konzeption und Umsetzung von Shared Services, insbesondere im Bereich Human Resources. Ziel ist es, die grundlegenden Prinzipien, Vorteile und Herausforderungen dieses Ansatzes aufzuzeigen und eine konkrete Vorgehensweise für die Implementierung im HR-Bereich zu entwickeln.
- Begriffliche Klärung und Abgrenzung von Shared Services
- Strategische und operative Aspekte der Shared Services Implementierung
- Potenziale und Herausforderungen von Shared Services im HR-Bereich
- Vorgehensweise bei der Einführung eines HR Shared Service Centers
- Bedeutung des Change Managements
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Zielsetzung: Die Arbeit leitet mit der Problemstellung ein, dass Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung stehen, ihre HR-Prozesse effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Das Ziel ist die umfassende Untersuchung von Shared Services als Lösungsansatz, insbesondere die Entwicklung eines praktikablen Implementierungskonzeptes für den HR-Bereich. Die Arbeit skizziert den Forschungsansatz und die methodische Vorgehensweise.
2. Shared Services – begriffliche Grundlagen, Charakteristika und Abgrenzungen: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Shared Services" und grenzt ihn von ähnlichen Konzepten wie Zentralisierung und Outsourcing ab. Es analysiert die Entstehung und die charakteristischen Merkmale von Shared Service Centern und vertieft sich in die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Konzepte. Der Fokus liegt auf einer klaren Definition und einem Verständnis des Kontextes von Shared Services.
3. Darstellung des Shared Services Konzeptes: Dieses Kapitel beschreibt das Shared Services Konzept umfassend. Es beleuchtet die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung, detailliert die strategischen Ziele (finanzielle, prozessbezogene, mitarbeiterbezogene und kundenbezogene Ziele) und die relevanten Aspekte wie die Prozessauswahl und Standortwahl. Die Steuerung des Shared Service Centers, sowohl inhaltlich durch Service-Level-Agreements als auch monetär, wird ebenso behandelt wie Erfolgsfaktoren, Risiken und Grenzen des Ansatzes. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Planung und Umsetzung eines Shared Service Centers.
4. Umsetzung des Shared Services Konzeptes im Bereich Human Resources: Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Anwendung des Shared Services Konzeptes im Human Resources Bereich. Es untersucht den Einsatz und die Verbreitung von HR Shared Service Centern, analysiert die Potenziale und Problemfelder und beschreibt eine detaillierte Vorgehensweise in verschiedenen Phasen (Machbarkeitsprüfung, Planung, Entwicklung, Implementierung und Optimierung). Ein wichtiger Aspekt ist die Steuerung des HR Shared Service Centers und die Berücksichtigung des Change Managements mit seinen Herausforderungen.
5. Human Resources Shared Service Center in der Praxis am Beispiel der BASF AG: Dieses Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel, welches die erfolgreiche Implementierung eines Shared Service Centers im HR-Bereich der BASF AG illustriert. Die Fallstudie analysiert die konkreten Maßnahmen, den Aufbau und die Ergebnisse des Projekts und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Praxis.
6. Nearshoring, Offshoring und externes Outsourcing: Dieses Kapitel befasst sich mit den Alternativen zu internen Shared Service Centern: Nearshoring, Offshoring und externes Outsourcing von HR Shared Services. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile im Detail beleuchtet und eine Gegenüberstellung zu internen Lösungen vorgenommen.
Schlüsselwörter
Shared Services, Human Resources, HR Shared Service Center, Zentralisierung, Outsourcing, Nearshoring, Offshoring, Service-Level-Agreement, Change Management, Prozessoptimierung, Kostenoptimierung, Effizienzsteigerung, Implementierung, BASF AG.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Konzeption und Umsetzung von Shared Services im Human Resources Bereich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Konzeption und Umsetzung von Shared Services, insbesondere im Bereich Human Resources (HR). Sie analysiert die grundlegenden Prinzipien, Vorteile und Herausforderungen dieses Ansatzes und entwickelt ein konkretes Implementierungskonzept für den HR-Bereich.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Klärung und Abgrenzung von Shared Services; strategische und operative Aspekte der Shared Services Implementierung; Potenziale und Herausforderungen von Shared Services im HR-Bereich; Vorgehensweise bei der Einführung eines HR Shared Service Centers; Bedeutung des Change Managements; Praxisbeispiel BASF AG; Nearshoring, Offshoring und externes Outsourcing im Kontext von HR Shared Services.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung und Zielsetzung. Kapitel 2 klärt den Begriff "Shared Services" und grenzt ihn von Zentralisierung und Outsourcing ab. Kapitel 3 präsentiert das Shared Services Konzept umfassend, inklusive Voraussetzungen, Strategie, Steuerung und Erfolgsfaktoren. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Umsetzung im HR-Bereich. Kapitel 5 zeigt ein Praxisbeispiel der BASF AG. Kapitel 6 behandelt Nearshoring, Offshoring und externes Outsourcing. Kapitel 7 gibt einen Ausblick auf die Zukunft von Shared Services.
Was sind die zentralen Ziele der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die grundlegenden Prinzipien von Shared Services zu erläutern, die Vorteile und Herausforderungen aufzuzeigen und eine praktikable Vorgehensweise für die Implementierung im HR-Bereich zu entwickeln. Ein weiterer Fokus liegt auf der Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten wie Zentralisierung und Outsourcing.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methodik. Sie stützt sich auf Literaturrecherche, Fallstudien und vergleichende Analysen. Das Praxisbeispiel der BASF AG dient als empirische Grundlage.
Welche Vorteile bieten Shared Services im HR-Bereich?
Shared Services im HR-Bereich versprechen Prozessoptimierung, Kostenreduktion und Effizienzsteigerung. Sie ermöglichen die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen, die Standardisierung von Prozessen und eine verbesserte Servicequalität.
Welche Herausforderungen sind mit der Implementierung von Shared Services verbunden?
Die Implementierung von Shared Services bringt Herausforderungen mit sich, wie z.B. die Notwendigkeit eines umfassenden Change Managements, die Sicherstellung der Servicequalität und die Bewältigung potenzieller Widerstände von Mitarbeitern. Auch die Auswahl geeigneter Prozesse und Standorte spielt eine wichtige Rolle.
Wie grenzt sich Shared Services von Zentralisierung und Outsourcing ab?
Shared Services unterscheidet sich von der Zentralisierung durch die Fokussierung auf die gemeinsame Bereitstellung von Dienstleistungen für mehrere Einheiten eines Unternehmens. Im Gegensatz zum Outsourcing werden die Dienstleistungen intern erbracht. Die Arbeit vertieft diese Abgrenzungen detailliert.
Welche Rolle spielt das Change Management?
Das Change Management spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Shared Services Implementierung. Es ist notwendig, die betroffenen Mitarbeiter frühzeitig einzubeziehen, Ängste zu reduzieren und die Akzeptanz für die neuen Prozesse zu fördern.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Shared Services, Human Resources, HR Shared Service Center, Zentralisierung, Outsourcing, Nearshoring, Offshoring, Service-Level-Agreement, Change Management, Prozessoptimierung, Kostenoptimierung, Effizienzsteigerung, Implementierung, BASF AG.
- Quote paper
- Diplom-Betriebswirtin Christine Rössler (Author), 2007, Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76555