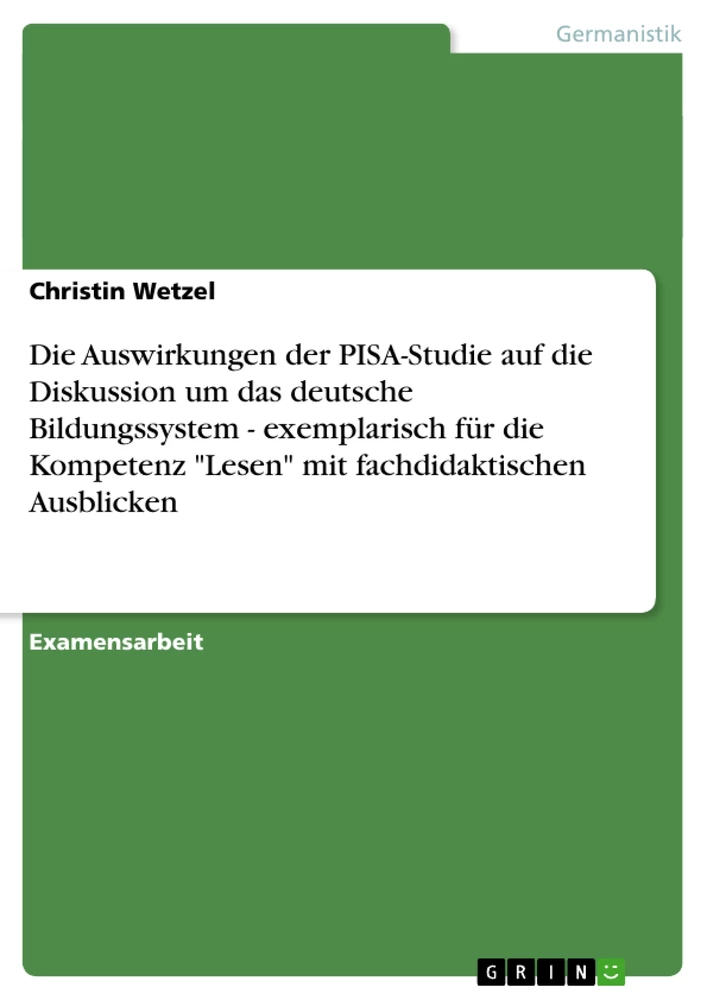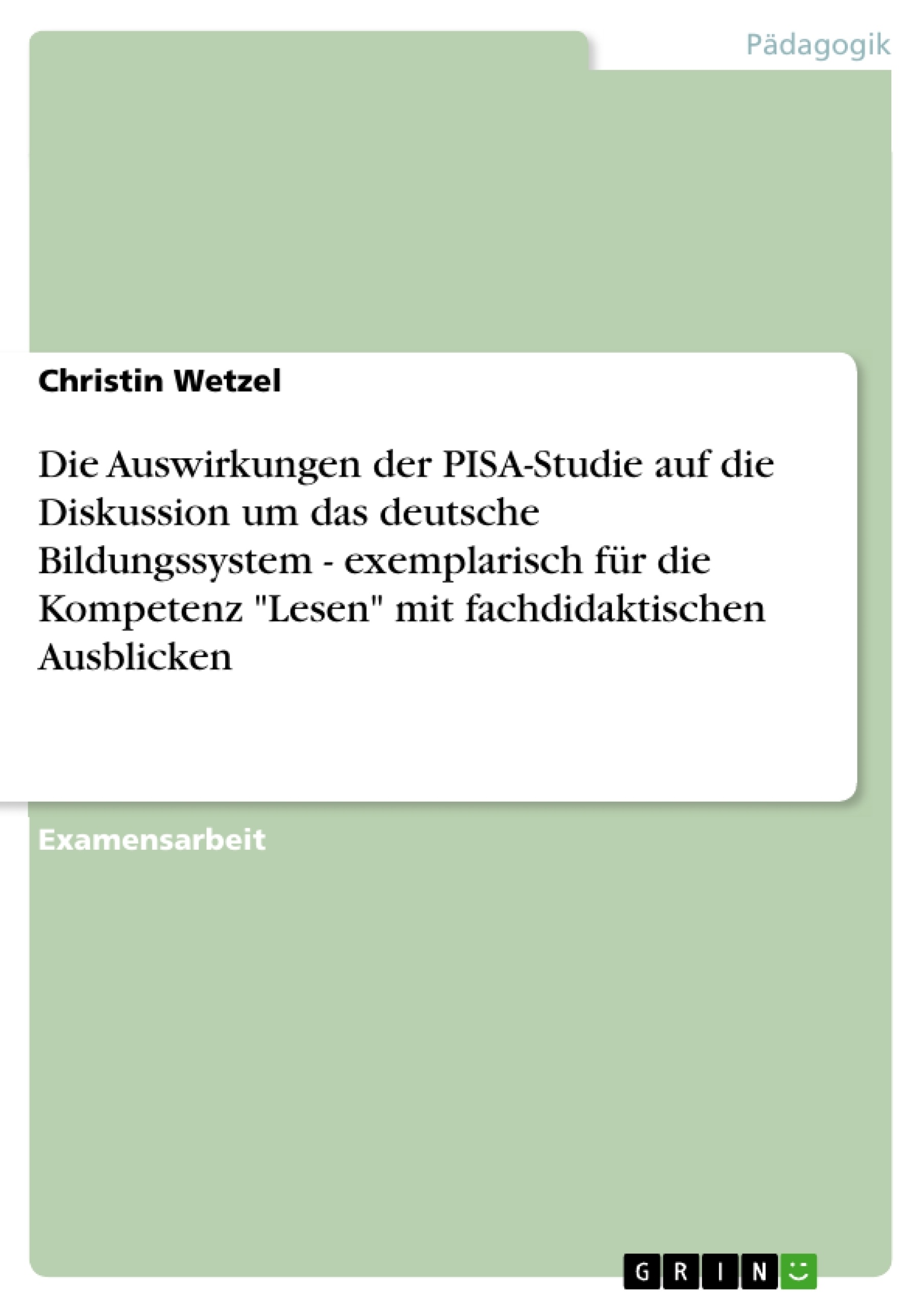Die vorliegende Examensarbeit greift die Thematik rund um die PISA-Studie wieder auf und konzentriert sich dabei auf den ersten Erhebungszyklus PISA 2000, da das Hauptaugenmerk dieser Untersuchung auf die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schülern gerichtet war. Insbesondere beschäftige ich mich mit den Auswirkungen der PISAStudie
auf die Diskussion um das deutsche Bildungssystem, dem internationalen und nationalen PISA-Lesekompetenztest und der Leseförderung. Um also eine umfassende Auseinandersetzung mit der weitreichenden Thematik PISA zu gewährleisten, werde ich mich nicht nur auf den Test konzentrieren, sondern in einem ersten Schritt einen Überblick über die Reaktionen der verschiedenen öffentlichen Instanzen geben, um das „Phänomen PISA“ greifbar zu machen. Der zweite Teil dieser Arbeit besteht dann in einer intensiven
Auseinandersetzung mit der PISA-Studie und legt dabei ein Hauptaugenmerk auf den Lesekompetenztest.
Außerdem versucht diese Arbeit in einem dritten Teil über die in der
Auseinandersetzung mit PISA obligatorisch erscheinende Bildungsschelte hinauszugehen, indem sie sich als Konsequenz aus PISA 2000, aber auch in Abgrenzung hierzu näher mit dem Thema Leseförderung auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Die PISA-Studie - Ein kurzer Überblick
- 2. Die Auswirkungen der PISA-Studie auf die Diskussion um das deutsche Bildungssystem
- 2.1. PISA als Impuls einer medialen Schulschelte
- 2.2. Bildungspolitische Konsequenzen nach PISA
- 2.2.1. Der bildungspolitische Diskurs
- 2.2.2. Die Bildungsstandards – Eine Konsequenz des bildungspolitischen Diskurses
- 2.2.3. Die Bildungsstandards in der Diskussion
- 2.3. Reaktionen der Deutschdidaktik auf die PISA-Studie
- 2.4. Kritik an PISA
- 3. PISA 2000 und die Lesekompetenz
- 3.1. Lesekompetenz – Versuch einer Begriffsdefinition
- 3.1.1. Der Lesekompetenztest
- 3.1.2. Leistungsmessung
- 3.1.3. Zu den Resultaten der deutschen Schülerinnen und Schüler
- 3.2. PISA-E- Die Bundesländer im Vergleich
- 3.2.1. Ergebnisse des nationalen Ergänzungstests PISA-E
- 3.2.2. Der nationale Lesekompetenztest – oder wer wurde wann wie getestet
- 3.3. Die kognitionspsychologische Textverstehenstheorie
- 3.4. Aufgabenanalyse der Lesekompetenzaufgaben im Haupttest PISA 2000
- 3.4.1. Unit „Turnschuhe“
- 3.4.2. Unit „Graffiti“
- 3.4.3. Unit „Erwerbstätige Bevölkerung“
- 3.4.4. Unit „Plan International“
- 3.5. Fördermöglichkeiten der Lesekompetenz laut PISA
- 4. Leseförderung
- 4.1. Zielgruppen
- 4.2. Das Leseverhalten von Jugendlichen
- 4.3. Exkurs: DESI-Studie
- 4.4. Möglichkeiten der Leseförderung
- 4.4.1. Lesesozialisation in der Familie
- 4.4.2. Lesen im Unterricht
- 4.4.3. Mediensozialisation
- 4.4.4. Textverstehen – Konsequenzen für den Deutschunterricht
- 4.4.5. Lesestrategien
- 4.4.5.1. Der Aufbau von Lesestrategien nach Chamot
- 4.4.5.2. Lesestrategien auf der mentalen Ebene
- 4.4.6. Schulorganisatorische Maßnahmen zur Leseförderung
- 4.4.7. Die Schulbibliothek
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der PISA-Studie 2000, insbesondere auf die Diskussion um die Lesekompetenz im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die mediale Resonanz, bildungspolitische Konsequenzen und Reaktionen der Deutschdidaktik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Lesekompetenztests selbst und der Erörterung von Fördermöglichkeiten der Lesekompetenz.
- Auswirkungen der PISA-Studie auf die öffentliche und bildungspolitische Diskussion
- Analyse des PISA-Lesekompetenztests und seiner Methodik
- Reaktionen der Deutschdidaktik auf die PISA-Ergebnisse
- Möglichkeiten der Leseförderung im familiären, schulischen und medialen Kontext
- Konsequenzen für den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anlass der Arbeit: die mittelmäßigen Leistungen deutscher Schüler in der PISA-Studie und die daraus resultierende Kritik am deutschen Bildungssystem. Der Fokus liegt auf PISA 2000 und dessen Auswirkungen auf die Diskussion um das deutsche Bildungssystem, den Lesekompetenztest und die Leseförderung. Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: die mediale Rezeption und bildungspolitische Konsequenzen der PISA-Studie, die Analyse des Lesekompetenztests und schließlich Möglichkeiten der Leseförderung.
2. Die Auswirkungen der PISA-Studie auf die Diskussion um das deutsche Bildungssystem: Dieses Kapitel analysiert die öffentliche und mediale Reaktion auf die PISA-Ergebnisse. Es beleuchtet die Kritik am deutschen Bildungssystem, die daraus resultierenden bildungspolitischen Konsequenzen wie die Einführung von Bildungsstandards und die Reaktionen der Deutschdidaktik. Es werden verschiedene Perspektiven und Kritikpunkte an der Studie selbst diskutiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der vielschichtigen Reaktionen auf die „Bildungskatastrophe“ und den daraus entstandenen Diskurs.
3. PISA 2000 und die Lesekompetenz: Dieses Kapitel widmet sich dem Lesekompetenztest von PISA 2000. Es beinhaltet eine Definition des Begriffs „Lesekompetenz“, eine Beschreibung des Tests und seiner Methodik, sowie eine Analyse der Ergebnisse. Der Vergleich der Bundesländer im Rahmen der PISA-E-Studie wird ebenfalls betrachtet. Es werden die kognitionspsychologischen Grundlagen des Tests beleuchtet, und anhand einer Aufgabenanalyse werden Stärken und Schwächen des Tests kritisch untersucht.
4. Leseförderung: Das Kapitel fokussiert auf die Leseförderung als Reaktion auf die PISA-Ergebnisse. Es beschreibt Zielgruppen und deren Leseverhalten, wobei die Ergebnisse der „Muss-Lektüre versus Lust-Lektüre“-Studie und der DESI-Studie herangezogen werden. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Leseförderung diskutiert, die sich auf die familiäre Lesesozialisation, den Unterricht, die Mediensozialisation und den Einsatz von Lesestrategien konzentrieren. Organisatorische Maßnahmen der Schulen zur Leseförderung werden ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
PISA-Studie, Lesekompetenz, Bildungssystem, Deutschland, Bildungsstandards, Deutschdidaktik, Leseförderung, Medienrezeption, Bildungspolitik, Textverstehen, Leistungsmessung, PISA-E.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Auswirkungen der PISA-Studie 2000 auf die Lesekompetenz im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der PISA-Studie 2000, insbesondere auf die Diskussion um die Lesekompetenz im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die mediale Resonanz, bildungspolitische Konsequenzen und Reaktionen der Deutschdidaktik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Lesekompetenztests selbst und der Erörterung von Fördermöglichkeiten der Lesekompetenz.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Auswirkungen der PISA-Studie auf die öffentliche und bildungspolitische Diskussion; die Analyse des PISA-Lesekompetenztests und seiner Methodik; die Reaktionen der Deutschdidaktik auf die PISA-Ergebnisse; Möglichkeiten der Leseförderung im familiären, schulischen und medialen Kontext; und die Konsequenzen für den Deutschunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Auswirkungen der PISA-Studie auf das deutsche Bildungssystem, PISA 2000 und die Lesekompetenz, und Leseförderung. Die Einleitung beschreibt den Anlass der Arbeit und den Fokus auf PISA 2000. Kapitel 2 analysiert die mediale und bildungspolitische Reaktion auf die PISA-Ergebnisse. Kapitel 3 widmet sich dem Lesekompetenztest, seiner Methodik und den Ergebnissen. Kapitel 4 befasst sich mit verschiedenen Möglichkeiten der Leseförderung.
Was sind die zentralen Ergebnisse der PISA-Studie 2000, die in der Arbeit diskutiert werden?
Die Arbeit diskutiert die mittelmäßigen Leistungen deutscher Schüler im PISA-Test, insbesondere im Bereich Lesekompetenz. Sie analysiert die daraus resultierende Kritik am deutschen Bildungssystem und die unterschiedlichen Reaktionen darauf.
Welche bildungspolitischen Konsequenzen wurden aus der PISA-Studie gezogen?
Die PISA-Studie führte zu einer breiten öffentlichen und politischen Diskussion über das deutsche Bildungssystem. Eine wichtige Konsequenz war die Einführung von Bildungsstandards. Die Arbeit analysiert diesen bildungspolitischen Diskurs und die damit verbundenen Herausforderungen.
Wie wird der PISA-Lesekompetenztest analysiert?
Der Lesekompetenztest von PISA 2000 wird im Detail analysiert. Dies beinhaltet eine Definition von Lesekompetenz, eine Beschreibung der Testmethodik, eine Analyse der Ergebnisse und einen Vergleich der Bundesländer im Rahmen der PISA-E-Studie. Die kognitionspsychologischen Grundlagen des Tests werden beleuchtet und ausgewählte Aufgaben werden kritisch untersucht.
Welche Möglichkeiten der Leseförderung werden vorgestellt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Möglichkeiten der Leseförderung, die sich auf die familiäre Lesesozialisation, den Unterricht, die Mediensozialisation und den Einsatz von Lesestrategien konzentrieren. Organisatorische Maßnahmen der Schulen zur Leseförderung und die Rolle der Schulbibliothek werden ebenfalls betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: PISA-Studie, Lesekompetenz, Bildungssystem, Deutschland, Bildungsstandards, Deutschdidaktik, Leseförderung, Medienrezeption, Bildungspolitik, Textverstehen, Leistungsmessung, PISA-E.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem deutschen Bildungssystem, der PISA-Studie, Lesekompetenz, Deutschdidaktik und Leseförderung auseinandersetzen. Dies beinhaltet Lehrende, Studierende der Pädagogik und Bildungswissenschaften, Bildungspolitiker und alle Interessierten an bildungsrelevanten Themen.
- Citation du texte
- Christin Wetzel (Auteur), 2006, Die Auswirkungen der PISA-Studie auf die Diskussion um das deutsche Bildungssystem - exemplarisch für die Kompetenz "Lesen" mit fachdidaktischen Ausblicken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76598