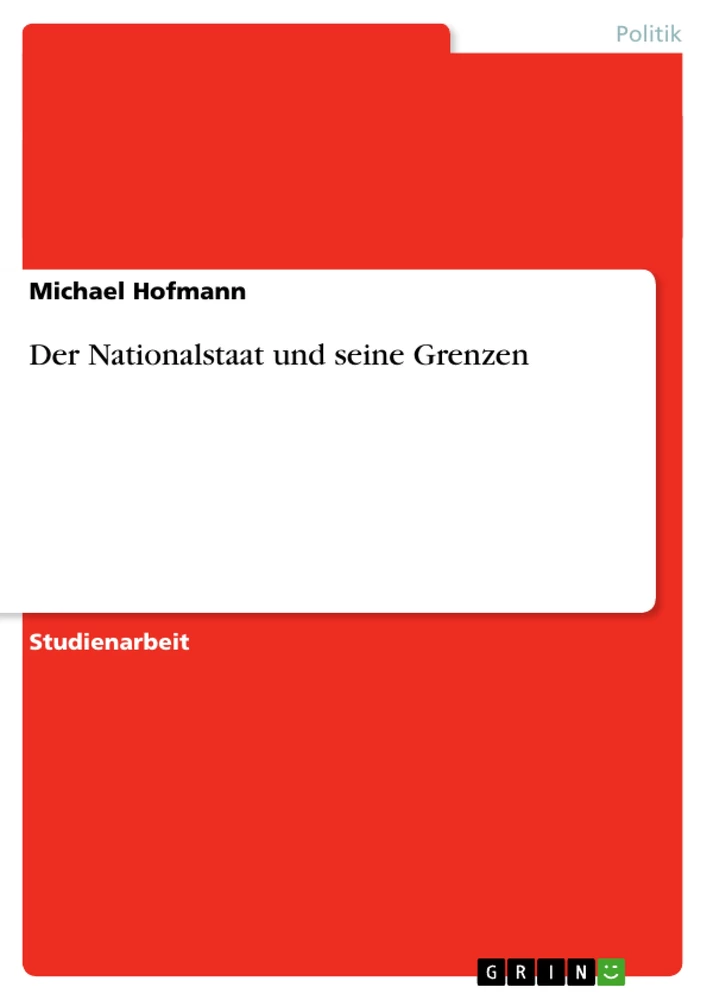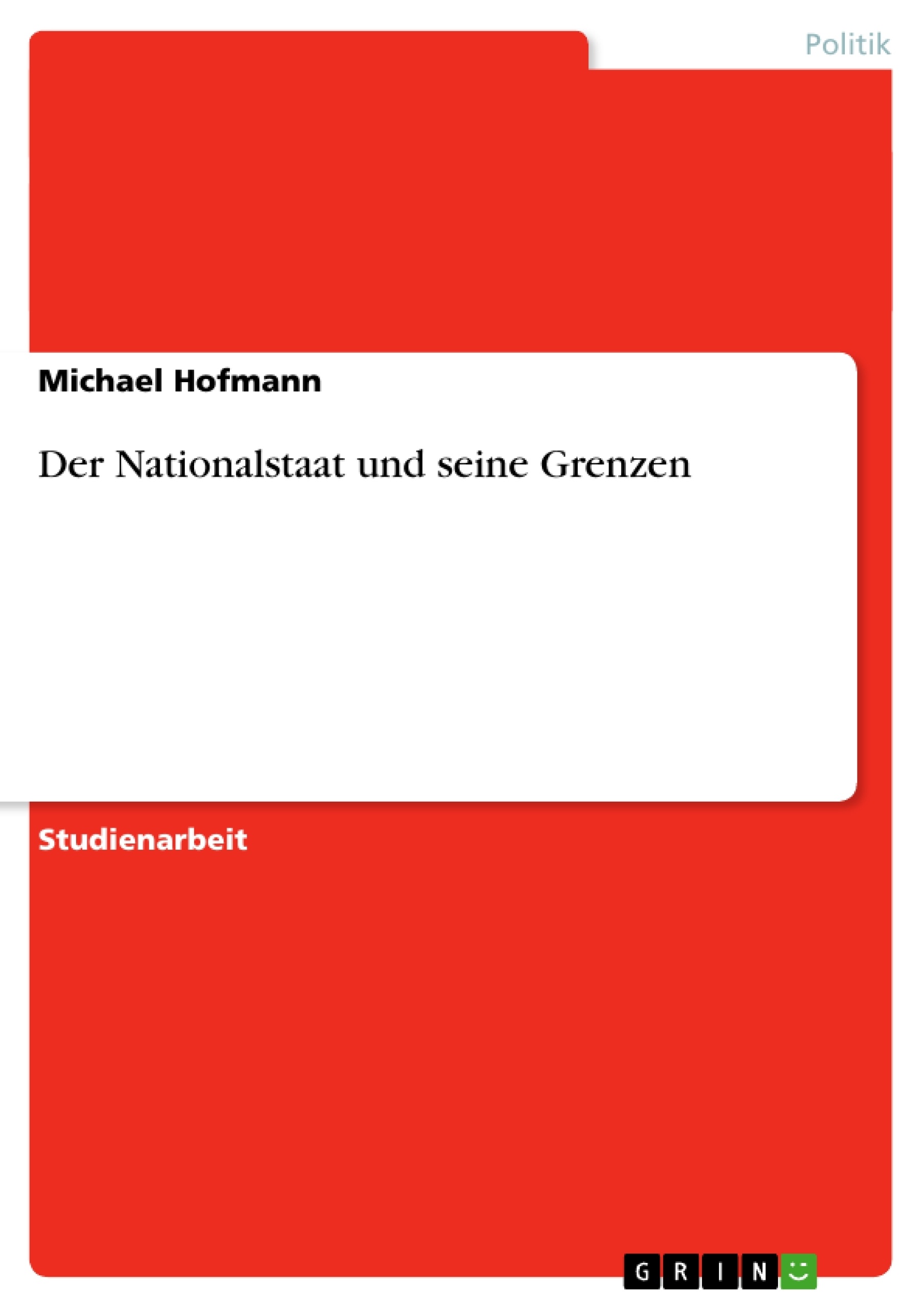Dem Forschungsgebiet der internationalen Politik scheint seit dem Ende des 20. Jahrhunderts langsam aber unaufhaltsam ein zentraler Forschungsgegenstand abhanden zu kommen. Der Nationalstaat als Ordnungseinheit des Systems der globalen Politik ist extremem, externen Druck ausgesetzt, der die Prinzipien der Souveränität und der Autonomie auf das Äußerste gefährdet.
Zu diesen externen Faktoren, die den Nationalstaat herausfordern, gehören zum einen die Entwicklungen des zunehmend globalisierten Wirtschaftssystems. Märkte haben sich zu globalen Weltmärkten herausgebildet, Firmen operieren mehr und mehr auf transnationaler Ebene und Kapital überschreitet innerhalb weniger Sekunden die Grenzen der Nationalstaaten (Heywood 2002: 122). Die Nationalstaaten haben diesbezüglich große Schwierigkeiten, ihre wirtschaftlichen Politiken autonom zu gestalten. Ein weiterer Aspekt, der zum abnehmenden Handlungsspielraum der Nationalstaaten beiträgt, ist, vor allem in Europa, die gestiegene Tendenz, ehemals nationale Kompetenzen auf supranationale Entscheidungsstrukturen zu transferieren. Schließlich tragen auch grenzüberschreitende Entwicklungen im Bereich der Kriegsführung (Bedrohungen atomarer, biologischer und chemischer Waffen) und der Zustand des „Ökosystems Erde“ dazu bei, dass Problemlösungskapazitäten nicht mehr allein im nationalen Rahmen geschaffen werden können, sondern eine supranationale und internationale Ebene der Steuerung bedürfen.
Neben dieser Entwicklung, die den Nationalstaat aufgrund externer Einflüsse in seiner Entscheidungsautonomie schwächt, ist aber auch das Wiederaufleben nationaler Ideen zu konstatieren. So machen sich „sowohl in Ost- als auch in Westeuropa starke Tendenzen einer Nationalisierung und Bestätigung der Staaten bemerkbar“ (Hassner 2000: 103). Dies scheint umso erstaunlicher, da im Westen Europas der Nationalismus durch den Aufbau und die Etablierung eines wirtschaftlichen und teilweise auch politischen Systems der europäischen Integration bereits ein Relikt der Vorkriegszeit zu sein schien.
Aufgabe dieser Arbeit wird es sein, auf die Bedeutungen, Erscheinungsformen und Gründe dieser neuen Nationalismen einzugehen, die sich westlich und östlich des ehemaligen Eisernen Vorhangs herausbilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Nationalstaat: Eine begriffliche Annäherung
- 3. Neue Nationalismen
- 3.1. Osteuropas Nationalismus
- 3.2. Westeuropas Nationalismus
- 4. Bedeutung des Selbstbestimmungsrecht der Völker
- 5. Das Konzept des Global Governance
- 6. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Nationalstaates im Kontext der Globalisierung und neuen Nationalismen. Sie analysiert die Herausforderungen, die der Nationalstaat durch zunehmende Globalisierung und supranationale Integration erfährt, und untersucht gleichzeitig das Phänomen wiedererstarkender nationaler Ideen.
- Die Rolle des Nationalstaates in einem globalisierten Wirtschaftssystem
- Die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts der Völker im Kontext von Nationalismus
- Die Herausforderungen und Chancen des Global Governance im Hinblick auf die Rolle des Nationalstaates
- Die Entwicklung von neuen Nationalismen in Ost- und Westeuropa
- Die theoretischen und praktischen Implikationen des Nationalismus im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Nationalstaat als zentralen Gegenstand der internationalen Politik vor und beleuchtet die Herausforderungen, die er durch Globalisierung und andere externe Faktoren erfährt. Kapitel 2 geht näher auf die begriffliche Annäherung an den Nationalstaat ein, indem es die Konzepte von "Nation" und "Staat" analysiert. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Determinanten der nationalen Identität und der Rolle des Staates als Organisationseinheit.
Kapitel 3 widmet sich dem Phänomen der neuen Nationalismen in Ost- und Westeuropa, die sich trotz des vermeintlichen Rückzugs des Nationalismus in Folge der europäischen Integration wieder verstärkt zeigen. Die Analyse der neuen Nationalismen beleuchtet die Ursachen, die Erscheinungsformen und die Bedeutung dieses Trends. Kapitel 4 untersucht das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das eng mit dem Konzept des Nationalstaates verknüpft ist. Es werden die theoretischen Grundlagen und die praktische Bedeutung dieses Rechts in einem globalisierten Kontext beleuchtet.
Kapitel 5 analysiert das Konzept des Global Governance und die Rolle des Nationalstaates innerhalb dieses Systems. Es wird untersucht, welche Voraussetzungen ein Global Governance-System benötigt, um globale Herausforderungen effektiv zu bewältigen, und wie der Nationalstaat in diesen Prozess integriert werden kann.
Schlüsselwörter
Nationalstaat, Globalisierung, Nationalismus, Selbstbestimmungsrecht, Global Governance, Internationale Beziehungen, supranationale Integration, Europa, Osteuropa, Westeuropa, politische Souveränität, territoriale Integrität.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Herausforderungen steht der Nationalstaat durch die Globalisierung gegenüber?
Der Nationalstaat verliert an Autonomie, da Wirtschaftsmärkte global agieren, Kapital Grenzen in Sekunden überschreitet und Umweltprobleme sowie moderne Kriegsführung supranationale Lösungen erfordern.
Was versteht man unter „neuen Nationalismen“?
Trotz globaler Integration erstarken in Ost- und Westeuropa nationale Ideen erneut, oft als Reaktion auf den Souveränitätsverlust und als Bestätigung staatlicher Identität.
Was ist Global Governance?
Global Governance bezeichnet ein System der internationalen Steuerung, in dem Nationalstaaten, internationale Organisationen und supranationale Strukturen zusammenarbeiten, um globale Probleme zu lösen.
Wie unterscheiden sich die Nationalismen in Ost- und Westeuropa?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Ursachen und Erscheinungsformen der Nationalisierung in beiden Regionen, wobei in Westeuropa oft die EU-Integration als Gegenpol wirkt.
Welche Rolle spielt das Selbstbestimmungsrecht der Völker heute?
Es bleibt ein zentrales Konzept, das eng mit der Legitimität des Nationalstaates verknüpft ist, aber im Spannungsfeld zwischen territorialer Integrität und globaler Vernetzung steht.
- Citar trabajo
- Michael Hofmann (Autor), 2005, Der Nationalstaat und seine Grenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76714