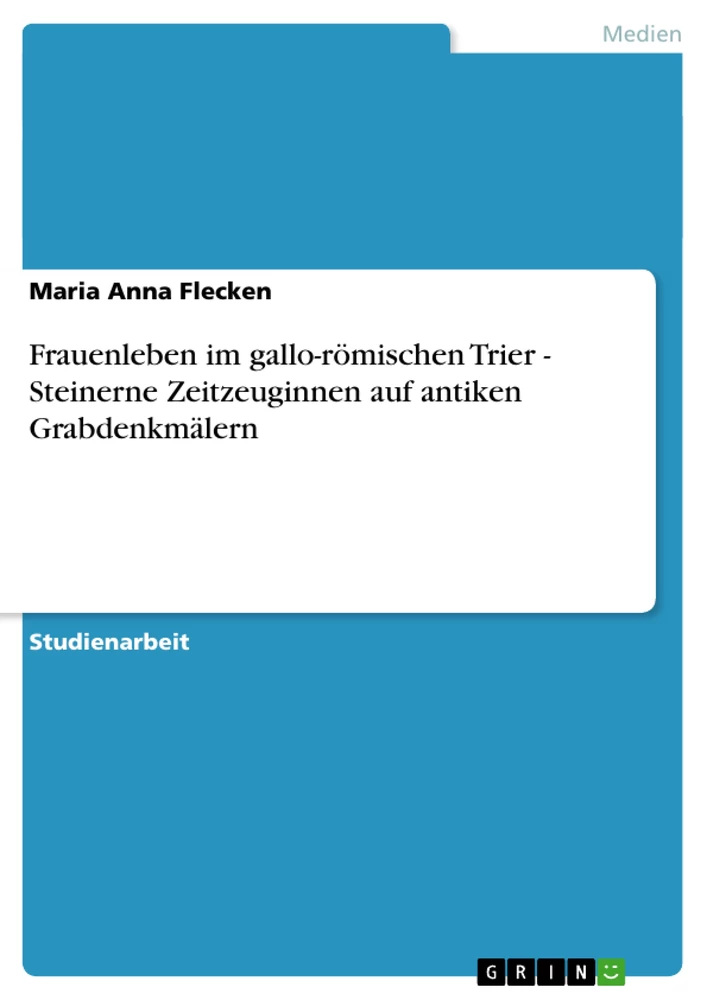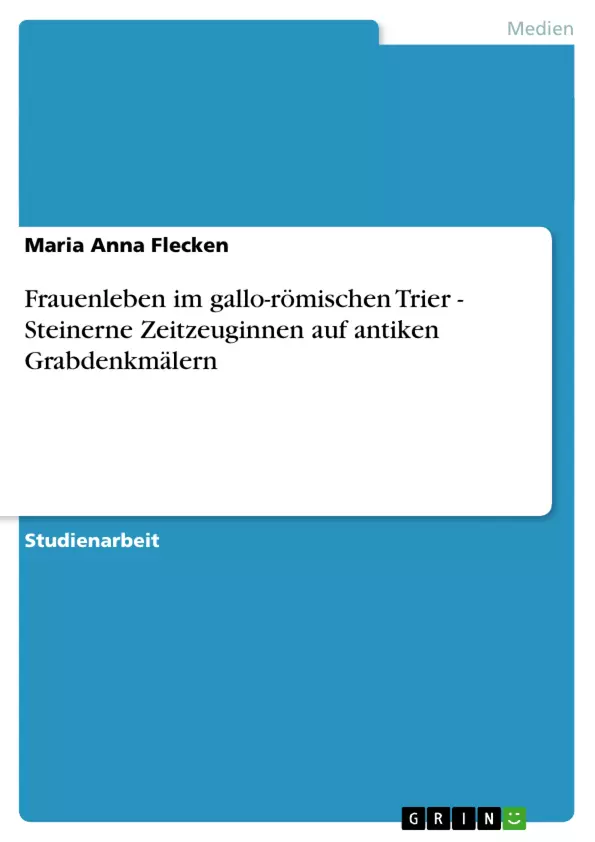Die Geschichte der über zweitausend Jahre alten Stadt Trier ist auch gleichzeitig die Geschichte ihrer männnlichen und weiblichen Einwohner. Viele antike Denkmäler, die uns die Römer in Trier hinterließen, prägen auch heute noch das moderne Stadtbild und lassen uns als bleibende Dokumente erahnen, wie die Menschen in der römischen Kaiserzeit lebten.
Szenen aus ihrem Alltagsleben finden wir noch auf ihren scheinbar für die Ewigkeit erbauten Grabmälern vor. Sie zeigen uns Darstellungen aus dem Leben der wohlsituierten treverischen Oberschicht, die unter der Herrschaft des damals allgegenwärtigen Rom (2. - 4. Jh. n. Chr.) zu wirtschaftlichem Reichtum gelangt war.
Die Denkmäler vermitteln uns Bilder von Frauen, die eng mit dem Beruf und dem Leben ihrer Ehemänner verbunden sind. Sie zeigen sie voller Eleganz, in ihrer ganzen Schlichtheit, oft als liebende und treue Gattinnen oder als liebevolle Familienmütter.
Die Welt der reichen Trevererinnen war die Welt der Großgrundbesitzer und Großhändler, die in den Zeiten der Romanisierung ihren wirtschaftlichen Wohlstand zu genießen wußten. Im Gegensatz zu den einfachen Frauen aus dem Volke hatten sie es nicht nötig, die im Haus oder auf dem Gutshof anfallenden Arbeiten selbst zu verrichten, da ihnen stets genügend Dienstboten zur Verfügung standen, Sklaven und Freigeborene, die sich in den Häusern der Reichen verdingten, um den ihrer Herrin unwürdigen Aufgaben nachzukommen. So hatte die Dame des Hauses viel Zeit zur freien Verfügung, um Freunden und Verwandten Besuche abstatten, Einkäufe erledigen oder Festlichkeiten und Theateraufführungen besuchen zu können.
Oft fand man sie, mit der Spindel oder dem Webstuhl hantierend, inmitten ihrer Mägde im Atrium sitzend, vor.3 Beide Tätigkeiten galten in den Augen der römischen Männerwelt als besondere hausfrauliche Tugenden. Die Frauen verbrachten einen großen Teil des Tages mit diesen handwerklichen Fertigkeiten, und so war diesen Arbeiten in den einzelnen Hausgemeinschaften wohl auch ein hoher Stellenwert beizumessen.
Inhaltsverzeichnis
- Frauenleben in der römischen Kaiserzeit
- Allgemeine Einführung
- Die Geburt
- Die Namensgebung
- Die Ehe
- Zusammenfassung
- Frauendarstellungen auf antiken Trierer Grabdenkmälern
- Das Grabmal des Albinius Asper und seiner Ehefrau Secundia Restituta
- Die gallo-römische Tracht
- Das Grabmal von Hentern
- Der Elternpaarpfeiler
- Die Frisierdarstellungen
- "Schönheit ist Göttergeschenk: wie wenige rühmen sich dessen!" (Ovid. Ars amatoria 3, 103-105) - Schönheitspflege in der römischen Kaiserzeit
- Die Familienmahldarstellungen
- Zusammenfassung
- Das Grabmal des Albinius Asper und seiner Ehefrau Secundia Restituta
- Die Rolle der Frau im antiken Berufsleben
- Abschlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Frauenlebens im gallo-römischen Trier, insbesondere anhand von Grabmalsdarstellungen. Sie untersucht die Rolle der Frau in der römischen Gesellschaft, ihre Lebensumstände und ihre Darstellung in Kunst und Kultur.
- Die Stellung der Frau in der römischen Gesellschaft
- Die Bedeutung der Familie und der häuslichen Pflichten
- Die Rolle der Frau in der römischen Religion und Kultur
- Die Darstellung von Frauen auf antiken Grabdenkmälern
- Die Bedeutung von Kleidung und Schmuck als Ausdruck von Status und Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Frauenleben in der römischen Kaiserzeit allgemein. Es betrachtet die Geburt, die Namensgebung, die Ehe und die Lebensumstände von Frauen aus der wohlhabenden Oberschicht. Das zweite Kapitel widmet sich der Interpretation von Frauendarstellungen auf antiken Trierer Grabdenkmälern. Dabei werden das Grabmal des Albinius Asper und seiner Ehefrau Secundia Restituta, das Grabmal von Hentern, der Elternpaarpfeiler, die Frisierdarstellungen, Schönheitspflege und Familienmahlzeitendarstellungen genauer untersucht. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Rolle der Frau im antiken Berufsleben.
Schlüsselwörter
Frauenleben, gallo-römisches Trier, antike Grabdenkmäler, römische Kaiserzeit, Frauendarstellungen, gesellschaftliche Rolle, Familie, Religion, Kultur, Kleidung, Schmuck, Status, Identität, Berufsleben.
Häufig gestellte Fragen
Wie lebten Frauen im gallo-römischen Trier?
Frauen der Oberschicht führten ein Leben geprägt von wirtschaftlichem Wohlstand, unterstützt durch Sklaven, und widmeten sich Besuchen, Festlichkeiten sowie häuslichen Tugenden wie dem Weben.
Was verraten Grabdenkmäler über den Alltag der Trevererinnen?
Die Reliefs zeigen Szenen wie die Schönheitspflege (Frisieren), Familienmahlzeiten und die Arbeit mit der Spindel, was Rückschlüsse auf Status und Rollenbilder zulässt.
Welche Bedeutung hatte die Ehe in der römischen Kaiserzeit?
Die Ehe diente oft der sozialen und wirtschaftlichen Allianz. Frauen wurden auf Grabmälern häufig als treue Gattinnen und liebevolle Mütter idealisiert.
Gibt es Hinweise auf die Tracht gallo-römischer Frauen?
Ja, Grabdenkmäler wie das des Albinius Asper dokumentieren die spezifische gallo-römische Tracht und den Schmuck der damaligen Zeit.
Hatten Frauen im antiken Trier Berufe?
Während Frauen der Oberschicht meist repräsentative Rollen hatten, waren einfache Frauen im Handwerk oder Handel tätig, was ebenfalls in der Forschung untersucht wird.
- Citar trabajo
- Dr. Maria Anna Flecken (Autor), 1993, Frauenleben im gallo-römischen Trier - Steinerne Zeitzeuginnen auf antiken Grabdenkmälern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7685