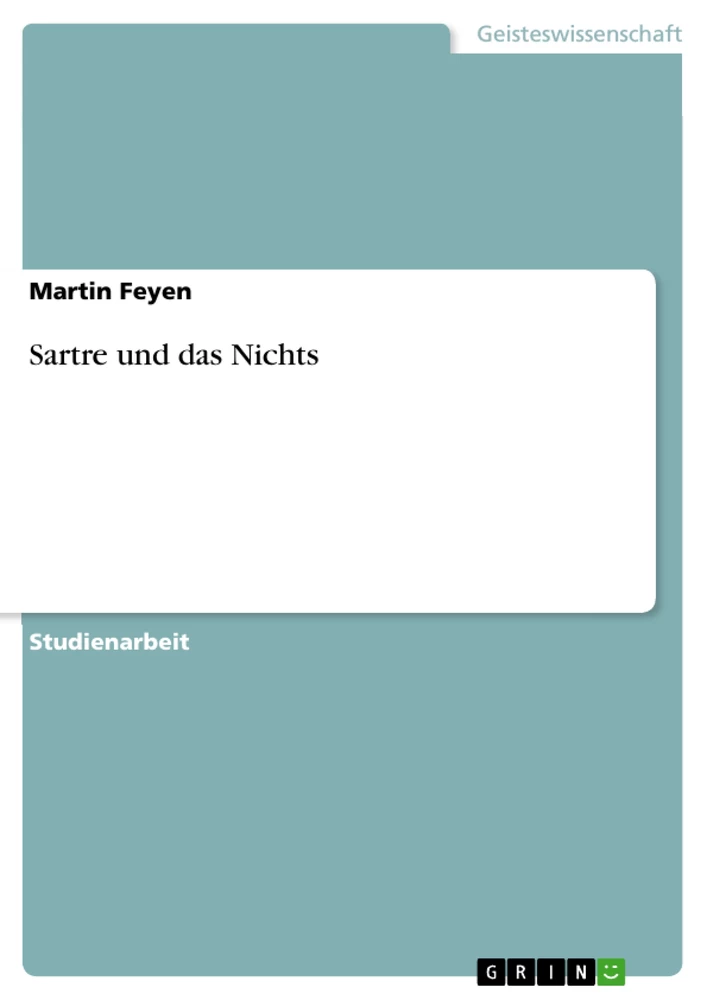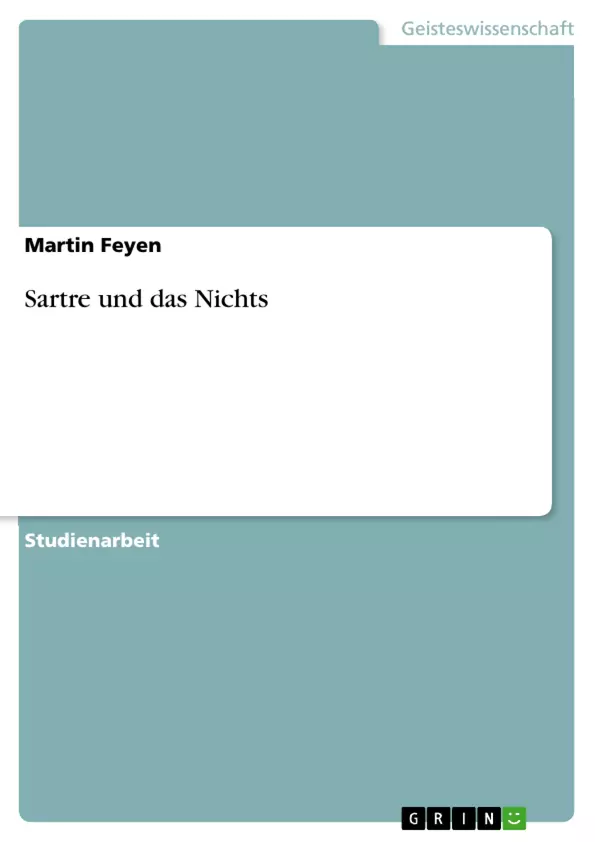Von Gustave Flaubert ist der Ausspruch überliefert, er wolle am liebsten einmal „ein Buch über nichts“ schreiben. Das „nichts“, das dem Schriftsteller dabei vorschwebte, war in Wirklichkeit freilich kein „Nichts“, sondern „etwas“ - etwas Bedeutungsloses, etwas, das wegen seiner Alltäglichkeit bis dahin üblicherweise außerhalb des literarischen Interesses lag. In diesem Sinne wird das Wort „nichts“ im Alltag ständig verwendet: Es bezeichnet nicht die vollständige Abwesenheit von Seiendem überhaupt, sondern lediglich von irgendwie „bedeutsamem“ Seienden. Was dabei als „bedeutsam“ gilt, liegt im Ermessen des Sprechers: Entscheidend für seine Verwendung des Wortes „nichts“ ist allein sein Bezug zu dem Seienden, das ihn umgibt.
Was im Alltag keine Probleme bereitet, stellte für die Philosophen lange Zeit ein Skandalon dar. Der Grund dafür liegt auf der Hand : Da sie im allgemeinen lieber vom Sein selbst als von ihrem Bezug dazu reden, musste ihnen das Wort „nichts“ als Verneinung jeglichen Seins von jeher suspekt sein. Bestenfalls diente es ihnen (wie z.B. Augustinus) als Grenzbegriff, der den Bereich des überhaupt denkbaren markierte. Im 20. Jahrhundert war es dann zunächst Martin Heidegger, der dem Nichts zu philosophischer Dignität verhalf. Hatte er schon in seinem Jahrhundertwerk Sein und Zeit (1926) dem Tod ein ganzes Kapitel gewidmet, erklärte er in seiner Freiburger Antrittsvorlesung (1929) die Frage „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts?“ zur „Grundfrage der Metaphysik“ überhaupt. Ja, Dasein heiße geradezu „Hineingehaltenheit in das Nichts“. Unter dem Schlagwort „Zu den Sachen selbst!“ begibt sich der Husserl-Schüler in seinem Hauptwerk Sein und Zeit auf die Suche nach der Wahrheit, unter der er ein „reines Sehenlassen“ der „einfachsten Seinsbestimmungen des Seienden als solchen“ versteht.
Die Lektüre Husserls und Heideggers prägt schließlich das Werk Jean-Paul Sartres, in dessen „Versuch einer phänomenologischen Ontologie“ das Nichts sehr viel mehr Raum einnimmt als bei seinen philosophischen Vorbildern: Ein ganzes Kapitel ist darin dem „Problem des Nichts“ gewidmet. Thema der vorliegenden Arbeit ist Sartres Exposition dieses Problems, die er anhand des Phäno-mens der „Frage“ und der „Negationen“ vornimmt. Dabei wird sein Vorgehen zunächst ausführlich dargestellt und dann kommentiert. Den Schluss bildet eine allgemeine Bewertung des „Nichts“ in der Bedeutung, die Sartre ihm gibt.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Sartre und das Nichts
- II. 1) Die Frage
- II.2) Die Negationen
- II.2.1) Die Zerstörung
- II.2.2) Pierres Abwesenheit
- III.) Kommentar
- IV.) Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jean-Paul Sartres Auseinandersetzung mit dem Nichts in seinem Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“. Ziel ist es, Sartres Argumentation nachzuvollziehen und zu kommentieren, indem seine Betrachtung der „Frage“ und der „Negationen“ analysiert wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung und Bewertung von Sartres Konzept des Nichts im Kontext seiner phänomenologischen Ontologie.
- Sartres Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein
- Das Problem des Nichts als Synthese von An-sich-Sein und Für-sich-Sein
- Die Rolle der „Frage“ in Sartres Ontologie
- Die Bedeutung der „Negationen“ (Zerstörung und Abwesenheit) für das Verständnis des Nichts
- Bewertung von Sartres Konzept des Nichts
Zusammenfassung der Kapitel
I.) Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Nichts“ im Alltag und in der Philosophie. Im Alltag bezeichnet „Nichts“ meist die Abwesenheit von etwas Bedeutsamen, während Philosophen das Nichts lange Zeit als Verneinung jeglichen Seins betrachteten. Heidegger wird als Wegbereiter für eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Nichts genannt, seine phänomenologische Methode wird kurz skizziert. Der Bezug zu Husserls Phänomenologie und deren Einfluss auf Sartre wird hergestellt, um den Kontext von Sartres Werk zu verdeutlichen. Die Arbeit selbst wird als Auseinandersetzung mit Sartres Exposition des Problems des Nichts angekündigt.
II.) Sartre und das Nichts: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und befasst sich mit Sartres Betrachtung des Nichts. Es beginnt mit der Darstellung der "Suche nach dem Sein" in Sartres Hauptwerk und der Unterscheidung zwischen dem menschlichen Sein (Für-sich-Sein) und dem Sein der Dinge (An-sich-Sein). Die scheinbare Trennung dieser beiden Seinsbereiche wird durch die Einführung des „Problems des Nichts“ aufgehoben. Sartre argumentiert, dass das Verhältnis zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein eine Synthese darstellt, die sich am besten im menschlichen Verhalten beobachten lässt. Das Kapitel legt den Grundstein für die Analyse der „Frage“ und der „Negationen“ in den folgenden Unterkapiteln.
II.1) Die Frage: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle der „Frage“ in Sartres Ontologie. Ausgehend von der Feststellung zweier getrennter Seinsbereiche (An-sich-Sein und Für-sich-Sein) konzentriert sich Sartre auf das Verhältnis zwischen diesen beiden. Das Bewusstsein (Für-sich-Sein) ist immer auf ein anderes Sein gerichtet und somit transzendent. Durch diese Transzendenz ist das Bewusstsein sich selbst fraglich und in einem permanenten Prozess der Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Die Frage dient als Ausgangspunkt für die Erkundung der Beziehung zwischen Bewusstsein und Welt.
II.2) Die Negationen: Dieses Kapitel behandelt Sartres Betrachtung der Negationen als Bestandteil seines Verständnisses des Nichts. Die „Zerstörung“ und „Pierres Abwesenheit“ werden als konkrete Manifestationen des Nichts dargestellt. Diese Unterkapitel untersuchen, wie das Nichts nicht nur als Abwesenheit, sondern als aktive Kraft verstanden werden kann, die das Sein prägt und beeinflusst. Die Analyse dieser Negationen liefert wichtige Erkenntnisse über Sartres phänomenologische Methode und sein Verständnis der menschlichen Existenz.
Schlüsselwörter
Jean-Paul Sartre, Nichts, Sein und Nichts, An-sich-Sein, Für-sich-Sein, Phänomenologie, Ontologie, Negation, Frage, Existenz, Transzendenz.
Häufig gestellte Fragen zu: Sartre und das Nichts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Jean-Paul Sartres Auseinandersetzung mit dem Nichts in seinem Werk „Das Sein und das Nichts“. Der Fokus liegt auf der Nachvollziehung und Kommentierung seiner Argumentation, insbesondere seiner Betrachtung der „Frage“ und der „Negationen“. Die Arbeit untersucht Sartres Konzept des Nichts im Kontext seiner phänomenologischen Ontologie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Sartres Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein, das Problem des Nichts als Synthese beider, die Rolle der „Frage“ in Sartres Ontologie, die Bedeutung der „Negationen“ (Zerstörung und Abwesenheit) für das Verständnis des Nichts und eine abschließende Bewertung von Sartres Konzept des Nichts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zu Sartre und dem Nichts (mit Unterkapiteln zur „Frage“ und den „Negationen“), einen Kommentar und einen Schluss. Die Einleitung beleuchtet den Begriff „Nichts“ im Alltag und in der Philosophie, die Einflüsse von Heidegger und Husserl auf Sartre und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit.
Was ist der Inhalt des Kapitels „Sartre und das Nichts“?
Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und behandelt Sartres Betrachtung des Nichts. Es beschreibt die „Suche nach dem Sein“, die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein und die Überwindung dieser scheinbaren Trennung durch die Einführung des „Problems des Nichts“. Es legt den Grundstein für die Analyse der „Frage“ und der „Negationen“ in den folgenden Unterkapiteln.
Was wird unter „Die Frage“ verstanden?
Der Abschnitt „Die Frage“ analysiert die Rolle der Frage in Sartres Ontologie. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein konzentriert sich Sartre auf deren Verhältnis. Das Bewusstsein (Für-sich-Sein) ist transzendent und in einem permanenten Prozess der Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Die Frage dient als Ausgangspunkt für die Erkundung der Beziehung zwischen Bewusstsein und Welt.
Was sind die „Negationen“ im Kontext von Sartres Philosophie?
Der Abschnitt „Die Negationen“ behandelt Sartres Betrachtung der Negationen als Bestandteil seines Verständnisses des Nichts. „Zerstörung“ und „Pierres Abwesenheit“ werden als konkrete Manifestationen des Nichts dargestellt. Die Analyse zeigt, wie das Nichts nicht nur als Abwesenheit, sondern als aktive Kraft verstanden werden kann, die das Sein prägt und beeinflusst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jean-Paul Sartre, Nichts, Sein und Nichts, An-sich-Sein, Für-sich-Sein, Phänomenologie, Ontologie, Negation, Frage, Existenz, Transzendenz.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse von Sartres Konzept des Nichts und seiner Rolle in seiner phänomenologischen Ontologie. Die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel bietet einen Überblick über die Argumentationslinie und die zentralen Ergebnisse. Die Schlussfolgerung selbst wird im Kapitel "Schluss" präsentiert (im bereitgestellten Textfragment fehlt der Inhalt dieses Abschnitts).
- Citation du texte
- Martin Feyen (Auteur), 2003, Sartre und das Nichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77019