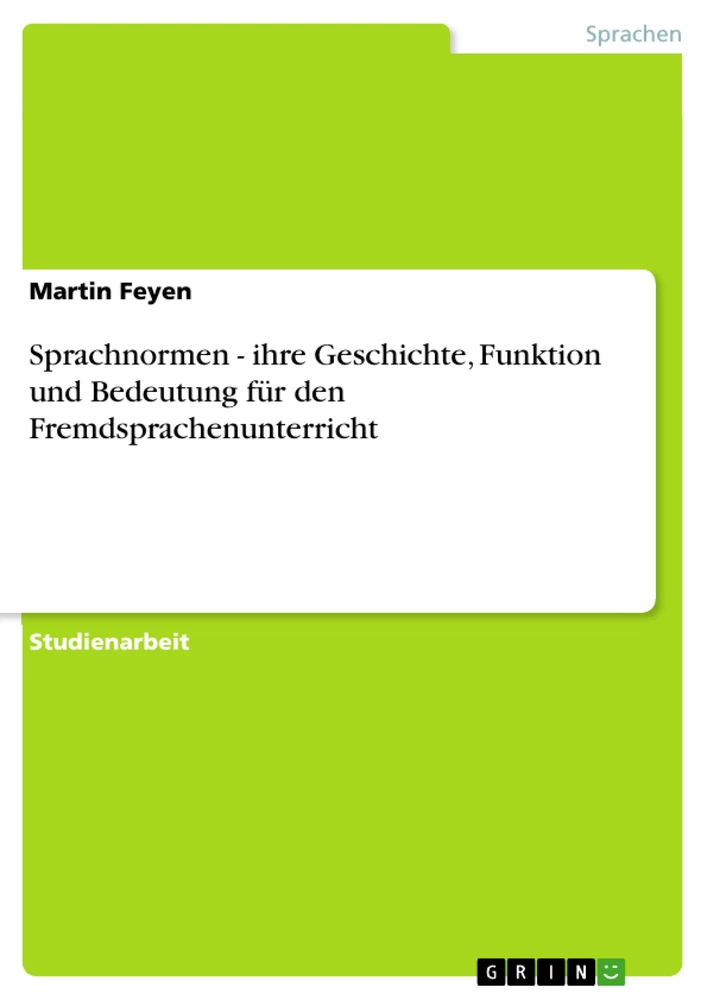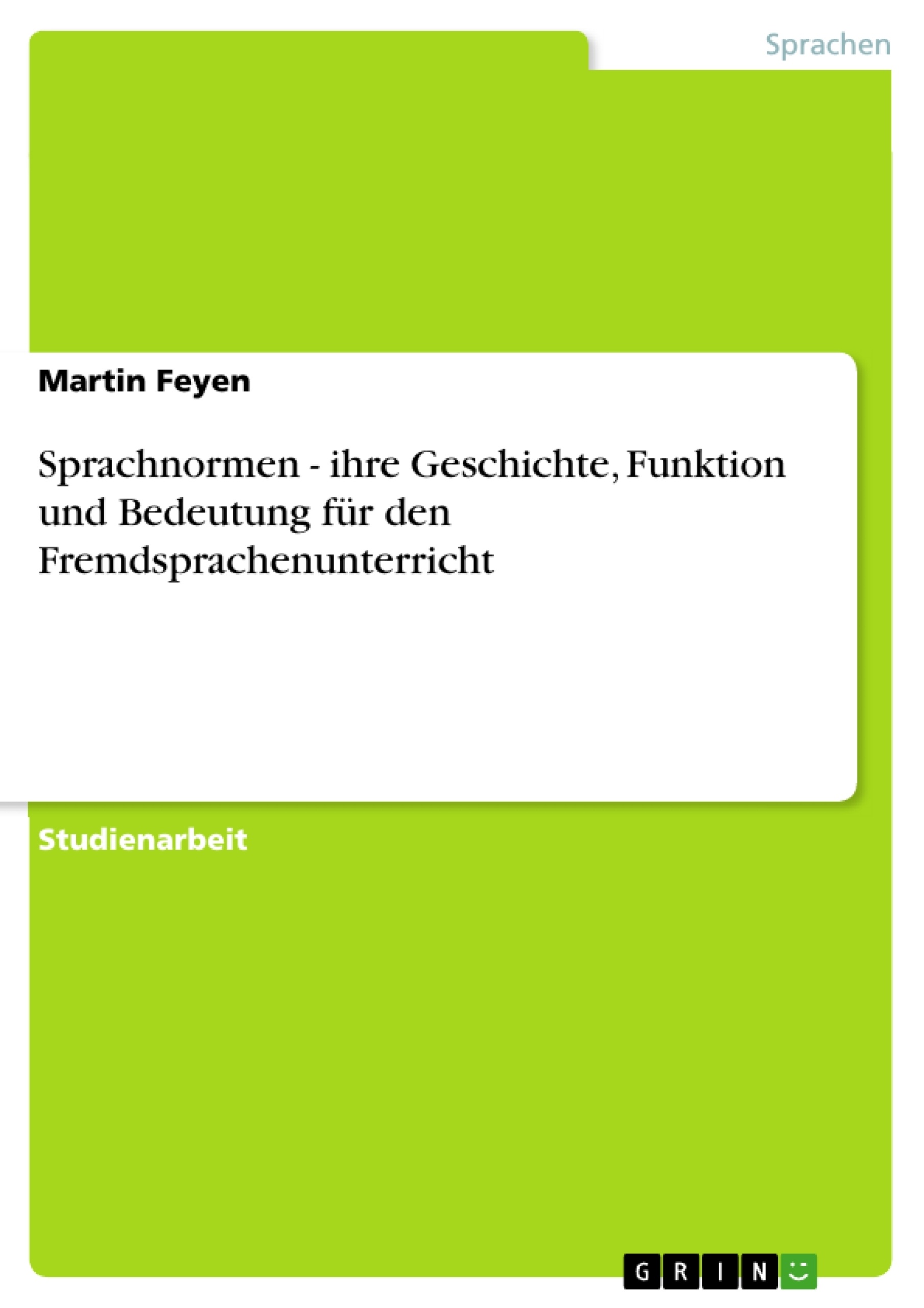Britta Altenkamp-Nowicki will in den Landtag. Doch in ihrem Wahlkreis im Essener Westen weht ihr ein rauer Wind entgegen. Auf einer Versammlung ihres SPD-Ortsvereins geht eine schon etwas betagtere Genossin die ungeliebte Kandidatin scharf an. „Und dann deine Aussprache: immer ,dat’ und ,wat’! Hast du das denn an der Schule nicht gelernt? So kannst du uns doch in Düsseldorf nicht vertreten!“
Die vorangehende Anekdote steht am Beginn dieser Arbeit, da in ihr eine Vermutung über den Zusammenhang zwischen einer bestimmten sprachlichen Varietät und der zu erwartenden Akzeptanz des transportierten Inhalts geäußert wird. Einfacher ausgedrückt: „Wer ,dat’ und ,wat’ sagt wird im Landtag nicht ernstgenommen.“ Mit der Schule wird zugleich auch die Institution benannt, der vermeintlich die Aufgabe zufällt, sprachliche Varietäten mit einer erwartungsgemäß niedrigeren Akzeptanz auszumerzen. Hinter dem Einwurf verbirgt sich also eine linguistische Hypothese mit weitreichenden Konsequenzen für die Sprachdidaktik:
1.) Die Benutzung bestimmter sprachlicher Varietäten verschafft ihren Sprechern in bestimmten kommunikativen Zusammenhängen eine höhere Akzeptanz, die Benutzung anderer Varietäten dagegen ist geeignet diese Akzeptanz von vorn herein zu untergraben.
2.) Da es die Aufgabe der Schule ist, die Schüler mit möglichst gleichen Chancen ins Berufsleben zu entlassen, muss sie diese dazu anhalten, sprachliche Charakteristika mit einer erwartungsgemäß niedrigen Akzeptanz abzulegen und sich statt dessen anderer sprachlicher Varietäten mit erwartungsgemäß höherer Akzeptanz zu bedienen.
Die Untersuchung dieser zweigliedrigen Hypothese ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Dazu wird in einem ersten Schritt ein Blick auf die Geschichte sprachlicher Normen und ihrer Durchsetzung geworfen. In einem zweiten Schritt wird dieser Prozess dann am Beispiel des Französischen, das im Laufe der letzten 500 Jahre sehr weitgehenden und ausdauernden Versuchen einer Normierung ausgesetzt war, näher beleuchtet. Das Schicksal des Jiddischen und seiner Sprecher im 19. Jahrhundert wirft ein Licht auf den Zusammenhang zwischen Sprachnorm und sozialer Diskriminierung. Im dritten und letzten Schritt werden dann die Konsequenzen aus dem Vorangegangenen für den Fremdsprachenunterricht an deutschen Schulen erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Sprache und Sprachnormen
- II.1) Was ist Sprache?
- II.2) Welche Sprache ist die richtige?
- III.) Sprachnormen bei der Arbeit
- III.I) Vom Flittchen zur «grande dame»: die französische Sprache
- III.2) Die Juden im deutschen Sprachraum: assimiliert, nicht akzeptiert
- IV.) Sprachnormen und Sprachdidaktik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sprachlichen Varietäten und ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz, insbesondere im Kontext der Sprachdidaktik. Sie hinterfragt die Annahme, dass bestimmte Sprachvarianten im formellen Kontext benachteiligen und analysiert die Rolle der Schule bei der Förderung bestimmter Sprachnormen.
- Die Geschichte und Durchsetzung sprachlicher Normen
- Die Entwicklung und Normierung des Französischen
- Der Zusammenhang zwischen Sprachnormen und sozialer Diskriminierung (am Beispiel Jiddisch)
- Die Implikationen für den Fremdsprachenunterricht
- Die gesellschaftliche Akzeptanz unterschiedlicher Sprachvarietäten
Zusammenfassung der Kapitel
I.) Einleitung: Die Einleitung präsentiert eine Anekdote über eine Politikerin, deren Dialekt im Wahlkampf thematisiert wird. Diese Anekdote dient als Ausgangspunkt für die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Besteht ein Zusammenhang zwischen der Verwendung bestimmter sprachlicher Varietäten und der Akzeptanz des Sprechers? Die Arbeit formuliert eine Hypothese, die untersucht werden soll: bestimmte sprachliche Varietäten führen zu höherer Akzeptanz als andere, und die Schule hat die Aufgabe, Schüler dazu anzuleiten, weniger akzeptierte Varietäten zugunsten akzeptierterer Formen aufzugeben. Die Arbeit skizziert den Aufbau: Zuerst wird die Geschichte sprachlicher Normen beleuchtet, dann werden anhand von Französisch und Jiddisch praktische Beispiele gegeben, und schliesslich wird die Rolle der Schule im Fremdsprachenunterricht diskutiert.
II.) Sprache und Sprachnormen: Dieses Kapitel beginnt mit der Frage nach der Entstehung und Vielfalt von Sprachen. Es thematisiert den oft religiösen Kontext von Sprache und die Schwierigkeiten, Sprachen klar voneinander abzugrenzen. Das Beispiel des Niederrheins zeigt, dass gegenseitige Verständlichkeit kein eindeutiges Kriterium für die Abgrenzung von Sprachen ist, da regionale Dialekte eine bedeutende Rolle spielen. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Diskussion über Sprachnormen und ihre sozialen Implikationen indem es die Komplexität von Sprache und Verständlichkeit aufzeigt.
III.) Sprachnormen bei der Arbeit: Dieses Kapitel behandelt die praktische Anwendung von Sprachnormen. Es untersucht die Entwicklung des Französischen über 500 Jahre, die versucht wurde zu normieren, und kontrastiert dies mit dem Schicksal des Jiddischen im 19. Jahrhundert, wo Sprachnormen mit sozialer Diskriminierung verbunden waren. Diese beiden Fallstudien belegen den Einfluss von Sprachnormen auf soziale Akzeptanz und den Gebrauch von Sprache im gesellschaftlichen Kontext. Es werden konkrete historische Beispiele und Entwicklungen analysiert um die These des Einflusses von Sprachnormen zu untermauern.
Schlüsselwörter
Sprachnormen, Sprachvarietäten, Dialekt, Standardsprache, Französisch, Jiddisch, soziale Akzeptanz, Sprachdidaktik, Fremdsprachenunterricht, Kommunikation, gesellschaftliche Normen, Linguistik, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Sprachnormen und gesellschaftliche Akzeptanz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sprachlichen Varietäten und ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz, insbesondere im Kontext der Sprachdidaktik. Sie analysiert die Rolle der Schule bei der Förderung bestimmter Sprachnormen und hinterfragt die Annahme, dass bestimmte Sprachvarianten im formellen Kontext benachteiligen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte und Durchsetzung sprachlicher Normen, die Entwicklung und Normierung des Französischen, den Zusammenhang zwischen Sprachnormen und sozialer Diskriminierung (am Beispiel Jiddisch), die Implikationen für den Fremdsprachenunterricht und die gesellschaftliche Akzeptanz unterschiedlicher Sprachvarietäten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Sprache und Sprachnormen, Sprachnormen bei der Arbeit und Sprachnormen und Sprachdidaktik. Die Einleitung präsentiert eine zentrale Forschungsfrage und eine Hypothese. Kapitel II beleuchtet die Entstehung und Vielfalt von Sprachen. Kapitel III untersucht die Entwicklung des Französischen und des Jiddischen als Fallstudien für den Einfluss von Sprachnormen auf soziale Akzeptanz. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Rolle der Schule im Fremdsprachenunterricht.
Wie wird die Hypothese der Arbeit untersucht?
Die Hypothese, dass bestimmte sprachliche Varietäten zu höherer Akzeptanz führen als andere, und die Schule weniger akzeptierte Varietäten zugunsten akzeptierterer Formen fördert, wird durch die Analyse der Geschichte sprachlicher Normen und anhand von Fallstudien (Französisch und Jiddisch) untersucht. Der Einfluss von Sprachnormen auf soziale Akzeptanz und den Gebrauch von Sprache im gesellschaftlichen Kontext wird analysiert.
Welche konkreten Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das Französische und das Jiddische als Fallstudien. Die Entwicklung des Französischen über 500 Jahre und die Versuche seiner Normierung werden mit dem Schicksal des Jiddischen im 19. Jahrhundert kontrastiert, wo Sprachnormen mit sozialer Diskriminierung verbunden waren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über den Einfluss von Sprachnormen auf die soziale Akzeptanz und den Gebrauch von Sprache im gesellschaftlichen Kontext. Sie diskutiert die Rolle der Schule im Fremdsprachenunterricht und die Implikationen für die Förderung von Sprachvielfalt und -toleranz. Die genauen Schlussfolgerungen werden im Text detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sprachnormen, Sprachvarietäten, Dialekt, Standardsprache, Französisch, Jiddisch, soziale Akzeptanz, Sprachdidaktik, Fremdsprachenunterricht, Kommunikation, gesellschaftliche Normen, Linguistik, Soziolinguistik.
- Citation du texte
- Martin Feyen (Auteur), 2001, Sprachnormen - ihre Geschichte, Funktion und Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77039