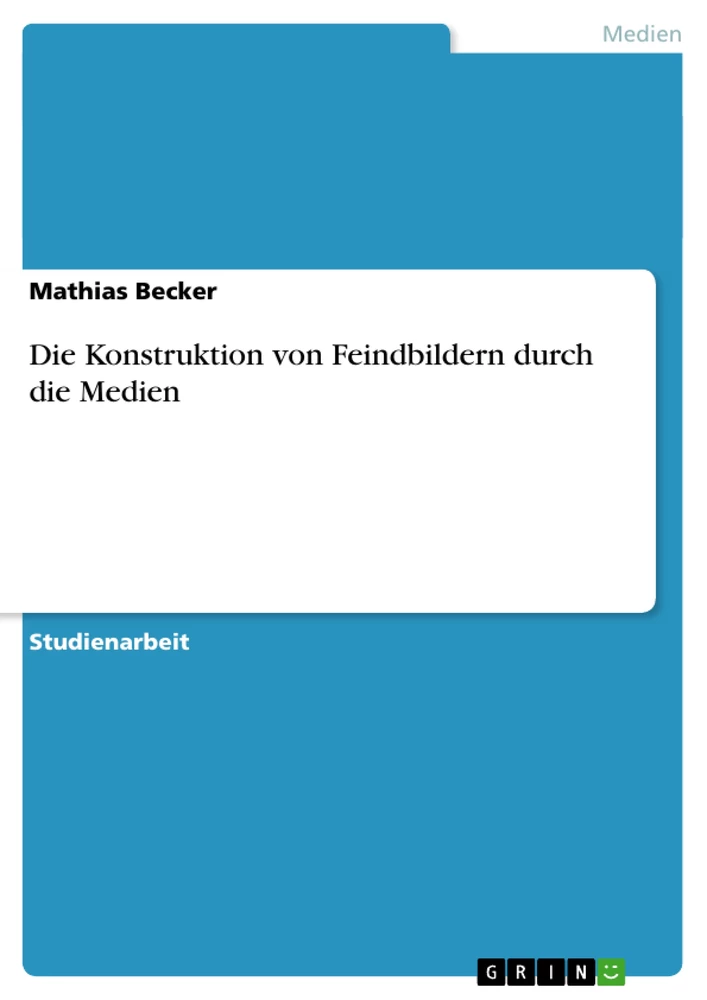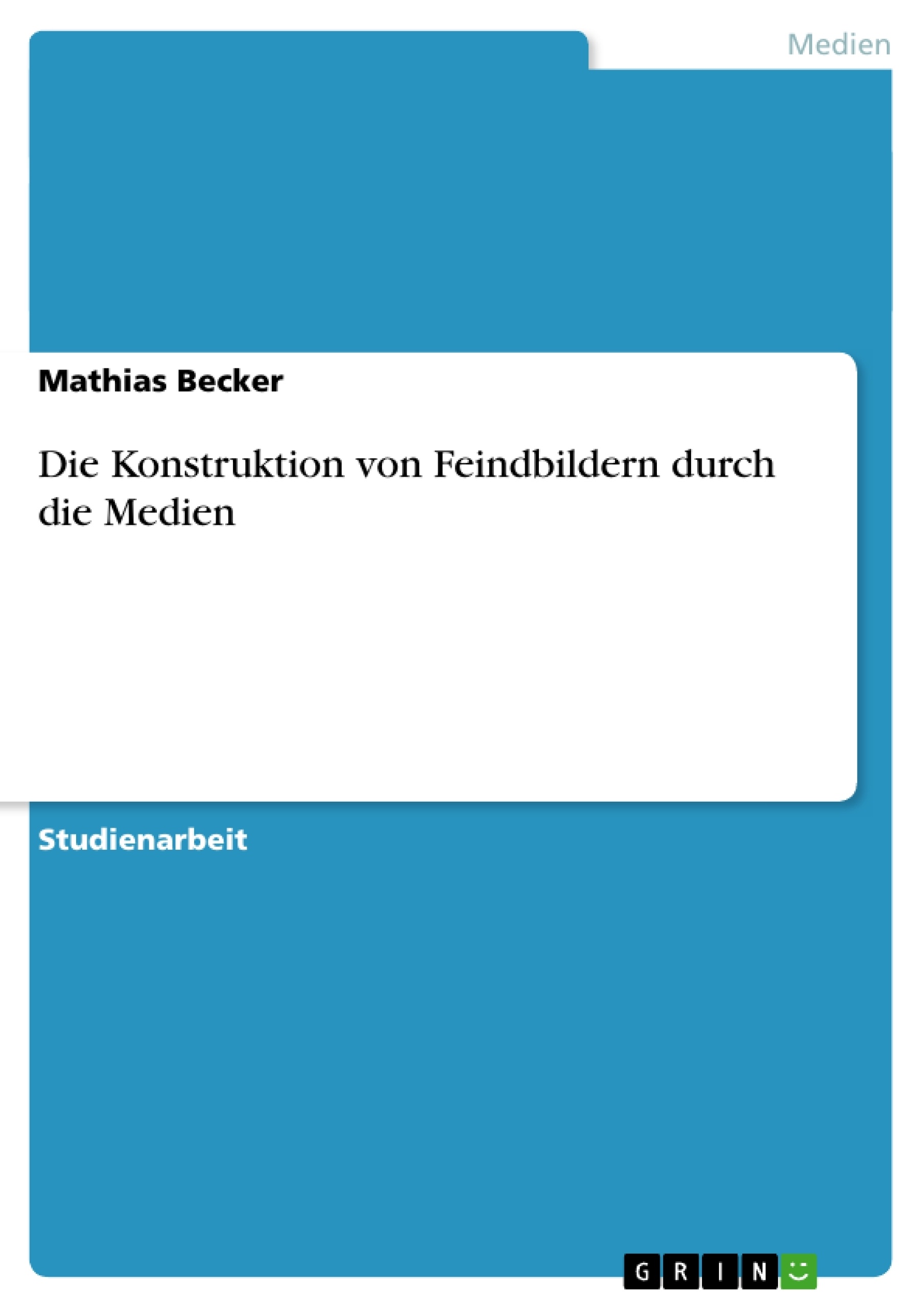„Als Schriftsteller hat mich beschäftigt die Genesis der Feindbilder: wie ein Ressentiment, Projektion der eigenen Widersprüche auf einen Sündenbock, ein Gemeinwesen erfasst und irreführt; die Epidemie der blinden Unterstellung, der Andersdenkende könnte es redlich nicht meinen [...]“ (Max Frisch 1976)
Vorurteile und Feindbilder sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, auch wenn sie nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar sind. Sie entstehen bei dem Versuch, unsere Umwelt zu kategorisieren und uns in ihr zu Recht zu finden, indem sie deren Komplexität vereinfachen. Gerade in Konfliktsituationen neigen wir dazu, die gegnerische Seite fremder wahrzunehmen als diese tatsächlich ist. Wir überschätzen die Unterschiede zwischen „uns“ und „den anderen“.
Was Max Frisch anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels über Feindbilder sagte, war geprägt von der Realität des Kalten Krieges. Seine Äußerungen haben aber bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Bedenkt man, auf welch fruchtbaren Boden die Propaganda der US-amerikanischen Regierung bei großen Teilen ihres Volkes stieß und mit welcher Begeisterung dieses mit ihr in den „Krieg gegen den Terrorismus“ zog, so scheint es heute wichtiger denn je, die Mechanismen der Feindbildkonstruktion und den Anteil der Massenmedien an diesen Prozessen zu untersuchen. Genau dies versucht die vorliegende Arbeit, indem zunächst einmal die grundlegenden Begriffe, die mit dieser Thematik verbunden sind, erläutert werden. Im Anschluss daran wird beschrieben, welche Funktionen Stereotype und Feindbilder sowohl für den Einzelnen als auch in der Gesellschaft innehaben und wie sie zustande kommen. Dabei liegt das Augenmerk insbesondere darauf, welche Rolle die Medien bei der Konstruktion von Feindbildern spielen und auf welche Art und Weise Journalisten bestehende Stereotype bedienen bzw. neue aufbauen. Zur Verdeutlichung dieser Problematik wird ein aktueller Zeitschriftenartikel anhand der gewonnenen Erkenntnisse untersucht, bevor im Schlussteil der Arbeit zusammenfassend noch einmal die Ursachen für die mediale Feindbildkonstruktion dargestellt und daraus resultierend Lösungsansätze für einen möglichen Abbau von Feindbildern diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begrifflichkeiten
- Konstruktivismus: Wahrnehmung und Wirklichkeit
- Image
- Stereotypen
- Vorurteile
- Feindbilder
- Funktionen von Feindbildern
- Wie Feindbilder entstehen
- Die Phase der Sozialisation
- Wie die Medien Feindbilder bedienen und konstruieren
- Selektionskriterien für Nachrichten
- Wie Sprache und Form Feindbilder konstruieren
- Analyse eines Zeitschriftenartikels
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Feindbildern durch die Medien. Sie untersucht die Rolle der Medien bei der Verstärkung von Stereotypen und Vorurteilen sowie die Entstehung von Feindbildern in der Gesellschaft. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Funktionen von Feindbildern und die Mechanismen, durch die sie entstehen.
- Der Einfluss des Konstruktivismus auf die Medienwirklichkeit
- Die Bedeutung von Stereotypen und Feindbildern in der Gesellschaft
- Die Rolle der Medien bei der Konstruktion von Feindbildern
- Die Funktionen von Feindbildern für Einzelpersonen und die Gesellschaft
- Die Mechanismen der Feindbildkonstruktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Feindbildkonstruktion ein und beleuchtet die Allgegenwart von Vorurteilen und Feindbildern in unserer Gesellschaft. Sie beschreibt die Entstehung von Feindbildern im Kontext des Kalten Krieges und die Aktualität dieser Thematik im Hinblick auf den „Krieg gegen den Terrorismus“.
Das Kapitel „Begrifflichkeiten“ erläutert grundlegende Begriffe, die für das Verständnis des Themas relevant sind. Es behandelt den Konstruktivismus, der die Bedeutung von Wahrnehmung und Wirklichkeit im Medienkontext beleuchtet, sowie die Abgrenzung der Begriffe „Image“, „Stereotyp“, „Vorurteil“ und „Feindbild“.
Das Kapitel „Funktionen von Feindbildern“ untersucht die Rolle von Stereotypen und Feindbildern in der Gesellschaft. Es betrachtet die Funktionen, die diese für den Einzelnen und die Gesellschaft haben. Die Arbeit geht auch auf die Entstehung von Feindbildern ein, insbesondere auf die Phase der Sozialisation, in der diese häufig verinnerlicht werden.
Das Kapitel „Wie die Medien Feindbilder bedienen und konstruieren“ behandelt die Rolle der Medien bei der Konstruktion von Feindbildern. Es beleuchtet Selektionskriterien für Nachrichten, die die Verbreitung von Stereotypen und Vorurteilen fördern können, sowie die Rolle der Sprache und der Form bei der Konstruktion von Feindbildern.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Feindbildkonstruktion, Stereotypen, Vorurteile, Medien, Selektionskriterien, Sprache, Form, Wahrnehmung, Wirklichkeit, Gesellschaft, Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen
Wie konstruieren Medien Feindbilder?
Medien nutzen spezifische Selektionskriterien für Nachrichten sowie eine wertende Sprache und Form, um komplexe Konflikte zu vereinfachen und „die anderen“ als Bedrohung darzustellen.
Welche Funktion haben Stereotype in der Gesellschaft?
Stereotype dienen der Komplexitätsreduktion; sie helfen Individuen, ihre Umwelt schnell zu kategorisieren, können aber auch zur Ausgrenzung und Vorurteilsbildung führen.
Was besagt der Konstruktivismus im Kontext der Medien?
Er geht davon aus, dass Medien keine objektive Realität abbilden, sondern eine mediale Wirklichkeit erschaffen, die durch Wahrnehmungsprozesse und gesellschaftliche Filter geprägt ist.
Wann entstehen Feindbilder meistens?
Oft werden Feindbilder bereits in der Phase der Sozialisation verinnerlicht und in Krisen- oder Kriegssituationen (z.B. „Krieg gegen den Terrorismus“) durch Propaganda reaktiviert.
Wie können Feindbilder wieder abgebaut werden?
Lösungsansätze liegen in der Förderung von Medienkompetenz, einer differenzierten Berichterstattung und dem bewussten Hinterfragen von sprachlichen Mustern in den Massenmedien.
- Quote paper
- Mathias Becker (Author), 2007, Die Konstruktion von Feindbildern durch die Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77463