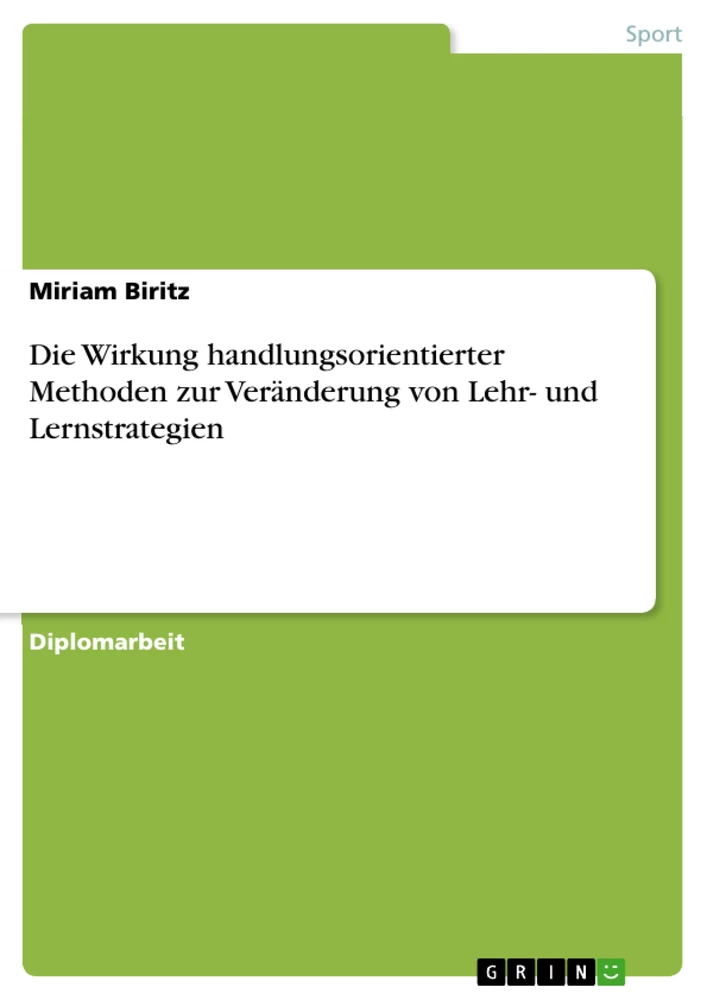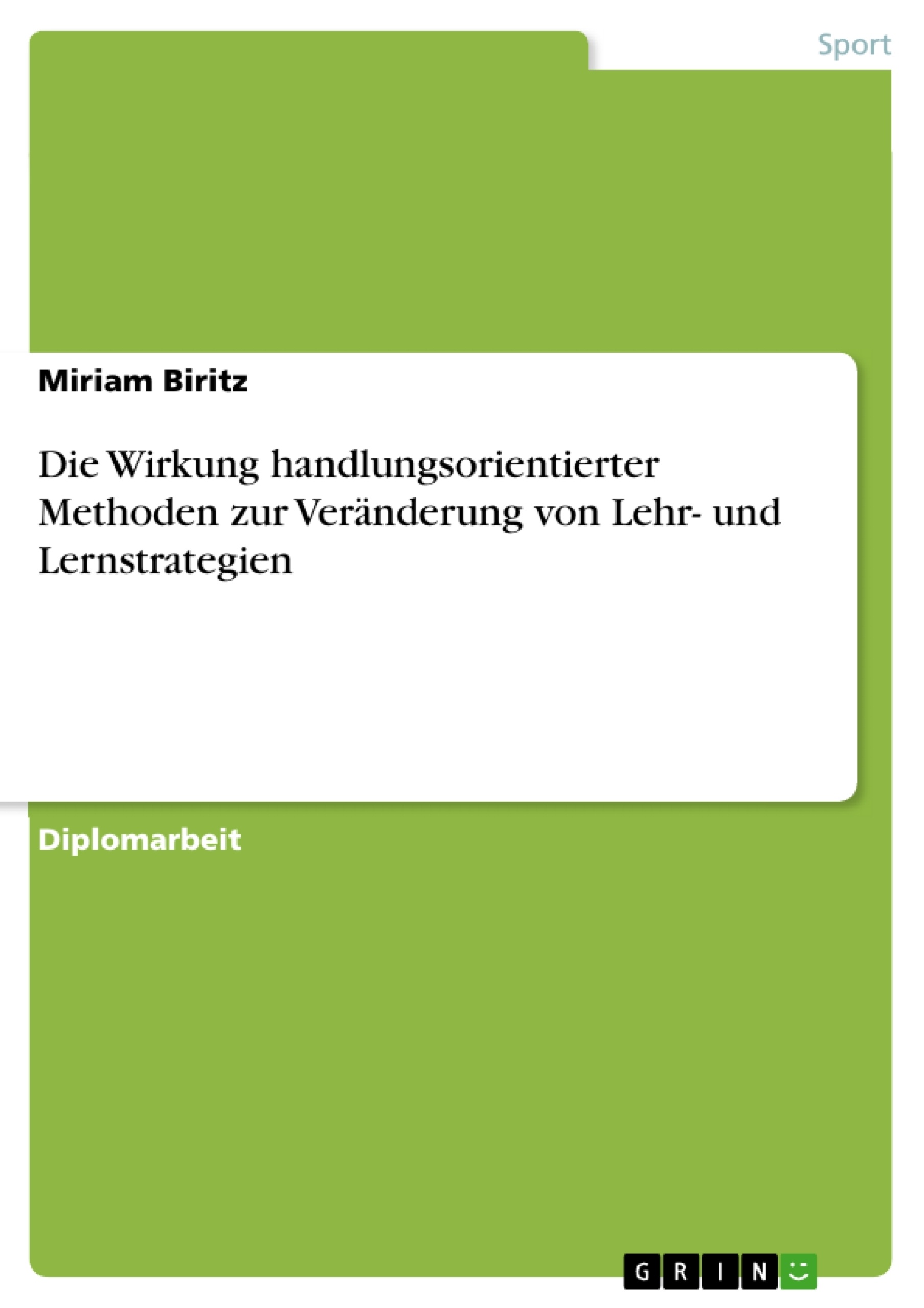Das Thema meiner Diplomarbeit sollte eigentlich ein ganz anderes sein. Doch aufgrund widriger Umstände bin ich dann bei diesem Thema gelandet, worüber ich jetzt froh bin. Ich möchte mich somit auch gleich bei Ao. Univ.Prof. Dr. Günter Amesberger bedanken, dass ich bei diesem Projekt mitarbeiten und somit die Daten für die Diplomarbeit nutzen konnte.
Mein Hauptaugenmerk wendet sich an die LehrerInnen der Schulen, da ich mich sehr für Lernsituationen in Schule und Universität und auch für die Schule als lernende Organisationen interessiere. Wichtig erachte ich die Methoden bzw. Vorgangsweisen mittels denen das Lernen unterstützt wird, da diese sowohl zu einer Steigerung des Lernverhaltens, als auch zur Verminderung des Lernverhaltens beitragen können. Weiters sind LehrerInnen wichtige Bezugspersonen für SchülerInnen, Schulleitung und Eltern, und bilden somit ein wichtiges Bindeglied zwischen den jeweiligen Gruppen.
Die Überlegung hinsichtlich der Strukturierung des hermeneutischen Teils dieser Arbeit bereitete mir sehr viel Mühe, da ich sowohl einen gewissen Überblick über die Umwelt und Arbeitssituation der LehrerInnen geben, aber doch nicht zu allgemein bleiben wollte. Es lag mir auch am Herzen, schon angewandte und mit Erfolg gekennzeichnete Formen der Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen darzustellen, sowie Qualitätskriterien für einen optimalen Unterricht anzuführen.
Meine Vorstellung war somit eine Annäherung an das Thema des empirischen Teils zu gewährleisten, welches sich auf die Interaktion in der Klasse zwischen SchülerInnen und LehrerInnen bezieht. Die Vorgangsweise sollte deswegen vom Allgemeinen zum Spezielle erfolgen. Das bedeutet nun, dass der hermeneutische Teil mit dem Prinzip des Wandels beginnt, da die Schule ständigen Veränderungen unterworfen ist. Als nächster Punkt wird die Funktion der LehrerIn als Change-Agentry angeführt, da die LehrerInnen ebenfalls zur Veränderung der Schule beizutragen haben. Weiters werden die Außenwelt und das Thema Erziehung vs. Bildung bearbeitet. Und als spezielle Bereiche, welche direkt mit dem empirischen Teil in Verbindung gebracht werden können, sind das soziale Lernen, das Lehrsystem und die Outdooraktivitäten zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Wandel
- Der/die Lehrerin als Change Agent
- Fallbeispiel IGL
- Kollegiale Beratung
- Die Außenwelt
- Erziehung vs. Bildung
- Soziales Lernen als Grundvoraussetzung für schulisches Lernen
- Das Lehrsystem
- Handlungsebene
- Metaebene
- Beziehungsebene
- Therapeutische Ebene
- Unterrichtskriterien
- Qualitätskriterien
- Qualitätskriterien für die Beziehungsebene
- Qualitätskriterien für die Inhaltsebene
- Lehrerinnenkriterien
- SchülerInnenkriterien
- Outdooraktivitäten
- Stellenwert der handlungsorientierten Methoden
- Bedeutung für die Schule
- Empirischer Teil
- Thema der Diplomarbeit
- Erklärung zum Projekt
- Inhalt des empirischen Teils
- Ziel
- Der Fragebogen
- SchülerInnenfragebogen
- LehrerInnenfragenbogen
- Die Gütekriterien der Skalen
- SchülerInnenskalen
- Linzer Fragebogen
- Berliner Skalen
- Schülerperzipierte Lehrerbezugsnorm
- Fachkompetenz
- Lebensweltbezug
- Soziale Etikettierung
- LehrerInnenskalen
- Skala zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung
- Skala zur Lehrer-Bezugsnorm-Orientierung
- Maslach Burnout Inventory
- Berufliche Belastung
- Herausforderungs-, Bedrohungs- und Verlusteinschätzungen von Lehrern
- Kollektive Selbstwirksamkeitserwartung
- Rivalität
- Lernbereitschaft
- Hypothesen
- Geschlechtsspezifischer Vergleich von Versuchsklassen und Kontrollklassen der befragten SchülerInnen
- Lebensweltbezug
- Unterrichtszufriedenheit
- Schüler-Sozialklima
- Schülerperzipierte Lehrerbezugsnorm
- Fachkompetenz
- Soziale Etikettierung
- Störeignung
- Unterrichtsdruck
- Vermittlungsqualität
- Schülerbeteiligung
- Pädagogisches Engagement
- Restriktivität
- Mitsprache der SchülerInnen
- Rivalität in der Klasse
- Lernbereitschaft in der Klasse
- Zusammenfassung
- Vergleich zwischen LehrerInnen und SchülerInnen
- Balkendiagramme der LehrerInnenskalen
- Balkendiagramme der SchülerInnenskalen
- Qualitativer Vergleich der SchülerInnenskalen mit den LehrerInnenskalen
- Die Bedeutung des Wandels im Bildungssystem und die Rolle der Lehrer*innen als Change Agents
- Die Förderung von sozialem Lernen als Grundlage für erfolgreiches schulisches Lernen
- Die Analyse verschiedener handlungsorientierter Methoden und ihrer Anwendung im schulischen Kontext
- Die Untersuchung der Auswirkungen dieser Methoden auf die Motivation und das Lernverhalten von Schüler*innen
- Die Analyse der Herausforderungen und Chancen, die sich für Lehrer*innen durch die Implementierung handlungsorientierter Methoden ergeben
- Einleitung: Diese Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext der Bildungslandschaft.
- Der Wandel: Dieses Kapitel analysiert den Wandel im Bildungssystem und die Herausforderungen, die sich für Lehrer*innen durch die neuen Anforderungen ergeben.
- Der/die Lehrerin als Change Agent: Dieser Abschnitt beleuchtet die Rolle der Lehrer*innen als Change Agents und untersucht verschiedene Ansätze, wie Lehrer*innen die Veränderungsprozesse im Bildungssystem aktiv gestalten können.
- Die Außenwelt: In diesem Kapitel wird der Einfluss der Außenwelt auf das Bildungssystem und die Lernumgebung von Schüler*innen betrachtet.
- Erziehung vs. Bildung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen Erziehung und Bildung und untersucht deren Bedeutung im Kontext der Diplomarbeit.
- Soziales Lernen als Grundvoraussetzung für schulisches Lernen: Hier wird der Stellenwert von sozialem Lernen für erfolgreiches Lernen im schulischen Kontext untersucht.
- Das Lehrsystem: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ebenen des Lehrsystems und zeigt die Bedeutung der Beziehungsebene, der Handlungsebene, der Metaebene und der therapeutischen Ebene für erfolgreiches Lernen auf.
- Outdooraktivitäten: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung von Outdooraktivitäten im schulischen Kontext und untersucht den Stellenwert handlungsorientierter Methoden.
- Empirischer Teil: Der empirische Teil der Diplomarbeit beschreibt die Forschungsmethodik und die Datenerhebung. Er stellt die Forschungsfragen, die Hypothesen und die gewählten Messinstrumente vor.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Wirkung handlungsorientierter Methoden auf die Veränderung von Lehr- und Lernstrategien. Sie untersucht die Auswirkungen dieser Methoden auf Schüler*innen und Lehrer*innen sowie die Auswirkungen auf die Lernumgebung im Klassenzimmer.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Handlungsorientierte Methoden, Lehr- und Lernstrategien, Change Agent, Soziales Lernen, Bildungssystem, Outdooraktivitäten, empirische Forschung, Schüler*innenmotivation, Lehrer*innenrolle, Unterrichtsqualität, Lehrer*innen-Selbstwirksamkeitserwartung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind handlungsorientierte Methoden im Unterricht?
Das sind Lehrmethoden, bei denen die Schüler aktiv in den Lernprozess einbezogen werden. Lernen erfolgt hier durch praktisches Tun, Ausprobieren und Interaktion, statt durch rein passives Zuhören.
Welche Rolle spielt die Lehrkraft als „Change Agent“?
Lehrer fungieren als Change Agents, wenn sie aktiv Schulentwicklungsprozesse vorantreiben, neue Lehrmethoden implementieren und den Wandel der Schule hin zu einer lernenden Organisation gestalten.
Warum ist soziales Lernen für den schulischen Erfolg wichtig?
Soziales Lernen fördert die Klassengemeinschaft und das Sozialklima. Ein positives Umfeld reduziert Störungen und erhöht die Lernbereitschaft sowie die Motivation der Schüler.
Welchen Stellenwert haben Outdooraktivitäten im Lehrplan?
Outdooraktivitäten bieten einen hohen Lebensweltbezug und fördern die Gruppendynamik. Sie ermöglichen Erfahrungen außerhalb des klassischen Klassenzimmers und unterstützen die ganzheitliche Bildung.
Was sind Qualitätskriterien für einen guten Unterricht?
Dazu gehören eine klare Strukturierung, ein wertschätzendes Lehrer-Schüler-Verhältnis, die Förderung der Eigenständigkeit und die methodische Vielfalt zur Unterstützung verschiedener Lerntypen.
Wie wirkt sich handlungsorientiertes Lernen auf die Selbstwirksamkeit aus?
Durch erfolgreiches praktisches Handeln erfahren Schüler und Lehrer eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung, was das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt und die Belastbarkeit erhöht.
- Quote paper
- Mag. Miriam Biritz (Author), 2003, Die Wirkung handlungsorientierter Methoden zur Veränderung von Lehr- und Lernstrategien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77544