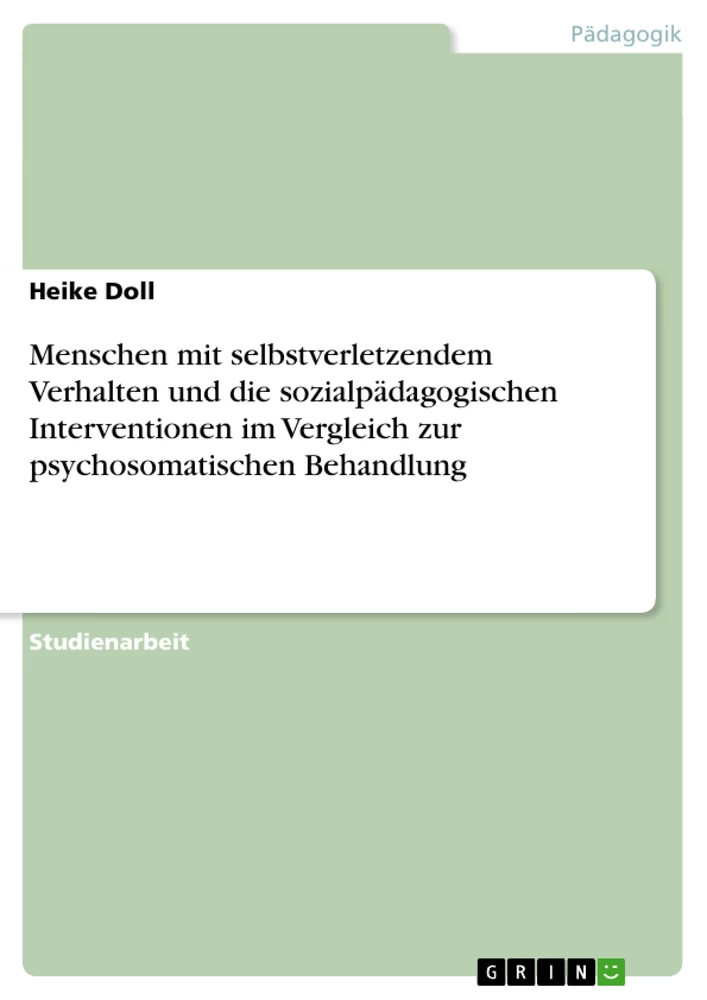2. Einleitung
In den Zeitungen liest man immer wieder von Menschen, vermehrt Jugendlichen, die von anderen mit Glasscherben geschnitten, brennenden Zigaretten verbrannt oder gezwungen werden gesundheitsschädliche Flüssigkeiten zu trinken. Das empfinden wir als ausgesprochene Quälerei und können nicht verstehen, wie Menschen anderen gegenüber so grausam sein können. Noch viel weniger ist aber zu verstehen, warum sich Menschen das selbst antun, warum sie sich selbst diese Qualen und Schmerzen bereiten. Es erscheint völlig absurd und widersinnig, seinen eigenen Körper zu verunstalten, wo doch die Gesundheit als das höchste Gut des Menschen gilt. Wie ist dieses Verhalten zu erklären? Da es ja nicht nur die Schmerzen sind, die man erleiden muss, sondern auch die Abweisung, den Ekel, das Unverständnis und oft auch die Verurteilung durch seine Mitmenschen, die durch das Selbstverletzende Verhalten schnell an ihre Empathiegrenzen stoßen. Vor kurzer Zeit bot sich mir jedoch die Möglichkeit, in einer heilpädagogischen Intensivgruppe Einblick in die Arbeit der Heilerziehungspfleger zu bekommen. Während dieser Zeit konnte ich in Ansätzen eine Empathie für Jugendliche mit SVV entwickeln und es erschütterte mich immer wieder, wenn ich erfuhr, was die Jugendlichen zur Selbstverletzung trieb. Sicherlich ist zu unterschieden, ob es sich bei diesen Verletzungen auf der einen Seite um verschiedene kulturelle oder religiöse Momente handelt, wie z.B. Initiationsriten oder ob es sich um Selbstverletzungen in alltägliche Situationen handelt oder ob es sich andererseits um psychotische Selbstverletzungen handelt oder ob das Verhalten organische Ursachen hat. Im Folgenden möchte ich kurz auf Selbstverletzendes Verhalten im alltäglichen, religiösen und kulturellen Zusammenhang eingehen. Auf SVV aus organischen Gründen werde ich aus zeitlichen Gründen hier verzichten. Da ich in der Gruppe nur, für mich zum Teil sehr schockierende, Berichte über Selbstverletzung mit psychotischem Hintergrund erfahren habe, möchte ich folgende Fragen eingehender betrachten: Was treibt Menschen dazu, den eigenen Körper als Objekt zu benutzen? Sich Wunden zu bereiten, die immer sichtbar sein werden? Warum können sich die Betroffenen nur durch selbst zugefügte Verletzungen spüren oder sich anderen mitteilen? Ab wann verwischen die Grenzen so sehr, dass man nicht mehr von einem normalen, sondern von einem psychotischen Verhalten spricht? Ebenso sollen folgende Fragen Beachtung finden: Wo kann hier die sozialpädagogische Arbeit ansetzen? Wie kann der Sozialpädagoge intervenieren? Und kann sich die Sozialpädagogik auf diesem Feld gegenüber den anderen Disziplinen wie Medizin und Psychologie behaupten? Sollte sie sich klar von den anderen Professionen abgrenzen oder sich als ein „Mischgebilde“ aus verschiedenen Aufgabenfeldern erschließen?
In der Literatur werden dem Ritzen, sich verbrennen, Injizieren von Flüssigkeiten, kurz, dem sich willentlichen Zufügen von Schmerzen und Wunden viele Namen zugewiesen, wie Autoaggression, Automutilation, Autodestruktion, Selbstschädigendes Verhalten und Selbstverletzendes Verhalten. Da ich derselben Ansicht wie Sachsse bin, dass der Begriff Selbstverletzendes Verhalten (SVV) am wenigsten wertend zu verstehen ist und die betroffenen Personen nicht gleich vorverurteilt werden, werde ich ihn auch für meine Arbeit verwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Gesellschaftlich anerkanntes Selbstschädigendes Verhalten
- Selbstverletzendes Verhalten
- Heimliche Selbstbeschädigung
- Münchhausen-Syndrom
- Münchhausen by proxy-Syndrom
- Anorexia-Nervosa und Bulimie
- Offene Selbstverletzung
- Heimliche Selbstbeschädigung
- Sozialpädagogische Interventionen
- Therapieansätze
- Grundsätze der sozialpädagogischen Arbeit
- Grundsätze auf der Ebene der Patientinnen
- Auf der Ebene der professionellen Helfer
- Schlussfolgerungen
- Ausblick
- Anmerkung
- Danksagung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten (SVV) und die sozialpädagogischen Interventionen im Vergleich zur psychosomatischen Behandlung. Die Autorin analysiert verschiedene Formen von SVV, von gesellschaftlich akzeptierten Praktiken bis hin zu psychisch bedingten Selbstverletzungen. Ein zentrales Anliegen ist die Klärung der Frage, wie sozialpädagogische Arbeit auf diesem Feld effektiv eingesetzt werden kann und wie sie sich zu anderen Disziplinen positioniert.
- Definition und Erscheinungsformen von Selbstverletzendem Verhalten (SVV)
- Gesellschaftlich akzeptierte Formen von SVV in verschiedenen Kulturen und Religionen
- Sozialpädagogische Interventionen und Therapieansätze bei SVV
- Vergleich der sozialpädagogischen mit der psychosomatischen Behandlung von SVV
- Die Rolle des Sozialpädagogen in der Intervention und Behandlung von SVV
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt in poetischer Form die Erfahrung der Selbstverletzung als eine Art von Erleichterung inmitten von seelischem Schmerz und Ohnmacht. Es dient als emotionaler Einstieg in das Thema.
Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik des selbstverletzenden Verhaltens vor und kontrastiert gesellschaftliche Reaktionen auf Selbstverletzung bei anderen mit dem Verhalten der Betroffenen selbst. Sie beschreibt den Zugang der Autorin zum Thema durch die Arbeit in einer heilpädagogischen Intensivgruppe und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Dabei wird die Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen und Ursachen des SVV angesprochen (kulturell, religiös, psychisch, organisch). Der Fokus wird auf SVV mit psychotischem Hintergrund gelegt.
Gesellschaftlich anerkanntes Selbstschädigendes Verhalten: Dieses Kapitel beleuchtet historisch und kulturell verankerte Praktiken des Selbstschädigens, von rituellen Handlungen in Stammeskulturen und Religionen (Christentum, Hinduismus) bis hin zu Schönheitsidealen vergangener Epochen. Es zeigt die Bandbreite an Motiven und gesellschaftlichen Kontexten, in denen Selbstverletzung vorkommen kann, und hebt den Kontrast zu modernen Reaktionen auf SVV hervor.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten (SVV), Sozialpädagogische Interventionen, Psychosomatische Behandlung, Heilpädagogik, Kulturelle und religiöse Riten, Psychotische Selbstverletzung, Therapieansätze, Sozialarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbstverletzendes Verhalten und sozialpädagogische Interventionen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht selbstverletzendes Verhalten (SVV) und den Vergleich sozialpädagogischer Interventionen mit psychosomatischer Behandlung. Sie analysiert verschiedene Formen von SVV, von gesellschaftlich akzeptierten Praktiken bis hin zu psychisch bedingten Selbstverletzungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Effektivität sozialpädagogischer Arbeit und ihrer Positionierung im Vergleich zu anderen Disziplinen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Definition und Erscheinungsformen von SVV, gesellschaftlich akzeptierte Formen von SVV in verschiedenen Kulturen und Religionen, sozialpädagogische Interventionen und Therapieansätze bei SVV, einen Vergleich der sozialpädagogischen mit der psychosomatischen Behandlung von SVV und die Rolle des Sozialpädagogen in der Intervention und Behandlung von SVV.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, eine Einleitung, ein Kapitel zu gesellschaftlich anerkanntem selbstschädigendem Verhalten, ein Kapitel zu selbstverletzendem Verhalten (inkl. Unterkapiteln zu heimlicher Selbstbeschädigung – Münchhausen-Syndrom und Münchhausen by proxy-Syndrom –, Anorexia Nervosa und Bulimie, sowie offener Selbstverletzung), ein Kapitel zu sozialpädagogischen Interventionen (inkl. Therapieansätze und Grundsätze der sozialpädagogischen Arbeit auf der Ebene der Patientinnen und der professionellen Helfer), Schlussfolgerungen, einen Ausblick, eine Anmerkung, Danksagung und ein Literaturverzeichnis.
Wie wird das Vorwort beschrieben?
Das Vorwort beschreibt die Erfahrung der Selbstverletzung poetisch als eine Art Erleichterung inmitten von seelischem Schmerz und Ohnmacht. Es dient als emotionaler Einstieg in das Thema.
Was ist der Fokus der Einleitung?
Die Einleitung stellt die Thematik des SVV vor und kontrastiert gesellschaftliche Reaktionen auf Selbstverletzung mit dem Verhalten der Betroffenen. Sie beschreibt den Zugang der Autorin zum Thema durch die Arbeit in einer heilpädagogischen Intensivgruppe und benennt die zentralen Forschungsfragen. Der Fokus liegt auf SVV mit psychotischem Hintergrund.
Worum geht es im Kapitel „Gesellschaftlich anerkanntes Selbstschädigendes Verhalten“?
Dieses Kapitel beleuchtet historisch und kulturell verankerte Praktiken des Selbstschädigens, von rituellen Handlungen in Stammeskulturen und Religionen bis hin zu Schönheitsidealen vergangener Epochen. Es zeigt die Bandbreite an Motiven und Kontexten, in denen Selbstverletzung vorkommen kann, und hebt den Kontrast zu modernen Reaktionen auf SVV hervor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Selbstverletzendes Verhalten (SVV), Sozialpädagogische Interventionen, Psychosomatische Behandlung, Heilpädagogik, Kulturelle und religiöse Riten, Psychotische Selbstverletzung, Therapieansätze, Sozialarbeit.
- Citation du texte
- Heike Doll (Auteur), 2006, Menschen mit selbstverletzendem Verhalten und die sozialpädagogischen Interventionen im Vergleich zur psychosomatischen Behandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77568