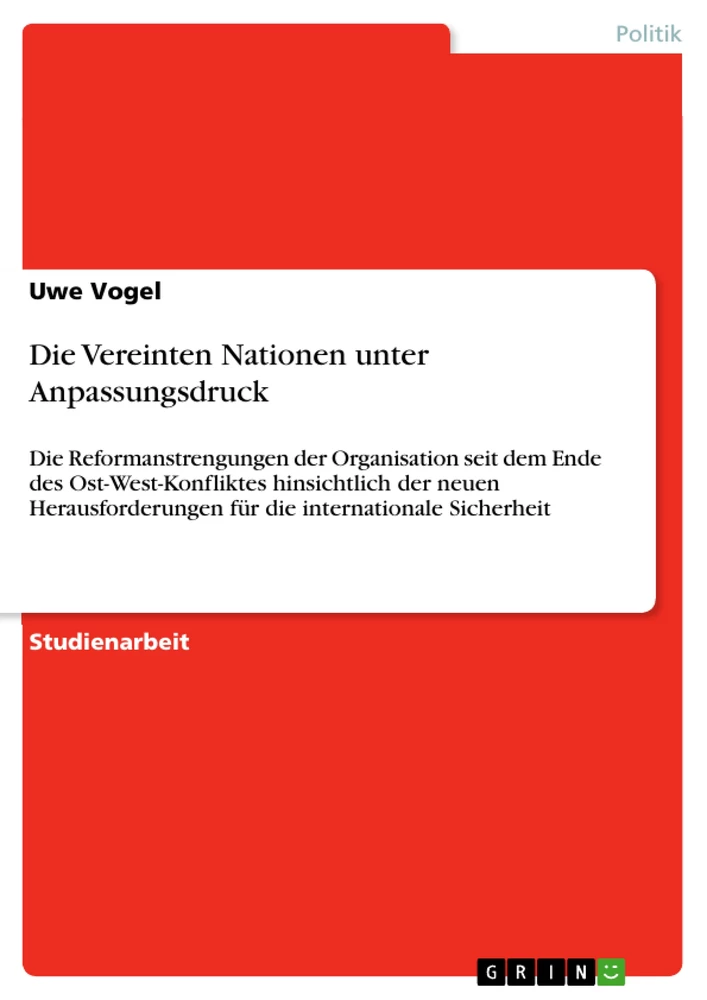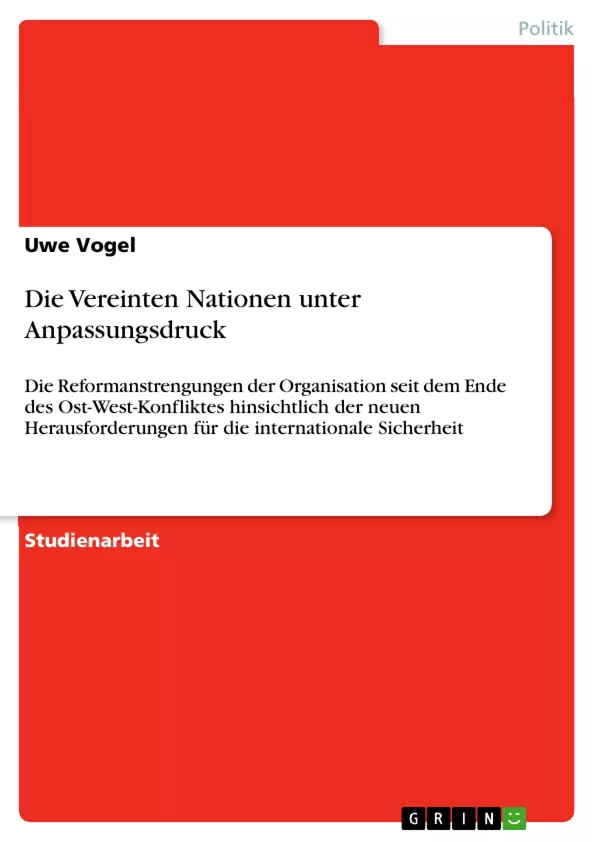Mit dem Zerfall der UdSSR 1990/91 wandelte sich die Struktur des internationalen Systems in eine annähernd unipolare Konstellation. Im Rahmen dessen erhielt die UNO zunächst eine bis dato nie da gewesene Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Gleichzeitig stellte der Strukturwandel die Staaten und damit auch die UNO vor eine Vielzahl von Herausforderungen, mit denen sich die Regelungsbereiche der VN schlagartig vergrößerten. In der Folge sollte die internationale Organisation sehr schnell an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. Seit dem Irakkrieg im Frühjahr 2003, befinden sich die VN in einer existenziellen Krise.
Angesichts der evidenten Schwierigkeiten schwanken die Prognosen über die zukünftige Bedeutung der VN für die internationalen Beziehungen zwischen den Polen vollständiger Marginalisierung und sukzessiver Revitalisierung. Für die Zukunft der UNO stellt sich die Frage, ob sie den neuen Herausforderungen gewachsen sein wird. Eine Frage, deren Beantwortung untrennbar mit den Reformanstrengungen verbunden ist, die seit Beginn der neunziger Jahre initiiert wurden. Daher unternimmt die vorliegende Arbeit den Versuch diese Reformbestrebungen unter besonderer Berücksichtigung des Weltgipfels vom September 2005 im Bereich der Friedenssicherung, damit verbunden des Völkerrechts, aus politikwissenschaftlicher Perspektive auf ihren Erfolg hin zu analysieren, um so einen Beitrag zur Diskussion um die Zukunftsaussichten der Organisation zu leisten.
Zunächst wird in einem einführenden Kapitel das Spektrum der neuen Herausforderungen in einem zusammenfassenden Überblick dargestellt. Anschließend erfolgt die Analyse der Reformanstrengungen der VN in den einzelnen Kapiteln jeweils anhand dreier Unterfragen: 1. Welche neue Herausforderungen haben den Reformimpuls gegeben und wie sahen bzw. sehen die bedeutenden Reformansätze aus? 2. Welche Interessenkonstellationen der wichtigsten politischen Akteure existierten bzw. existieren in Bezug auf die Reformvorschläge? 3. Wie sind die Reformansätze zum Ersten unter dem Gesichtspunkt der Anpassung der UNO an die neuen Herausforderungen und zum Zweiten ob ihrer Chancen der Realisierung aufgrund der Interessenkonstellationen unter den Mitgliedstaaten zu bewerten?
Darauf folgend soll in der Schlussbetrachtung auf Grundlage der Analyse ein Urteil darüber gefällt werden, ob die VN den neuen Herausforderungen im Bereich der Friedenssicherung gewachsen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Untersuchungsgegenstand
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Analyseraster und Aufbau
- 1.4 Forschungsstand
- 2. Neue Herausforderungen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
- 3. Die Entwicklung der Friedensoperationen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
- 3.1 Das Instrument der UN-Blauhelme
- 3.2 Die zweite Generation der Friedensoperationen
- 3.3 Das Trauma Somalia und seine Folgen
- 3.4 Die Entwicklung einer vierten Generation der Friedensoperationen
- 3.5 Der Brahimi-Bericht
- 3.6 Die Kommission für Friedenskonsolidierung
- 4. Die humanitäre Intervention als völkerrechtliches Problem der Friedenssicherung
- 4.1 Die Entstehung des Instrumentes der humanitären Intervention
- 4.2 Die Entwicklung der Responsibility to Protect
- 5. Die präemptive Selbstverteidigung als völkerrechtliches Problem der Friedenssicherung nach dem 11.9.2001
- 6. Die institutionelle Reform des Sicherheitsrates
- 7. Schlussbetrachtung
- 7.1 Zusammenfassung
- 7.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Reformbemühungen der Vereinten Nationen im Bereich der Friedenssicherung seit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Sie untersucht, inwieweit diese Reformen auf die neuen Herausforderungen im internationalen Sicherheitsbereich reagieren und welche Erfolgschancen sie haben.
- Analyse der neuen Herausforderungen für die internationale Sicherheit nach dem Ende des Kalten Krieges.
- Bewertung der UN-Reformansätze im Kontext der Friedenssicherung.
- Untersuchung der Interessenkonstellationen der wichtigsten politischen Akteure bezüglich der UN-Reformen.
- Evaluierung des Erfolgs der Reformbemühungen hinsichtlich der Anpassung der UNO an neue Herausforderungen.
- Beurteilung der Realisierungschance der Reformansätze aufgrund der Interessenlage der Mitgliedstaaten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es den Untersuchungsgegenstand (die UN-Reformbemühungen im Bereich der Friedenssicherung), die Problemstellung (die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der UNO angesichts neuer Herausforderungen), den methodischen Ansatz (Analyse der Reformansätze unter Berücksichtigung von Herausforderungen, Interessenkonstellationen und Realisierungsmöglichkeiten) und den Forschungsstand (bestehend aus UNO-Pessimisten, -Enthusiasten und einer neutraleren Gruppe) darlegt. Der Fokus liegt auf der Analyse des HLP-Berichts und Annans Reformplan als umfassende Reaktionen auf die neuen Herausforderungen.
2. Neue Herausforderungen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes: Dieses Kapitel beschreibt die veränderte Struktur des internationalen Systems nach dem Ende des Kalten Krieges und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Vereinten Nationen. Es beleuchtet die anfängliche Hoffnung auf eine neue Weltordnung unter Führung der UNO, gefolgt von einer Zunahme an Konflikten und humanitären Krisen, die die Organisation an ihre Grenzen brachten. Die wachsende Komplexität und der Anstieg von Friedensoperationen werden als zentrale Herausforderungen hervorgehoben.
3. Die Entwicklung der Friedensoperationen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der UN-Friedensoperationen in verschiedenen Generationen. Es beleuchtet den Einsatz von UN-Blauhelmen, die Herausforderungen der zweiten Generation von Friedensoperationen, das Debakel in Somalia und die daraus resultierenden Lehren. Die Entwicklung hin zu einer vierten Generation von Friedensoperationen, der Brahimi-Bericht und die Peacebuilding Commission werden als wichtige Schritte im Anpassungsprozess diskutiert.
4. Die humanitäre Intervention als völkerrechtliches Problem der Friedenssicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Instruments der humanitären Intervention und dem Prinzip der „Responsibility to Protect“. Es analysiert die völkerrechtlichen Herausforderungen, die sich aus humanitären Interventionen ergeben, insbesondere die Frage nach dem Mandat des Sicherheitsrats und die Grenzen staatlicher Souveränität.
5. Die präemptive Selbstverteidigung als völkerrechtliches Problem der Friedenssicherung nach dem 11.9.2001: Dieses Kapitel untersucht die völkerrechtlichen Implikationen der präemptiven Selbstverteidigung nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Es analysiert die Debatte um die Rechtmäßigkeit präventiver militärischer Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Rolle der Vereinten Nationen in der Friedenssicherung.
6. Die institutionelle Reform des Sicherheitsrates: Dieses Kapitel analysiert die Reformbemühungen im Hinblick auf den Sicherheitsrat. Es betrachtet die Herausforderungen einer Reform des Gremiums, die Zusammensetzung des Rates und die Machtverteilung unter den ständigen Mitgliedern. Die Debatte um Vetorecht und Erweiterung des Sicherheitsrates wird hier thematisiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der UN-Reformbemühungen im Bereich der Friedenssicherung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Reformbemühungen der Vereinten Nationen im Bereich der Friedenssicherung seit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Sie untersucht, inwieweit diese Reformen auf die neuen Herausforderungen im internationalen Sicherheitsbereich reagieren und welche Erfolgschancen sie haben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Neue Herausforderungen für die internationale Sicherheit nach dem Ende des Kalten Krieges; Bewertung der UN-Reformansätze im Kontext der Friedenssicherung; Untersuchung der Interessenkonstellationen der wichtigsten politischen Akteure bezüglich der UN-Reformen; Evaluierung des Erfolgs der Reformbemühungen hinsichtlich der Anpassung der UNO an neue Herausforderungen; Beurteilung der Realisierungschance der Reformansätze aufgrund der Interessenlage der Mitgliedstaaten; Entwicklung der Friedensoperationen (inkl. UN-Blauhelme, Somalia-Debakel, Brahimi-Bericht, Peacebuilding Commission); Humanitäre Intervention und Responsibility to Protect; Präemptive Selbstverteidigung nach dem 11. September 2001; Institutionelle Reform des Sicherheitsrates (inkl. Vetorecht und Erweiterung).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (Untersuchungsgegenstand, Problemstellung, Analyseraster, Forschungsstand); Neue Herausforderungen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes; Entwicklung der Friedensoperationen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes; Humanitäre Intervention als völkerrechtliches Problem der Friedenssicherung; Präemptive Selbstverteidigung als völkerrechtliches Problem der Friedenssicherung nach dem 11.9.2001; Institutionelle Reform des Sicherheitsrates; Schlussbetrachtung (Zusammenfassung und Ausblick).
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert die UN-Reformansätze unter Berücksichtigung der Herausforderungen, der Interessenkonstellationen der wichtigsten Akteure und der Realisierungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt auf der Analyse des HLP-Berichts und Annans Reformplan.
Welche Akteure werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Interessenkonstellationen der wichtigsten politischen Akteure bezüglich der UN-Reformen, jedoch werden die spezifischen Akteure nicht im Detail in der FAQ genannt. Diese Information findet sich im Haupttext der Arbeit.
Wie wird der Forschungsstand dargestellt?
Der Forschungsstand wird in der Einleitung präsentiert und umfasst verschiedene Perspektiven: UNO-Pessimisten, -Enthusiasten und eine neutralere Gruppe. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des HLP-Berichts und Annans Reformplan als umfassende Reaktionen auf die neuen Herausforderungen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit sind in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und bieten einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Die spezifischen Schlussfolgerungen sind im Haupttext zu finden.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht in diesem FAQ enthalten, sondern muss separat bezogen werden.
- Citar trabajo
- Uwe Vogel (Autor), 2007, Die Vereinten Nationen unter Anpassungsdruck , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77613