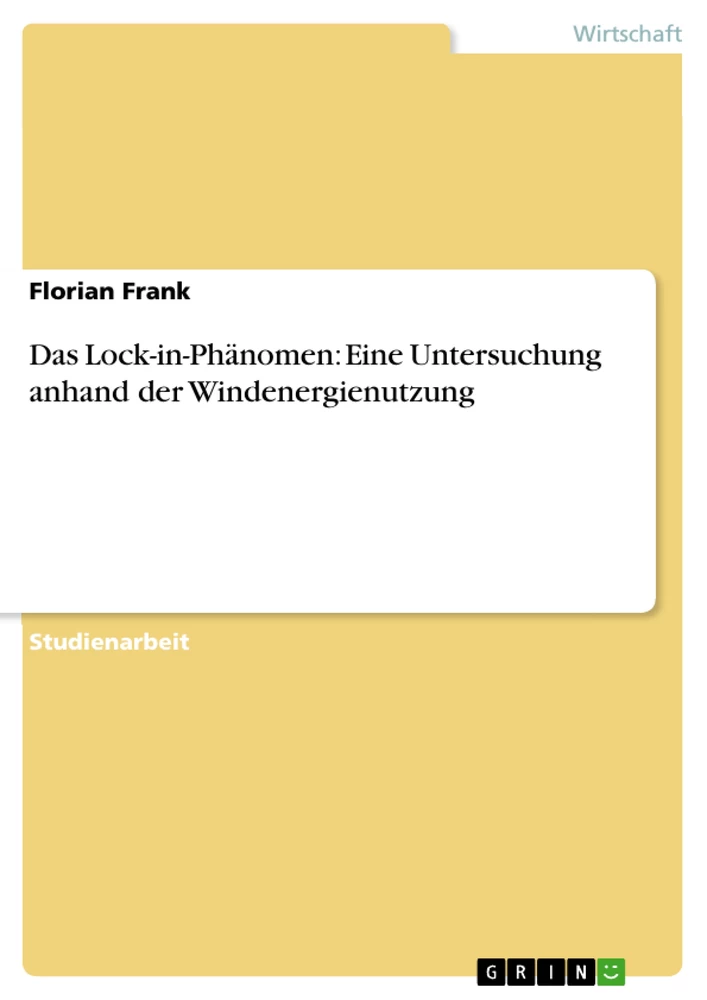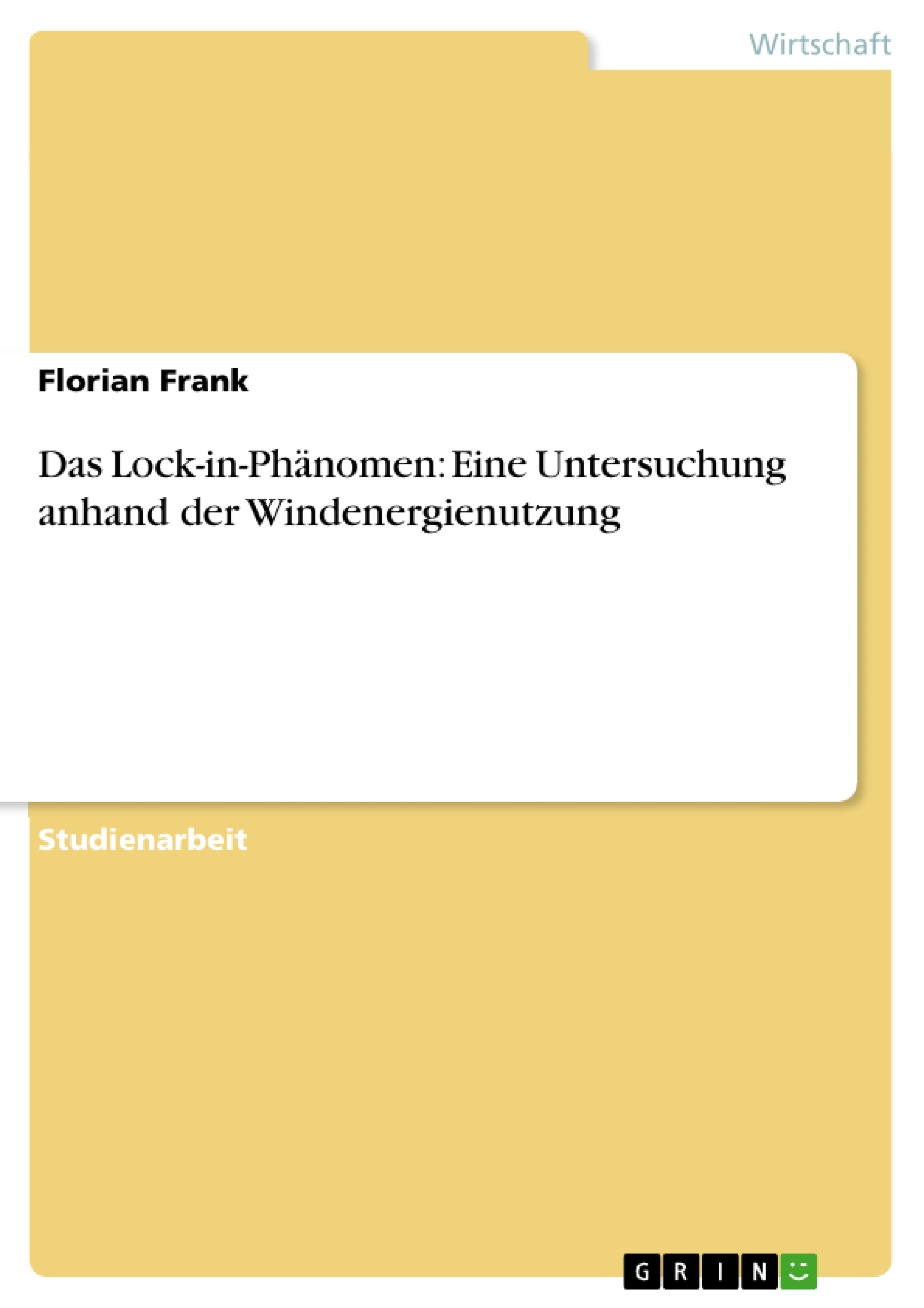Seit Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts ist das Phänomen des technologischen Lock-ins nicht nur für Ökonomen von zunehmendem Interesse, sondern auch für Historiker und Soziologen. Für Wissenschaftler, die sich für die Interdependenzen von technologischem und ökologischem Wandel interessieren, gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung. Die zentrale Idee des Lock-ins ist, dass Technologien und technologische Systeme einem bestimmten Entwicklungspfad folgen, den man nur unter schwierigen und kostenintensiven Umständen wieder verlassen kann. D.h. sie entwickeln sich pfadabhängig.
Die in der Literatur entwickelten Erklärungsansätze für Lock-in-Phänomene wurden aufgegriffen, um die Beharrlichkeit bestimmter Institutionen zu begründen, da festgestellt wurde, dass Institutionen teilweise ebenso wie bestimmte Technologien einer pfadabhängigen Entwicklung folgen.
Des Weiteren ist das Lock-in-Phänomen in den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit seinen umweltökonomischen Auswirkungen von einigen Autoren erforscht worden. Diese Autoren stellen fest, dass eine pfadabhängige Entwicklung besonders bei Technologien der Energieerzeugung beobachtbar ist und dass in den meisten Volkswirtschaften die konventionelle Energieerzeugung dominiert. Trotz großer Fortschritte und Innovationen in der Technik derjenigen Energiesysteme, die auf regenerativen Energieträgern basieren, nimmt deren Anteil an der Energiebereitstellung nur geringfügig zu. Das heißt, es liegt einerseits ein Lock-in hinsichtlich der konventionellen Energieerzeugung vor und andererseits eine Ausgrenzung (Lock-out) der Nutzung regenerativer Energien.
Die Autoren versuchen jedoch nicht diese Lock-in- bzw. Lock-out-Situationen anhand der gängigen Modelle und Denkansätze zum Lock-in-Phänomen zu begründen, sondern stellen diese Situationen lediglich anhand der Verbreitung (bezogen auf den Primärenergieverbrauch) der verschieden Energiesysteme fest.
Diese Arbeit stellt einen Zusammenhang zwischen den allgemeinen Erklärungsansätzen des Lock-in-Phänomens und der festgestellten Lock-in- bzw. Lock-out-Situationen bei bestimmten Energiesystemen her.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Technologischer Lock-in
- Technologische Paradigmen und Pfadabhängigkeit
- Zunehmende Anwendungserträge
- Lern- und Skaleneffekte
- Netzwerkeffekte
- Weitere Gründe für zunehmende Anwendungserträge
- Allgemeine Kritik und eine zusammenfassende Aussage zum Lock-in
- Institutioneller Lock-in und institutionelle Auswirkungen auf den technologischen Lock-in
- Die umweltökonomische Bedeutung des Lock-in-Phänomens
- Die Ausgrenzung der Windenergie durch technologischen Lock-in
- Netzwerkeffekte in Form von Kapazitätseffekten in der Windenergienutzung
- Netzwerkeffekte durch eine räumliche Verteilung von Windkraftanlagen
- Zunahme der Kapazitätseffekte durch Windleistungsprognosen
- Die Auswirkungen einer Optimierung der Anlagentechnik von Windkraftanlagen auf die schwankende Leistungsabgabe
- Konklusionen
- Ermittlung der Lern- und Skaleneffekte in der Windenergienutzung unter Anwendung des Erfahrungskurvenmodells
- Der Einfluss der Institutionen auf die Windenergienutzung am Beispiel Deutschlands
- Zusammenfassung
- Resümee und politische Implikationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Lock-in-Phänomen, das auftritt, wenn eine Technologie oder ein System trotz der Existenz besserer Alternativen dominiert. Die Arbeit analysiert das Phänomen anhand der Windenergienutzung und untersucht, wie technologische und institutionelle Faktoren die Verbreitung dieser erneuerbaren Energiequelle beeinflussen können.
- Technologische Paradigmen und Pfadabhängigkeit
- Zunehmende Anwendungserträge und ihre Rolle bei der Festigung von Technologien
- Der Einfluss von Institutionen auf technologische Entwicklungen
- Die umweltökonomische Bedeutung des Lock-in-Phänomens
- Die Ausgrenzung von Windenergie durch technologischen Lock-in
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt das Lock-in-Phänomen vor und erläutert seine Relevanz im Kontext der Energiewende. Die Studie fokussiert auf die Windenergienutzung und deren Herausforderungen in einem von etablierten Technologien dominierten Energiesystem.
- Technologischer Lock-in: Das Kapitel beleuchtet die Ursachen des Lock-in-Phänomens, insbesondere die Rolle von technologischen Paradigmen und zunehmenden Anwendungserträgen. Es werden Lern- und Skaleneffekte, Netzwerkeffekte und weitere Gründe für diese Effekte diskutiert.
- Institutioneller Lock-in: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Institutionen auf den technologischen Lock-in. Es beleuchtet, wie politische Rahmenbedingungen, Regulierungen und Förderprogramme die Verbreitung von Technologien beeinflussen können.
- Die umweltökonomische Bedeutung des Lock-in-Phänomens: Das Kapitel verdeutlicht die Bedeutung des Lock-in-Phänomens für die Umweltökonomie. Es diskutiert die Folgen von technologischen Lock-in-Effekten für die Umwelt und die nachhaltige Entwicklung.
- Die Ausgrenzung der Windenergie durch technologischen Lock-in: Dieses Kapitel fokussiert auf die Windenergie und untersucht, wie technologische und institutionelle Faktoren ihre Verbreitung behindern können. Es analysiert Netzwerkeffekte, Lern- und Skaleneffekte sowie den Einfluss von Institutionen auf die Windkraftnutzung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Lock-in-Phänomen im Kontext der Energiewende und der Windenergienutzung. Schlüsselbegriffe sind: technologischer Lock-in, Pfadabhängigkeit, zunehmende Anwendungserträge, Lern- und Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, institutioneller Lock-in, Umweltökonomie, Windkraftanlagen, Kapazitätseffekte, Erfahrungskurvenmodell, institutionelle Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Lock-in-Phänomen?
Lock-in bezeichnet die Dominanz einer Technologie oder eines Systems, das aufgrund früherer Entscheidungen und Pfadabhängigkeiten so fest etabliert ist, dass ein Wechsel zu besseren Alternativen sehr kostspielig und schwierig ist.
Wie zeigt sich der Lock-in bei der konventionellen Energieerzeugung?
Bestehende Infrastrukturen, eingespielte Lieferketten und politische Institutionen sind auf fossile Brennstoffe optimiert, was den Markteintritt erneuerbarer Energien wie der Windkraft erschwert (Lock-out Effekt).
Welche Rolle spielen Netzwerkeffekte bei der Windenergie?
Netzwerkeffekte entstehen z. B. durch die räumliche Verteilung von Anlagen und die Integration in das Stromnetz, was die Stabilität der Energieabgabe und die Effizienz des Gesamtsystems beeinflusst.
Was sind Lern- und Skaleneffekte?
Lerneffekte senken die Kosten durch wachsende Erfahrung in der Produktion, während Skaleneffekte Kostenvorteile durch Massenproduktion beschreiben – beides stabilisiert bestehende Pfade.
Wie beeinflussen Institutionen den technologischen Pfad?
Gesetze, Förderprogramme und Regulierungen können entweder alte Technologien schützen oder gezielt Anreize setzen, um einen „Path Break“ (Pfadwechsel) hin zu nachhaltigen Systemen zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Florian Frank (Autor), 2006, Das Lock-in-Phänomen: Eine Untersuchung anhand der Windenergienutzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77631